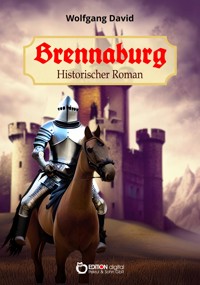6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wolfgang David, belesen und erfahren in der verständlichen Darlegung komplizierter ästhetischer Fragen, tritt in diesem Essay temperamentvoll, beredsam und entschieden dafür ein, mit der Kunst so umzugehen, dass „für uns das Beste dabei herauskommt“. Nicht wenige Rezensionen, so stellt er fest, sind noch weit davon entfernt. Das ärgert und veranlasst ihn zu analytischer Kritik von Kritiken in Tageszeitungen und Fachzeitschriften sowie zur Suche nach den Ursachen unangemessener Wertungen. Adressaten seines Essays sind alle, die sich mit Literatur beschäftigen - ob als Rezensent, Nachwortschreiber, Interviewer oder Interviewter, ob als Teilnehmer von Lesungen, wo man seine Meinung äußert, zurückhält oder verleugnet - und denen die Folgen ihrer Äußerungen nicht gleichgültig sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Wolfgang David
Hund unterm Tisch?
Gedanken zur Literaturkritik
ISBN 978-3-96521-952-6 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1985 im Mitteldeutschen Verlag Halle Leipzig.
© 2023 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Von einem potenten Kritiker sich erkannt und diagnostiziert zu sehen, ist dasselbe, wie von einem guten Arzt untersucht worden zu sein … Man erschrickt vielleicht, man ist vielleicht auch verletzt, aber man weiß sich ernst genommen, auch wenn die Diagnose ein Todesurteil sein sollte.
HERMANN HESSE
Und schließlich gleicht der wahre Kritiker beim Lesen eines Buches einem Hunde beim Festmahl, dessen Sinnen und Trachten einzig auf das gerichtet ist, was die Gäste fortwerfen, und der daher dort am meisten knurren wird, wo die wenigsten Knochen abfallen.
JONATHAN SWIFT
I. Kein Perpetuum mobile
Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht, was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt, kann man miteinander zum Unbekannten fortschreiten.
JOHANN WOLFGANG GOETHE
Die Wirkung nützlicher Literatur zu unterstützen und die unnützlicher zu behindern, dadurch auch künftig die eine wahrscheinlicher und die andere unwahrscheinlicher zu machen – das ist die Hauptaufgabe der Kritik. Sie löst oder verfehlt sie nicht nur, indem sie Autoren und Leser mit Wertungen bedrängt, also Bedürfnisse und Maßstäbe frontal zu bestätigen bzw. zu verunsichern sucht. Der Grad ihrer Zuwendung zu bestimmten Büchern, das, was sie an Diskussionen anzettelt oder hintertreibt, der Gestus, mit dem über Kunst zu sprechen sie vorschlägt, dies alles führt zu diesem Ziel hin oder von ihm weg. Kritiken sind nicht verbindlich, doch sie „machen vor“ und nehmen so Einfluss darauf, wie die Gesellschaft Literatur verwertet, was für Werke sie zur Verfügung hat und haben wird.
Überall wird darum gerungen, Bewertungsfehler möglichst klein zu halten. In Medizin, Technik und Politik haben sie häufig schlimme Auswirkungen. Im Falle der Kunst sind die Folgen längst nicht so drastisch. Doch obwohl zunächst nichts Spektakuläres passiert, dürfen wir sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Schaden hat nur eine andere Gestalt, wirkt wie eine Essenz, die uns zwar nicht tötet, aber allmählich schwächt, woran man sich ja gewöhnen kann. Wenn das geschehen ist, sind wir leicht kaum mehr der Verwunderung darüber fähig, dass wir uns so geändert haben. Das klingt übertrieben, doch nimmt man einen Zeitraum, der Generationen umfasst, trifft es sicherlich das Wesen der Sache. Deshalb ist richtiges Werten nicht bloß ein Problem von Leuten, denen Meinungsvielfalt und -streit Unbehagen bereitet. Es ist genau in dem Maße ein wichtiges gesellschaftliches Problem, wie Literatur in einer Gesellschaft eine wichtige Funktion innehat.
Wirklich? Dem Satz wird sicherlich niemand widersprechen, dennoch bezweifle ich, dass er eine verbreitete Überzeugung ausdrückt. Kritische Fehlurteile, sofern sie in der Vergangenheit gefällt wurden, rufen in der Regel ein Gefühl hervor, das eher von Befriedigung als Empörung geprägt ist. Der Betroffene hat unser Mitleid nicht mehr nötig, daher treten andere Empfindungen hervor: Eine gewisse Genugtuung darüber, dass auch die Großen ihren Ärger hatten, Schadenfreude über jene Tröpfe, die sich so geirrt hatten, Behagen am Kuriosen. Und ist es nicht kurios, wenn Stendhal Jahrzehnte nach seinem Tod entdeckt wurde, zu einem Zeitpunkt, den er außerdem ziemlich genau vorausgesagt hatte? Wenn Tolstoi Wagner und Shakespeare zaust, dass dem Kunstphilister der Atem stockt, Goethe jede Menge mittelmäßiger Leute lobt, einem Kleist jedoch die kalte Schulter zeigt, wenn Alfred Kerr aus Thomas Mann Kleinholz macht?
Das ist aber noch nicht alles. Wir gewinnen aus solchen Fällen (und gerade die merken wir uns) die stille Gewissheit, dass sich wahre Kunst irgendwann immer durchsetzt und nichts ihren Siegeszug verhindern kann, weil ihn ein beliebiger Zufall zu gegebener Zeit einleiten wird. Selbstverständlich ist das ein Trugschluss, denn von jenen, die aus dem einen oder anderen Grund auf der Strecke blieben, wissen wir ja meist nicht viel. Doch gerade dieser Märchenglaube, der die Kunstgeschichte durch das Raster seiner Wünsche betrachtet, erklärt, warum die Kritik an der Kritik nie so recht gefruchtet hat. Man nahm sie nicht ernst genug, denn wahre Kunst …
Wie gesagt – vernünftig war das zu keiner Zeit, doch ein Schaden, der sich nicht einmal mehr schätzen lässt, ist leicht zu verschmerzen. Und irgendwie ging es ja trotzdem.
Die absolute Zunahme veröffentlichter (wenn auch auf verschiedene Weise verfügbarer) Bücher gibt Veranlassung, diese Haltung radikal zu überprüfen – bereits, was die Gegenwart, erst recht aber die Zukunft anlangt. Denn die Entwicklung steuert auf einen kritischen Punkt zu. War es im, sagen wir, 18. Jahrhundert noch möglich gewesen, die bedeutsamen Werke der Vergangenheit und Gegenwart zu kennen und sich über sie zu verständigen (das gilt natürlich nur für privilegierte Gruppen), so gelingt das heute kaum noch Fachleuten. Durchschnittlich immer weniger Menschen sind durch die gemeinsame Aufnahme vieler Bücher miteinander verbunden, und jener sozusagen naturwüchsige Mechanismus (in idealer Form hat es ihn freilich niemals gegeben), mit dem für einen gewissen Zeitraum „per Abstimmung“ Wertmaßstäbe objektiviert und beglaubigt werden, kann daher zunehmend weniger funktionieren.
Überlässt man sich dieser Entwicklung, kann das Willkür, Orientierungslosigkeit und Verlust an möglicher Wirkung von Literatur zur Folge haben. Denn ihre kommunikationsstiftenden Potenzen, die für sie Lebenselixier und zugleich Korrektiv sind, werden dadurch unterlaufen. Zugespitzt: Was für einen wesentlichen Unterschied macht es, ob ein Werk nicht geschrieben wird oder in der Öffentlichkeit nur eine formale, scheinbare Existenz führt, weil „seine“ Leser in der Masse des Gedruckten zu ihm kaum noch finden können?
Boden, der nicht mehr durch Wurzeln gehalten wird, schwimmt oder fliegt weg, und das lässt sich nur mühevoll, mitunter gar nicht mehr rückgängig machen. Ähnlich ist es mit der Literatur: Was nicht ins Bewusstsein der Menschen gedrungen oder einmal daraus verschwunden ist, kann unwiederbringlich verloren sein. Diese Gefahr wächst in dem Maße, wie der Zufall hineinspielt. Denn je länger der Weg zum Ziel ist und je mehr Gestrüpp sich dazwischen aufrichtet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nie ankommt und sich mit dem gerade Erreichbaren begnügt. Jenes geheimnisvolle Gesetz, wonach alles Brauchbare unvermeidlich seinen Nutznießer findet und alles Überflüssige und Schädliche ausgeschieden wird, gibt es nicht. Vergessen wir auch nicht, dass Bedürfnisse durch die wirklichen Gegenstände ihrer Befriedigung geprägt werden. Sie haben einen Spielraum, der nach oben, aber auch nach unten ausgemessen werden kann. Insofern bestimmt das, womit wir uns heute bescheiden, nicht unerheblich mit, worum wir uns morgen bemühen werden.
Die Logik dieses Prozesses zwingt – wollen wir ihr nicht erliegen – demnach zu verstärkter Vorauswahl, und zwar auf jeder Ebene der Literaturgesellschaft. Alles hängt nun davon ab, nach welchen Gesichtspunkten ausgewählt wird: dem Diktat der Moden oder anderen Äußerlichkeiten folgend – oder mit dem wachsenden Vermögen, Ballast abzuwerfen bzw. gar nicht erst aufzunehmen. Dass der Kritik bei der Verbreitung richtiger Wertmaßstäbe eine Schlüsselrolle zufällt, liegt auf der Hand.
Die Literaturkritik muss besser werden. Kann sie es aber auch? Es gibt genügend Gründe, diese defätistisch klingende Frage zu stellen und sich die Antwort nicht zu leicht zu machen. Denn: Wie rasch wird mitunter etwas zur Aufgabe oder zum Problem erklärt und dabei vergessen, dass sich ein Problem nicht nur gegenüber unseren Wünschen, sondern auch in Bezug auf objektive Gesetzmäßigkeiten zu rechtfertigen hat.
Klassisches Beispiel hierfür sind all die Versuche, ein Perpetuum mobile zu konstruieren, also eine Maschine, die, einmal in Gang gesetzt, ohne Energiezufuhr arbeitet. Schön wär’s, doch im Ersten Hauptsatz der Thermodynamik wird dieses „Problem“ begründet abgefertigt. Damit hat es aufgehört, eins zu sein.
Entspringt die traditionelle Unzufriedenheit mit der Kunstkritik vielleicht auch einem Wunschdenken?
Es fällt schon auf, wie häufig Künstler behaupten, dass sie sich von der Kritik nichts erhoffen, dass sie sie nicht besser, sondern gar nicht wollen. Ein paar Zitate, die diese Einstellung in knapper Form veranschaulichen:
Die Kritik ist eine Steuer, die der Neid dem Talent auferlegt (Gaston de Lévis).
Der Kritiker ist ein Wegelagerer auf dem Wege zum Ruhm (Robert Burns).
Ein Kritiker ist ein Mann ohne Beine, der das Laufen lehrt (Channing Pollock).
Alle Kritik, aller Tadel läuft auf den Satz hinaus: Ich bin nicht du (Paul Valéry).
Ich halte es für falsch, solche Auffassungen sofort als Reaktion auf erlittene Kränkungen abzutun. Sinnvoller scheint es mir, sie zum Anlass zu nehmen, sich der besonderen Schwierigkeiten zu vergewissern, welche mit der Bewertung von Kunst verbunden sind. Nur wenn man diese Schwierigkeiten kennt, lässt sich entscheiden, ob die Verbesserung der Kritik wirklich ein Problem oder bloß ein frommer Wunsch ist.
Auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen gibt es Gruppen, die im Auftrag und im Interesse einer sehr viel größeren Zahl von Menschen Produkte bewerten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dabei erfolgreich sind, ist in der Regel vergleichsweise hoch. Einmal deshalb, weil sie sich vielfach auf deutliche und allgemein akzeptierte Wertvorstellungen stützen können. Denn den meisten Produkten gegenüber verhalten wir uns nicht so sehr als Individuen, sondern als biologische Wesen, Angehörige der Gattung bzw. einer sozialen Gruppe. Ein Beil etwa ist „gut“, wenn seine Schneide scharf ist und fest am Holm sitzt. Käme einer und meinte, dass dieses scharfe Beil seiner „persönlichen Ansicht nach“ wertlos sei und nicht seinem Geschmack entspräche, würde er zumindest Verwunderung erregen.
Häufig ist es so, dass dort, wo sehr erbittert und „ergebnislos“ über den Wert eines Produktes gestritten wird, man dessen Wesentliches verfehlt; stellen wir uns spaßeshalber Kranke vor, die sich darüber in die Haare geraten, ob ein Medikament gut oder schlecht schmecke, statt sich dafür zu interessieren, ob es ihnen hilft oder nicht. Die wertende Instanz hat es darum verhältnismäßig leicht, als Repräsentant eines bestimmten kollektiven Subjekts aufzutreten.
Kunstwerken bringen wir von vornherein etwas andere Erwartungen entgegen. Es gehört zu ihren wesentlichen Eigenschaften, dass sie auch den Bereich der Persönlichkeit anzurühren vermögen, den man Individualität nennt. Das geht völlig in Ordnung. Solche Unterschiede zwischen den Menschen sind eine historische Errungenschaft (wenn nicht in jedem konkreten Fall, so doch im Prinzip), und da wir nun einmal als Gattungs-, Kollektiv- und Einzelwesen existieren, wollen wir uns auch in dieser Einheit erleben. Kunst hilft uns dabei. Für die Kritik allerdings ist es unter diesen Umständen ungemein kompliziert, ihrer Stellvertreter-Funktion gerecht zu werden.
Noch verzwickter wird die Aufgabe des Kritikers aus einem anderen Grund. Naturwissenschaftler sind in der beneidenswerten Lage, vielfach beweisen, sogar mit Messdaten belegen zu können, welcher Faktor welche Wirkung hervorruft. Dort, wo sie das heute noch nicht vermögen, wird es gewiss morgen oder übermorgen der Fall sein. Kunstwirkungen dagegen lassen sich kaum messen (vom Steigen des Blutdruckes bei der Lektüre eines Kriminalromans einmal abgesehen), noch geben sie sich im Verhalten zweifelsfrei zu erkennen. Freilich zeugen Gelächter, Tränen usw. von „Wirkung“, aber doch nur recht begrenzt. Und um sie eindeutig zu identifizieren, sind die Methoden der Sozialforschung ein noch viel zu grobes Besteck – ganz zu schweigen von der Möglichkeit, solche Erscheinungen vergleichbar zu dokumentieren. Was die Langzeitwirkungen anlangt, so kommt hier noch hinzu, dass sich der Einfluss bestimmter Kunstwerke auf die Persönlichkeitsstruktur allein unter Laborbedingungen exakt nachweisen lässt (weil er nur so isoliert werden kann), was aber aus naheliegenden Gründen praktisch nicht zu realisieren ist.
Der Vergleich mit den Fortschritten der „exakten Wissenschaften“ weckt bei manchem den Wunsch, dass auch die Kritik davon profitieren möge, wodurch viel überflüssiger Streit sich von selbst erledigen würde. Allenfalls für das Interregnum, in dem wir noch kein kunstwissenschaftliches „Thermometer“ besitzen, wird die Berechtigung des Subjektiven anerkannt. So äußerte Hanns Eisler in den Gesprächen mit Hans Bunge (Tonbandprotokoll):
„Noch nie hat sich ein Mensch wirklich – ein Wissenschaftler – echt beschäftigt mit den Wirkungen eines Musikstückes auf den Menschen. Nicht einmal die primitivsten Reihenexperimente wurden gemacht: ob der Blutdruck steigt oder sinkt, wenn man ein Musikstück von bestimmtem Typus hört; … welche Veränderungen in der Physis des Menschen und der Psyche des Menschen gemacht werden … Wir reden über Ästhetik wie die Dorftrottel vom Traktor, den sie noch nie gesehen haben … Die Ästhetik – auch die marxistische – wird von mir als Metaphysik entthront. Ich verlange exakte Experimente, bevor wir über Kunst reden … Bei gewisser Musik steigt der Blutdruck. Ab fünfzig Jahren dürfte diese Musik dann nicht mehr gehört werden, weil da schon die Arteriosklerose eingesetzt hat. Und gewisse Stücke dürften nicht mehr gespielt werden, weil sie den Blutdruck senken bei Leuten, die bereits niedrigen Blutdruck haben.“
Eisler räumt ein, dass es schon beim Drama komplizierter sei, „da es sich weniger um Blutdruck handelt als um Erkenntnisse“; auch will er nicht so genau beim Wort genommen werden, denn er weiß: „So geht es nicht.“ Trotzdem beharrt er auf der Forderung nach exakter Wirkungsforschung, denn „sonst kommen wir in einen völligen Wirrwarr der alten Hermeneutik und der alten Metaphysik, die mir zum Hals heraushängen“.
Trennen wir also seine Vorschläge von dem Wunsch, der hinter ihnen steht, sehen wir auch noch davon ab, dass er gegenwärtig kaum zu verwirklichen ist: Dann bleibt immer noch die Frage, ob und in welchem Maße die Kritik nicht vielleicht künftig wissenschaftlicher betrieben werden kann, als es heute der Fall ist.
Zunächst: Es steht außer Zweifel, dass Erkenntnisse der Kunstsoziologie und -psychologie, der Kunstwissenschaften überhaupt, für den Kritiker sehr nützlich sein können. Beispielsweise dadurch, dass sie verstreute oder sogar verschüttete Erfahrungen mit Kunst zusammentragen, systematisieren und auf den Begriff bringen, Vor-Urteile (die sich hier besonders lange halten) bestätigen oder zurückweisen, Subjektives von Subjektivistischem unterscheidbar machen. Wenn Subjektives nicht ständig aufgearbeitet und objektiviert wird, laufen wir Gefahr, immer wieder beim Punkt Null zu beginnen; manch abwegige Auffassung über die Leistungsmöglichkeiten von Kunst, die es „eigentlich“ nicht mehr geben dürfte, zeugt davon. Die Kritik hat also die Kontrolle und den Beistand der Wissenschaft durchaus nötig.
Doch es geht noch um etwas anderes. Wird man einmal – und sei es in ferner Zukunft – alle wichtigen „Parameter“ eines Kunstwerkes so darstellen können, wie wir es von der Analyse einer Substanz oder eines technischen Gerätes her gewöhnt sind?
Ungeachtet aller Fortschritte, die zu wünschen und zu erwarten sind, zeigen sich dennoch Barrieren, die man wohl oder übel wird respektieren müssen.
Zum einen sind Kunstwerke zu komplexe Gebilde, als dass ihr Gehalt vollständig „übersetzt“, also in eine Wissenschaftssprache überführt werden kann. Anders gesagt: Die Interpretation eines künstlerischen Modells kann „immer nur approximativ sein“ (Juri Lotman).
Eine einfache Überlegung mag das veranschaulichen. Jeder weiß, dass Kunstwerke nicht notwendig das Schicksal technischer und wissenschaftlicher Leistungen teilen müssen – nämlich, für die Verbesserten Nachfolger bloß Humus zu sein. Jene können auch späteren Generationen noch wertvoll und unersetzbar sein. Das macht, so wird das bekanntlich erklärt, die ihnen sozusagen eingeschmolzene Individualität ihres Schöpfers.
Doch was folgt daraus? Individuelles ist einzelnes. Einzelnes lässt sich jedoch begrifflich nicht völlig erfassen, weil der Begriff – das liegt in seiner Bestimmung – Klassen von Objekten, Eigenschaften und Prozessen abbildet, also verallgemeinert und abstrahiert.
Zwar enthält jedes Konkrete Einzelnes, doch ist es bei vielen Produkten für uns nicht wesentlich. Im Kunstwerk genießen wir immer auch das individuelle Ferment, wollen es darum auch bewertet wissen. Man kann ihm jedoch nur indirekt, dass heißt über seine Projektionen auf unsere Subjektivität (wobei sich noch zusätzlich Einzelnes in Einzelnem bricht!) beikommen. Der Gebrauchswert eines Kunstwerkes erweist sich eben letzten Endes in der konkreten Wirkung eines Ganzen (Werk) auf ein Ganzes (Persönlichkeit). Dass dieser Umstand der Anwendung wissenschaftlicher Methoden in der Kritik Schranken setzt, bedarf sicherlich keiner weiteren Begründung.
Schranken richten sich jedoch bereits viel früher auf. Selbst wenn man Kritiken anstrebte, die nur so wissenschaftlich sein wollen, wie sie es nach Lage der Dinge sein können: Gegenüber derart komplexen Gebilden, wie es Kunstwerke nun einmal sind, wäre der Analyseaufwand enorm. Außerdem gleichen diese einander nicht so wie Waschmaschinen, Autos oder Flugzeuge, da jedes Kunstwerk bis zu einem gewissen Grade sein eigenes Maß hat. Die Möglichkeiten, das Verfahren durch den Rückgriff auf Musteranalysen rationeller zu gestalten, sind dadurch begrenzt. Das alles müsste dann aber auch noch gelesen und wirklich verarbeitet werden. Dazu wären bald kaum mehr jene imstande, die dergleichen verfassten. Die Leser und Schriftsteller wären – schlimm genug – die ersten Opfer, irgendwann würde es aber auch die Fachleute erwischen.
In Naturwissenschaft und Technik stellt sich das Problem längst nicht mit dieser Schärfe. Weil hier das „Publikum“ relativ homogen ist, kann es die „Kritik“ einer Gruppe aus Spezialisten anvertrauen, die mit der Öffentlichkeit nicht im gleichen Maße verbunden sein muss wie die Kunstkritik. Sie kann sich ungehemmt einer künstlichen Sprache und komplizierter Methoden bedienen, ohne auf die Laien Rücksicht nehmen zu müssen. Soll aber die Verständigung über Kunst eine öffentliche Angelegenheit bleiben, ja es noch stärker werden, als das gegenwärtig der Fall ist (und das muss sie), so ergibt sich aus dem Aufwand für den Nachvollzug theoretisch sehr anspruchsvoller Analysen ein Grenzmaß, jenseits dessen die Kommunikation zusammenbräche oder doch wenigstens zu einem elitären Geschäft würde. Die Verkürzung des Arbeitstages, rationellere Methoden der Wuissensaneignung usw. würden daran nichts ändern.
Die Hoffnung, dass es eines Tages möglich sein werde, mittels Analyseprotokollen uneinsichtigen Autoren schlagend zu beweisen, was alles sie falsch gemacht haben, wäre also aus mehreren Gründen eine Illusion. Trotz ihrer Mehrdeutigkeit und geringen Trennschärfe werden die „elastischen Begriffe der natürlichen Sprache“ (Georg Klaus) in der Kritik immer gute Dienste leisten, auch wenn sich Rezensionen in Fachzeitschriften weiterhin etwas anders lesen werden als solche in Tageszeitungen. Und stets wird der Kritiker gezwungen sein, sich seiner Subjektivität zu bedienen, mit allen Risiken, die sich daraus ergeben.
Was folgt aus alldem für die Forderung nach einer Verbesserung der Literaturkritik? Zunächst – ich deutete es schon an – wohl dies: Wir müssen prüfen, ob wir nicht einem Scheinproblem aufsitzen.
So sollten wir in Rechnung stellen, dass die Unzufriedenheit mit der Kritik möglicherweise nichts weiter ist als eine Erscheinungsform unterschiedlicher und dennoch jeweils legitimer Bedürfnisse. Denn wie leicht neigen wir dazu, auch Menschen abzulehnen, ohne daran zu denken, dass ihre Andersartigkeit durchaus eine Bedingung unserer eigenen Existenz sein kann. Wir brauchen unseren Gegensatz und ertragen ihn doch manchmal so schwer – in der Literatur nicht anders als im Leben. Ein „Problem der Kritik“ lässt sich aus dieser menschlichen Schwäche selbstverständlich nicht ableiten.
Des Weiteren wäre es nicht sehr sinnvoll, sich an eher zufälligen Mängeln zu reiben. Der Kritiker kann Empfindungen nachgeben, die wenig mit dem jeweiligen Werk, viel dagegen mit seinem Verfasser zu tun haben, er kann aus einer Stimmung heraus extrem urteilen, unter Formulierungszwang oder Überbelastung oberflächlich bleiben.
Gewiss liegen hier unmittelbare Ursachen für viele schwache Kritiken, doch wohl keine spezifischen. Denn auch in anderen Bereichen gibt es unfähige Prüfer und defekte Prüfgeräte, wird gemogelt und geschlampt. Außerdem ist Subjektives immer ein guter Schirm für Unaufrichtigkeit und Nachlässigkeit. Und solange es nicht möglich ist, die Kritiker von den Autoren zu separieren oder eine Papiersorte herzustellen, die sich gegen den Abdruck von Torheiten sperrt, werden solche Erscheinungen auch nie völlig verschwinden. Die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit ist jedoch in diesem Sinne kein „Problem“, das heißt kein Thema für Erörterungen, sondern eine Tatsache, der man sich ständig und überall stellen muss.
Von einem Problem ließe sich allerdings dann sprechen, wenn es gelänge nachzuweisen, dass die Kritik unter ihren realen Möglichkeiten bleibt. Das ist, wenn Subjektives im Spiel ist, nicht ganz einfach, wiederum auch nicht aussichtslos. Stellen wir uns einen Arzt vor, der seinem farbsinngestörten Patienten gut zuredet, einen beliebigen Gegenstand doch endlich „richtig“ (meinetwegen grün) zu sehen. Das wäre freilich blanker Hohn. Andererseits wäre der Patient schlecht beraten, würde er für diese Eigentümlichkeit seiner Subjektivität die Bezeichnung Defekt zurückweisen, auf ihrer Ebenbürtigkeit bestehen und, falls es sie gibt, Behandlungsmöglichkeiten ausschlagen; nicht deshalb wäre er schlecht beraten, weil er einer Minderheit angehört – das träfe auch für Genies zu –, sondern weil ein differenziertes Farbempfinden erwiesenermaßen vorteilhaft ist. Subjektives sollte sich also nicht nur zu bewahren suchen, es hat sich auch zu bewähren. Und es kann anhand gespeicherter Erfahrungen bewertet werden.
In der Kunst und auch in der Kunstkritik liegen die Dinge natürlich ein bisschen komplizierter. Dennoch: Lassen sich zwar nicht alle Kritiken in gelungene und misslungene unterteilen, so heißt das noch lange nicht, dass man jede als Ausdruck einer eigentümlichen Subjektivität respektieren müsste. Jedes Produkt hat bekanntlich spezifische und unspezifische Gebrauchseigenschaften, die spezifischen machen seinen Wert aus. Ein Hammer etwa kann durch mancherlei Dinge funktionell vertreten werden, beispielsweise durch ein Nudelholz. Normalerweise wird aber niemand auf die Idee kommen, den Wert eines Nudelholzes daran zu messen, dass es sich zum Einschlagen von Nägeln eignet. Genauso besitzen wir mittlerweile einen historisch gewachsenen Schatz von Erfahrungen, was Kunst sehr gut, nur unzulänglich oder gar nicht leisten kann, worin sie ersetzbar und unersetzbar ist. Er ist groß genug, um von einer Kritik sagen zu können, dass sie dem spezifischen Gebrauchswert von Kunst gerecht wird oder nicht.
Geschieht es nun nicht nur ausnahmsweise, dass die Kritik in dieser Hinsicht ihre Aufgabe verfehlt, dann wäre dies wirklich ein Problem. Erscheinungsformen solchen Versagens zu beschreiben und nach jenen Faktoren zu suchen, die es begünstigen, darin besteht das Thema meines Essays.
Ich hätte diese Arbeit vielleicht nicht begonnen, wenn ich glaubte, nur Persönliches beisteuern zu können. Ich schreibe sie auch, weil mir scheint, dass das verfügbare Wissen über die besondere Wirkungsweise von Literatur größer ist als der Grad seiner Nutzung durch viele Kritiker, und dass ein solcher Nachweis, falls er gelingt, eindrucksvoller sein müsste als eine nur musisch getönte Klage. Davon gibt es ja bereits nicht wenige, doch erfahrungsgemäß vermögen sie kaum denjenigen zu rühren, den schon die Kunst kalt lässt. Folglich sollte man es hin und wieder auch andersherum probieren und Theorie druntermischen; nicht ausgeschlossen, dass sich aus einer solchen Legierung wirksamere Argumente herstellen lassen.
Dennoch – dies ist kein Traktat, sondern ein Essay, der sich am Meinungsstreit beteiligen, in ihn einbringen will, wie es treffend heißt. Ich werde Ansichten formulieren, von denen ich fest überzeugt bin, dass sie jeder übernehmen sollte, und zugleich die Vorstellung auszuhalten suchen, dass andere akzeptable Gründe haben könnten, dies nicht zu tun. In jedem Fall werde ich entschiedenen Äußerungen den Vorzug geben und Relativierungen vermeiden.
Im Übrigen sollte der Essay nicht als eine Beschreibung des Zustandes unserer Kritik gelesen werden, sondern als ein Versuch, zu ihrer Verbesserung beizutragen. Durchaus subjektiv ist es, wenn ich behaupte oder unterstelle, dass bestimmte Arten des Herangehens an Literatur besonders häufig seien. Ich habe mich zwar umgesehen, doch nicht ausgezählt. Auch werde ich nicht auf Trends eingehen. Zwar meine ich, dass das Niveau unserer Kritik im letzten Jahrzehnt gestiegen ist; für mindestens ebenso wichtig wie eine solche Feststellung halte ich aber Überlegungen, die geeignet sein könnten, diesen Prozess zu beschleunigen.