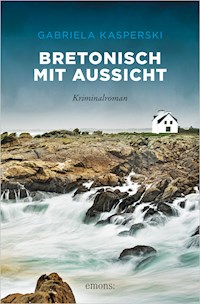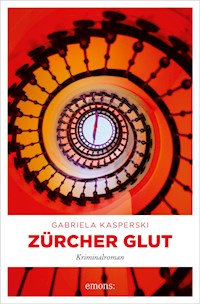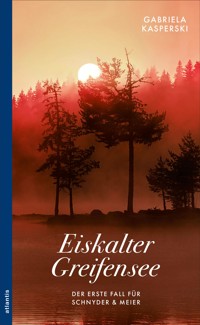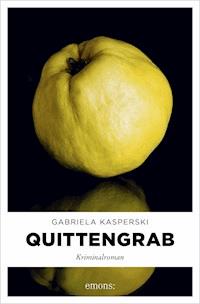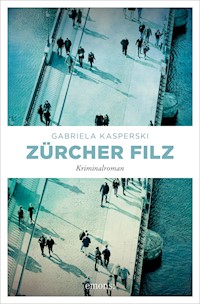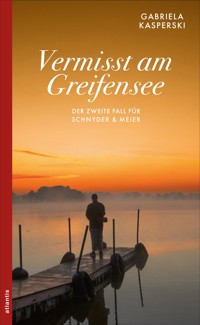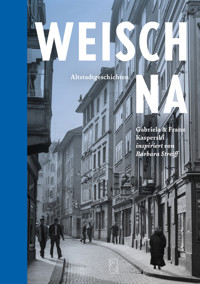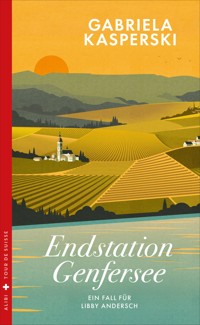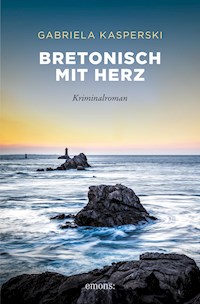
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kriminelles Chaos in der Bretagne In Camaret-sur-Mer organisiert Tereza Berger, Buchhändlerin mit Kampfgeist, ein Literaturfest. Während der Vorbereitungen entdeckt sie in ihrer geerbten Villa das Manuskript eines unbekannten Shakespeare-Stücks. Ist es womöglich ein Original? Die Kunde von dem spektakulären Fund ruft Literaturinteressierte aller Art auf den Plan – und einen geheimnisvollen Fremden, der behauptet, der wahre Besitzer der Villa zu sein. Tereza wird klar, dass nicht nur ihr Zuhause gefährdet ist, sondern auch ihr Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gabriela Kasperski war als Moderatorin im Radio- und TV-Bereich und als Theaterschauspielerin tätig. Heute lebt sie als Autorin mit ihrer Familie in Zürich und ist Dozentin für Synchronisation, Figurenentwicklung und Kreatives Schreiben. Den Sommer verbringt sie seit vielen Jahren in der Bretagne.
www.gabrielakasperski.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: lookphotos/Hemis
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-909-9
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Magdalena
À la mémoire de Gérard
All the world is a stage, and all men and women merely players.
William Shakespeare
Prolog
Der Himmel war blau wie nie. Als Armand Kerouag zum Kapuzenmantel griff und die Treppe hinunterstieg, eilte Magalie zur verborgenen Fensternische, um ihren Mann gerade noch im Garten der »Villa Wunderblau« verschwinden zu sehen, mit diesem Humpeln, das ihn befiel, wenn er außer sich war.
Sie rang die Hände, wusste nicht ein noch aus. Seit sie sich erinnern konnte, hatte Annie, die Nachbarin von gegenüber, unauffällig gelebt, gelegentlich auf der Place Saint-Thomas einen Milchkaffee getrunken und den englischen Touristen am Strand von Lostmarc’h das Wellenreiten beigebracht. Einmal im Monat hatte sie Besuch von einem Mann in Anzug und Krawatte bekommen, vor einem Jahr zum letzten Mal. Danach, so schien es Magalie, hatte sie sich komplett zurückgezogen, sich irgendwo zwischen den Mauern ihrer wunderbaren Villa verkrochen.
Armand hatte ihr mehrere schriftliche Kaufangebote gemacht, es war sein Traum, auf die andere Straßenseite in die Sonne zu ziehen. Darauf war sie nicht eingegangen, keine Reaktion, bis sie letzten Sommer vor die Tür getreten war und einen Atemzug gemacht hatte, so tief, dass Magalie an ihrem Fensterplatz erschauderte. Ab da war Annie wie verwandelt gewesen. Erst hatte sie den abgeblätterten Rahmen um das ehemalige Garagentor blau gestrichen und die Front verglasen lassen. Dann war die junge Südafrikanerin Ayala mit ihrer neu gegründeten Surfschule eingezogen.
»Die stammt aus dem Dschungel. Wenn du nicht aufpasst, frisst sie dich auf.«
Zu so widerlichen Sprüchen hatte sich Armand hinreißen lassen. Den Widerstand gegen das Surfschulprojekt hatte er erst auf legalem Weg versucht. Aber der Bürgermeister war im Dauerurlaub, und seine Vertretung hatte das Anliegen rundweg abgelehnt. »Es ist ein Privatgrundstück. Madame Gisler darf da Hornochsen halten und Surfschulen eröffnen, wenn sie das will.«
»Ich würde gern mitmachen«, hatte Magalie geäußert, als er ihr davon erzählt hatte. Woher sie den Mut nahm, hätte sie nicht sagen können. Die Quittung bekam sie postwendend.
»Was willst du fette Schwalbe surfen?«
Als die Nachbarin Magalie auf das blaue Auge angesprochen hatte, hatte sie ihr die Ausrede nicht geglaubt. Schlimmer noch, sie hatte an die Tür geklopft und Armand zur Rede gestellt.
»Ich werde der Police nationale melden, dass Sie Ihre Frau verprügeln. Gabriel Mahon, der neue Kommissar aus Brest, lässt sich nicht so leicht hinters Licht führen wie sein Vorgänger.«
Daraufhin war Armand ins Brüten verfallen, tagelang hatte er sich nicht gerührt und vor sich hin gestarrt. Bis er eben auf einmal den Stuhl nach hinten geschoben hatte. »Der werde ich es zeigen.«
Je länger Magalie am Fenster wartete, desto übler wurde ihr. Als sie es nicht mehr aushielt, stieg sie die Treppe hinunter, überquerte die menschenleere Straße und betrat den Garten der Villa. Hinter dem rostigen Zaun schlüpfte sie aus den Sandaletten, spürte den Boden, der sich kühl anfühlte. Igelrunde Rhododendren, Hortensien mit Knospen, frühe Kamelien, eine Rosenblüte in zartem Hell – es war, als ob es im wunderblauen Garten nie Winter würde.
An die Hauswand gelehnt standen einige Surfbretter, von einer Leine baumelten Anzüge, einer tropfte, ein Zeichen dafür, dass die Surfschule Fahrt aufnahm, die Wellen waren zu jeder Jahreszeit ein Paradies.
Rechter Hand verlor sich ein Pfad im immergrünen Gebüsch, das sich in Richtung der geheimen Quelle nach oben zum Hügel zog, von Armand und der Nachbarin war nichts zu sehen. Auch nichts zu hören.
Ein Zweig verfing sich in Magalies Bluse. Kehre um, schien er zu sagen, misch dich nicht ein. Aber Magalie machte sich los, strich über ihr verheiltes Auge und ging weiter, tiefer in den Garten hinein, bis sie genau das vorfand, was sie befürchtet hatte.
Armand hatte sich neben der efeuüberwachsenen Hütte aufgebaut, vor sich einen Schaukelstuhl, den Magalie nur von hinten sehen konnte. Darin musste die Nachbarin sitzen, Magalie erkannte ihr eisgraues Haar. Ein Briefumschlag flatterte aus ihrer Hand zu Boden.
»Madame Gisler?«, sagte Armand. »Hallo?« Langsam hob er den Arm.
Nein, wollte Magalie schreien, tu es nicht!
Als ob er sie gehört hätte, gab er dem Stuhl lediglich einen Stoß. Er schaukelte vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, bis der Kopf aus Magalies Sichtfeld verschwand. Ein dumpfer Laut. Und das Geräusch einer kleinen Apothekenflasche, die über den sandigen Boden rollte.
Magalie wollte sich in Bewegung setzen, um der Nachbarin zu helfen, die aus dem Stuhl gekippt und nach vorn auf die Steinplatten geknallt war. Da nahm sie einen Schatten wahr. Eine Gestalt in Kutte und Kapuze schälte sich aus den Büschen. Mit zwei Schritten war sie bei der kleinen Flasche, behandschuhte Finger griffen danach, und eine Stimme erklang, brüchig, etwas verzerrt, geisterhaft.
»Augentropfen. Ohne Verschlusskappe. Ist sie daran erstickt? Bravo, Armand!«
Magalie gefror das Blut in den Adern. Wer war das? Wieso beschuldigte er Armand? Wieso trugen sie fast identische Kutten? Die Stimme hatte immer weitergesprochen, aber erst jetzt drang sie wieder in Magalies Bewusstsein.
»Ich werde es niemandem sagen. Auch nichts davon, dass Sie Madame Gisler seit Monaten belästigen. Keiner erfährt es … Wenn Sie mir dafür einen Gefallen tun.«
»Aber …« Armand kniete sich unter Anstrengungen neben Annie Gisler. »Wir müssen ihr helfen.«
»Tot, die Alte. Da gibt’s nichts mehr zu helfen. Sie haben sie umgebracht.«
»Ich war’s nicht«, sagte Armand.
»Wirklich, mein Lieber? Nachdem Ihre Fingerabdrücke auf den Augentropfen sind.«
Magalie hatte genug gehört. Lautlos drehte sie sich um und floh zurück in ihr Haus, wo sie im Wohnzimmer nach dem Telefon griff, um den Notruf zu wählen. Danach stieg sie die Treppe hinauf, zu ihrem Fensterplatz.
Es war der 18. Februar 2018. Der Himmel war blau wie nie.
1
Drei Jahre später – Camaret-sur-Mer, Dienstag, 13. Juli
»Die ›Villa Wunderblau‹ befindet sich fälschlicherweise in Ihrem Besitz. Sie haben eine Woche Zeit für die Räumung.«
In T-Shirt und Flatterrock stand ich in der Küche neben dem schnarchenden Merguez und las das Schreiben erneut. Mittlerweile verstand ich genügend Amtsfranzösisch, um den Inhalt auf einen Satz hinunterzubrechen: Ein gewisser Jacques Dupont machte mir das Erbe streitig, die »Villa Wunderblau«, meine Heimat im Finistère, au bout du monde, am Ende der Welt.
Ich rief meine Freundin und Anwältin Brigitte in Zürich an. Sie hatte fast immer ein offenes Ohr für mich, selbst zu dieser frühen Morgenstunde.
»Ich kenne keinen Dupont«, sagte ich auf ihr Nachfragen.
»Ich meine den Anwalt, der das Schreiben aufgesetzt hat. Wer ist das?«
Ihr Lachen, nachdem sie den Namen gehört hatte, war beruhigend abschätzig. »Maître Rebetez aus Brest? Ein Winkeladvokat, hast du das schon vergessen, Tereza? Er hat mehrere Verfahren wegen Begünstigung und Interessenkollision am Hals. Ab sofort nimmst du keine Briefe mehr von dem entgegen.«
»Er lag im Briefkasten, genau wie der erste auch.«
»Das wird sich ändern, glaub mir, beim nächsten Mal wird der Postbote klingeln, um dir den Brief als Einschreiben zu übergeben. Wenn er das tut, tauchst du ab. Tereza Berger ist verschwunden.«
»Aber ich veranstalte ein Literaturfestival. In den nächsten fünf Tagen werde ich sehr anwesend sein.«
»Nicht für die Post. Ist die Empfängerin nicht da, gilt das Einschreiben als nicht zugestellt.«
»Gibt es noch andere Möglichkeiten?« Als Hauptorganisatorin des Literaturfestivals »Un goût de Shakespeare – Salon littéraire de Camaret-sur-Mer« war meine Aufgabenliste länger als die Schleppe von Lady Dis Hochzeitskleid. »Könnte ich vielleicht beweisen, dass das Haus mir gehört? Ich hätte eine Besitzurkunde zu bieten. Und den Erbschein, mitsamt der Erwähnung meiner Patentante Annie Gisler.«
»Ich befürchte, da besteht irgendein Problem. Scan alles ein und mail es mir. Danach klebst du den Umschlag wieder zu und schickst den Brief an den Absender zurück mit dem Vermerk: ›Empfängername nicht leserlich‹.«
»Das rätst du mir? Ziemlich unseriös für eine Anwältin.«
Brigitte lachte. »Bei Rebetez muss man das Gesetz phantasievoll auslegen.« Dann legte sie auf.
Beim Hinaufgehen stolperte ich auf der letzten Stufe. Die steile Treppe zum Atlantique, meinem Reich im Dachstock, war immer noch nicht repariert. Dafür fand ich die Besitzurkunde auf Anhieb. Dass mein Name leserlich in der obersten Zeile stand, beruhigte mich nicht wie sonst.
Zurück im Erdgeschoss, ging ich durch die Diele auf die Straße und verharrte vor dem Eingang des angebauten Ladens, der mit windschiefen Buchstaben aus Blech angeschrieben war: »DEJALU«, die einzige deutsch-englisch-französische Buchhandlung am Ende der Welt.
Links und rechts der Eingangstür erstrahlten die Schaufenster: Es gab stapelweise Urlaubslektüre im einen, einige ausgesuchte Bücher im anderen. »Shakespeare verliebt in die Normandie« prangte in gotischen Lettern auf dem ersten, »William, der Nordländer« grellbunt auf dem zweiten, »Shake-Fake« in einfacher Schreibmaschinenschrift auf dem dritten Buch. Sie gruppierten sich um ein handgemaltes Plakat in bretonischem Schwarz-Weiß, darauf das Festlogo, Federkiel mit Triskel, jenes keltische Symbol, das für Erde, Luft und Wasser steht.
Zwei der drei Buchautoren, eine Frau und ein Mann, würden bereits am Nachmittag anreisen, bereit für ihre Workshops – Ateliers, wie man öffentlich ausgeschriebene Kurse hier nannte – und vor allem für den »Kampf der Titanen«. Die Debatte war als Festival-Höhepunkt geplant und würde sich darum drehen, ob es den großen englischen Dichter William Shakespeare gegeben und wo er die »verlorenen Jahre«, eine geheimnisvolle Periode in seinem Leben, verbracht hatte. Alle drei Experten hatten darüber eine andere Meinung, die sich in den Titeln ihrer Werke spiegelte.
Nebst dieser würden einige weitere Veranstaltungen stattfinden, das Herz des Ganzen war meine Villa, die mir dieser Jacques Dupont nun wegnehmen wollte. Hatte er sie noch alle?
Ich betrat den Laden, schlängelte mich durch Bücherkisten, Bücherberge, Bücherstapel bis zum Drucker. Der kaputt war, wie sich gleich darauf herausstellte, mit Scannen war nichts. Also fotografierte ich die Urkunde und schickte sie Brigitte per TextApp. Dabei erschienen im Postfach mehrere ungelesene Nachrichten.
»Wo bleibst du, Tereza, wir warten nur noch auf dich«, lautete die letzte.
Der Malkurs in den Dünen! Vor lauter Hausenteignung hatte ich den völlig vergessen.
Ich hinterließ Sylvie Meerwein, meiner Mitarbeiterin, eine Notiz, füllte Merguez’ Wassernapf, setzte mich ins Auto, eine alte Ente namens DD, die ich wegen des kaputten Verdecks nur noch bei schönem Wetter fahren konnte, und tuckerte durch das schlafende Städtchen.
Wie jedes Mal verlangsamte ich beim Hafen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, das Meer verharrte in tiefster Ebbe, der silberne Bogen der Wasserlinie war mehr zu ahnen, als zu sehen. Absolut kein Wind und keine Wellen in der Bretagne, genauso wie es der Wetterbericht vorausgesagt hatte. Ursprünglich dachte ich, ich hätte mich verhört, dann hielt ich es für einen Witz oder eine Falschnachricht. »Aufgrund eines äußerst seltenen Naturphänomens wird es in der Bretagne an fünf aufeinanderfolgenden Tagen weder Wind noch Wellen geben«, diese Information war von allen Medien in den letzten Tagen herumgereicht worden. Darum drehte sich auch die Morgensendung des Piraten-Radiosenders »Presqu’île Sophie«, den ich nun einschaltete. Die wahre Identität der Moderatorin blieb ein Geheimnis, wenngleich mittlerweile alle wussten, dass es sich dabei um eine Nonne, Sœur Nominoë, handelte.
Gerade machte sie einen öffentlichen Aufruf.
»Weder Wind noch Wellen … Und das in der Bretagne! Gesucht ist die trefflichste Bezeichnung für diese Kuriosität. Die Gewinnerin des Wettbewerbs darf wählen zwischen Reichtum oder Schönheit.«
In meinem Fall wäre das klar. Ich brauchte Geld, für die Croissants, die cafés avec énormément de lait und den Umbau des Gartenhäuschens in ein Studio, das ich als zusätzliche Einnahmequelle vermieten könnte. Denn, was soll ich sagen, über das Jahr mit dem Verkauf von Büchern ein Einkommen zu generieren hatte sich als zäh erwiesen. Mein neu aufgezogenes Geschäft mit antiquarischen Ausgaben aus alten Buchbeständen und Nachlässen reichte gerade für Sylvies Lohn. Außerdem hatte ich die Bauarbeiten vorübergehend eingestellt, nachdem ich im Frühling im Bestand meines Buchladens eine ganze Kiste mit Shakespeare-Raritäten entdeckt hatte. Den Baukredit der Bank zweckentfremdete ich in der Folge für die Lancierung des Literaturfestivals, für das ich seither rund um die Uhr geschuftet hatte. Sogar der Malkurs, zu dem ich unterwegs war, war kein Hobby, er galt der Kontaktknüpfung.
Mit dem Schlusssignet der Sendung kam ich auf dem Parkplatz an, stieg aus und eilte in Richtung Strand. Der Fußweg durch die Dünen war nicht wie sonst von dem Dauerrauschen der Wellen umgeben. »Sandige Stille«, wäre das ein Name für das Phänomen ohne Wind und Wellen?
Bevor ich das Meer erreichte, das sich lichtgrau, beinahe durchsichtig präsentierte, schwenkte ich rechts in die hügelige Dünenlandschaft, wo ich weit in der Ferne die anderen Kursteilnehmenden wie weidende Schafe im Dünengras erblickte. Der Pfad führte durch eine Senke, sie verschwanden aus meinem Blickfeld, dafür tauchte direkt vor mir jemand auf. Eine Gestalt in einer braunen Kutte, das Gesicht wegen der tief in die Stirn gezogenen Kapuze kaum zu sehen.
Als sie näher kam, begann mein Herz zu trommeln. Unweigerlich dachte ich an den Unbekannten, der mich seit zwei Jahren, seit meinem ersten Tag in Camaret-sur-Mer, belästigte. Er kleckerte Farbe auf unsere Schaufenster und beschmierte sie mit Sprüchen wie »Casse-toi du bout du monde«, was »Verpiss dich vom Ende der Welt« hieß. Weder Emil Vanderbrouke von der Gendarmerie der Halbinsel Crozon noch Commissaire Gabriel Mahon von der Police nationale hatten bislang herausgefunden, wer dahintersteckte. Obwohl der ursprünglich Verdächtige, der alte Armand Kerouag, Anführer der konservativen Groupe des Anciens, seit einiger Zeit verschwunden war, hatte es weitere Schmierereien gegeben. Der Unbekannte war zum Schatten geworden, der immer dann zuschlug, wenn man ihn vergaß. In meinen Alpträumen passierte eine Begegnung mit ihm umrahmt von tosenden Wellen und Windstärke zehn. Jetzt war es einfach nur still.
Die Gestalt stand nun so nah, dass ich den Stoff des Kapuzenmantels erkennen konnte, dunkelbraunes, grob gewobenes Tuch, zwei Schlitze für die Augen, ein Loch für den Mund.
»Sind Sie Jacques Dupont? Stecken Sie hinter dem Schreiben, das ich heute bekommen habe? Ist es das, was Sie wollen, mein Haus? Aber es gehört mir, ich habe die Urkunde …«
Ich verstummte, weil die Gestalt die Hand hob, schloss die Augen, zählte bis zehn. Machte die Augen wieder auf. Ich war nicht tot, und sie war weg.
Aus meiner Erstarrung erwachend, rannte ich vorwärts, bis ich außer Atem bei den anderen ankam. Flix Fleurongenu, die Mallehrerin, begrüßte mich. Sie hatte praktisches Haar, praktische Kleidung und wirkte jünger als ihre gut sechzig Jahre. Am Vormittag unterrichtete sie Malen, nachmittags bot sie touristische Spaziergänge mit ihren Ponys an.
»Ist vielleicht jemand vorbeigekommen?«, fragte ich sie. »Ein Wanderer in einem Kapuzenmantel?«
Als sie den verneinte, wandte ich mich auch an die anderen Teilnehmenden. »Habt ihr etwas gesehen?«
Blicke, eine kleine Diskussion. Nein, niemand sei hier vorbeigekommen.
Flix kraulte meine Schultern, als wäre ich ein Pferd. »Beruhig dich, bestimmt hat dich die Sonne geblendet. Es ist sehr heiß, eine Begleiterscheinung des windlosen Phänomens.«
Konnte das sein? Aber die Gestalt war so echt gewesen, die bedrohlichen Augen, der im Sonnenlicht aufblitzende Siegelring mit dem besonderen Symbol.
Wohl um mich abzulenken, stellte Flix den Klappstuhl und meine Leinwand neben die von Henry Beaumont, dem einzigen Mann in der Gruppe, stets in zerknittertes Leinen gekleidet, mindestens so attraktiv wie Andy García in »Mamma Mia Zwei«. Man munkelte, er sei ein englischer Adliger. Seine Leidenschaft für Malerei und Shakespeare entzückte mich normalerweise so sehr wie sein Lächeln.
Nun jedoch erwiderte ich seine Begrüßung einsilbig, nahm nur am Rande wahr, dass er eine Sonnenbrille zum Strohhut trug, und wandte mich unserem Motiv zu, einem gelben Ginsterklecks neben einer einsamen Piniengruppe.
Als ich den Bleistift ansetzte, rutschte ich ab, die Spitze brach, gleichzeitig summte eine Textnachricht.
»Wir hatten einen Einbruch«, schrieb Sylvie. »Jemand hat sämtliche Shakespeare-Ausgaben aus dem Regal und von den Tischen genommen. Hast du das nicht bemerkt?«
WAS?
Schon kam der nächste Text. »Besonders bizarr daran: Er hat die Bücher abgewischt und ganz ordentlich wieder zurückgestellt. Der ganze Staub ist weg. Außerdem hat er den Drucker demoliert und eine Schaufensterscheibe eingeschmissen.«
Das war ein Schock. Es musste passiert sein, nachdem ich weggefahren war. Bis auf den Drucker. »Wurde etwas geklaut?«
»Alles noch da, wie es aussieht. Ich ahne, wer dahintersteckt, Tereza.«
Ich auch, dachte ich und fühlte mich grimmig.
»Der Fensterschmierant ist offensichtlich wiederauferstanden. Zum blödesten Zeitpunkt. Ich habe Emil angerufen, er kommt später vorbei.«
Emil Vanderbrouke hatte in den drei Monaten der Sommersaison so viel zu tun wie im ganzen Rest des Jahres nicht mehr.
»Mach Fotos, und dann öffnest du den Laden trotzdem. Bitte Isidore, die Scheibe notdürftig zu reparieren.«
Ich steckte das Handy weg und fluchte leise vor mich hin. »So ein Mist. Merde alors.«
»Sie sollten das bleiben lassen.« Henrys Hand berührte meine.
»Sie meinen das Zeichnen? Schreckliches Bild, ich weiß. Ich bin keine Malerin.«
Neben der kümmerlichen Pinie auf meiner Leinwand nahm das liegen gebliebene Klopapier eines Touristen zweifellos ungebührlich viel Platz ein.
Nun klingelte mein Handy. Schon wieder Sylvie. Diesmal mit Stimme.
»Noch ein Einbruch?«, fragte ich.
»Schlimmer. Zwei der Literaturexperten sind gerade eingetroffen und wollen ihre Zimmer beziehen.«
»Merde, merde, merde.« Ich hatte sie auf Nachmittag bestellt.
»Das meine ich«, sagte Henry lächelnd, als ich aufgelegt hatte. »Das ›merde‹. Sie sagen es allzu oft. Mit Verlaub, es klingt doch eher ordinär. Einer Buchhändlerin nicht würdig.«
Ich war irritiert. »Aber das Wort gehörte zum Wortschatz meiner Mutter, ich habe es sozusagen geerbt.«
»Ist sie die Schwester von Annie Gisler?« Henry kannte die Geschichte um meine Patentante und die »Villa Wunderblau«, ich hatte sie ihm beim Malen erzählt.
»Nein, die Verhältnisse sind kompliziert, Annie und meine Mutter sind nicht blutsverwandt. Trotzdem war Französisch ihre Lieblingssprache, dauernd hat sie irgendwelche Worte einfließen lassen.«
»Dann ist ›merde‹ umso erstaunlicher.«
Na toll. Da fluchte ich seit Jahren wie ein Bierkutscher.
»Tut mir schrecklich leid.«
Henrys Bart kringelte sich. »Es klingt durchaus originell. Wer Sie allerdings nicht kennt, der könnte ›merde‹ als –«
»Sie sagten es bereits«, unterbrach ich ihn.
»Als Alternative könnte ich ›mince‹ empfehlen. Mince alors.«
Ich bedankte mich. Guter Tipp.
»Und wieso mussten Sie so schimpfen?«
Nachdem ich ihm von dem Vorfall im »DEJALU« erzählt hatte, reagierte er unerwartet.
»Bücher wurden verschoben, aber nicht gestohlen?« Er rückte auf seinem Edel-Campingstuhl herum, zog das Leinenhemd über dem Bauchansatz zurecht. »Ich denke, das könnte durchaus plausibel sein. Haben Sie schon mal von einem unbekannten Shakespeare-Manuskript gehört?«
»Da sind Sie bei mir richtig«, sagte ich. »Das ›DEJALU‹ quillt über von vergriffenen Schriften, von seltenen Ausgaben, von antiquarischen Perlen. Meine Trouvaille ist ein Buch über Shakespeares ›lost years‹.«
Bei den verlorenen Jahren von William Shakespeare ging es um die Zeitspanne von 1585 bis 1592. Sieben Jahre, über die es weder Dokumente noch Überlieferungen gab. Niemand hatte wirklich eine Ahnung, wo er sich in der Zeit aufgehalten hatte.
Ich scrollte durch meine Fotos und zeigte Henry ein Bild des verzierten Einbands. Dabei berührte mein Zeigefinger den seinen.
»Sie sind eine echte Bücherdetektivin, wenn ich das so sagen darf. Aber das meine ich nicht. Es geht um ein unbekanntes Theaterstück.«
»Wie?« Ich verstand nicht.
»Ein original Shakespeare-Stück. Von dem nur ganz wenige Menschen Kenntnis haben.«
Er wirkte so konspirativ, dass ich mir das Lachen verkniff. »Sie meinen also ein nicht veröffentlichtes Stück, das während Jahrhunderten in einer Schublade lag und nun auftaucht? Entschuldigung, das ist unmöglich, alles von Shakespeare wurde entdeckt.«
»Darüber würde ich eben gern mit Ihnen diskutieren.«
»Kommen Sie zur Eröffnung übermorgen. Es gibt noch jede Menge Tickets.«
Zu sagen, dass der Vorverkauf dümpelte, war eine Untertreibung. Im Moment bedankten wir uns bei jedem Ticketkäufer persönlich.
»Selbstredend. Aber ich wollte zusätzlich ein Rendezvous vorschlagen.«
»Leider werde ich ab Morgen überbeschäftigt sein, dreiundzwanzig Stunden am Tag.«
»Wie wär’s mit heute? Bei mir im Hotel?«
Oh mein Gott. Er wollte ein Date mit mir.
»Mince«, sagte ich.
2
Über die Landstraße fuhr ich nach Camaret-sur-Mer zurück und verspeiste vor Aufregung eine halbe Tafel bretonische Milchschokolade mit fleur de sel aus dem Notvorrat in meiner Boule-rouge-Tasche. Wie lange war es her seit meinem letzten Date? In den Jahren nach der Scheidung hatte ich vor allem meine Wunden geleckt. Wut, Trauer, Verzweiflung, dieses Hamsterrad hatte ich endlos abgespult, bis ich in die Bretagne gekommen war. Beim ersten Versuch, erneut aufs Liebeskarussell zu springen, war ich gleich wieder hinuntergeschleudert worden. Danach hatte sich lediglich ein Kinobesuch mit Isidore Breonnec ergeben, meinem Handwerker fürs Grobe, der immer dann zur Stelle war, wenn ich ihn brauchte.
Und dann gab es noch Gabriel Mahon, den Commissaire der Police nationale. Unsere Beziehung war so zwiespältig, dass mich seine Abwesenheit nicht kaltließ.
Als ich bei der Erinnerung an unsere letzte Begegnung aufs Gas drückte, kam mir unvermittelt ein Wagen entgegen, fuhr stur in der Mitte, wich kein Jota aus. Ich trat voll auf die Bremse, schlitterte über Rollsplit, der Motor würgte ab, einen Millimeter weiter, und ich wäre im Wassergraben gelandet. Während das metallfarbene Auto an mir vorbeirauschte, ertönte ein aggressives Hupen.
»Idiot!«, schrie ich.
Das Telefon summte. Die hundertfünfzigste Nachricht von Sylvie, diesmal in Form einer Sprachnachricht.
»Komm heim, Tereza. Im ›DEJALU‹ ist das Chaos ausgebrochen.«
***
Quer über die Schaufensterscheibe zog sich ein Riss, in der Mitte prangte ein Loch, zwischen den drei Büchern glitzerten die Scherben.
»Saludo.« Isidores tiefer Bass hatte wie immer eine beruhigende Wirkung, er war gerade dabei, transparente Folie aus seinem Mopedanhänger zu holen.
»Elende Vandalen, das ist eine Art Terroranschlag und somit ein Staatsverbrechen.« Er rückte sein Käppi zurecht. »Du musst Mahon informieren, Tereza.«
»Er ist in Schottland im Urlaub.«
»Nicht mehr. Gestern angekommen, ab heute im Amt.«
»Dann kann ich mich ja warm anziehen. Wahrscheinlich denkt er, ich hätte den Pflasterstein selbst geworfen. Damit er die Suche nach dem Kapuzenmann wieder aufnimmt.«
»Hör auf zu unken. Mahon ist ein guter Commissaire. Er wird das Geheimnis um deinen Widersacher lösen. Und ich helfe ihm dabei. Mir reicht’s nämlich.«
Isidore schob die Elektrozigarette in den anderen Mundwinkel und maß das Loch mit den Augen, um anschließend die Folie zuzuschneiden. »Ein Provisorium. Die Scheibe können sie erst am Montag liefern«, erklärte er.
»Aber dann ist alles vorbei.« Und ich bin enteignet, dachte ich und schluckte.
Der Drohbrief, der Angriff, die Scherben … nicht gerade der Beginn eines wunderbaren Festivals.
»Was ärgerst du dich, chérie? Wir machen daraus, wie nennst du das immer?« Isidore lächelte mir aufmunternd zu. »Ein Win-win. Gagnant-gagnant. Über das kaputte Fenster hängt ihr einfach das Werbebanner, das ist kein Problem, bis Samstag wird es weder regnen noch stürmen.«
Zehn Minuten später war die Welt gekittet. Das offizielle Festivalbanner, in nächtelanger Handarbeit von meinen Freundinnen, den Femmes de Camaret, genäht, verdeckte das Loch in der Fensterscheibe.
Isidore legte einen Arm und mich und betrachtete sein Werk. »Sieht doch aus, als ob es so geplant gewesen wäre.«
Plötzlich ertönte ein Knall.
»Unmöglich kann ich neben dieser Hobby-Expertin nächtigen«, donnerte eine männliche Stimme aus dem Hausinneren. »Eine Zumutung! Eine Beleidigung! Ich gehe ins Hotel, Madame Sylvie! Adieu!«
Der Mann in Knickerbockern und einer Anzugjacke aus englischem Tweed, bei dessen bloßem Anblick mir der Schweiß ausbrach, kam so unvermittelt zur Tür heraus, dass wir zusammenprallten.
»Sie müssen die Köchin sein. Bringen Sie mein Gepäck zum Grandhotel.«
Hinter dem Mann trat Sylvie auf die Straße, ihr T-Shirt trug wie meins die Aufschrift »DEJALU«, sie hatte eine Reisetasche umgehängt und zog zwei Koffer.
»Wie bereits erwähnt, Monsieur Millier. Das Dorf ist ausgebucht. Außerdem gibt’s in Camaret kein Grandhotel.«
Das klang genervt, und dabei hatte Sylvie normalerweise eine Engelsgeduld mit störrischen Kunden.
»Jedes Loch ist besser als das Zimmer hier. Nom de Dieu!«, zeterte der Mann weiter.
Mittlerweile hatte Sylvie mich erspäht. »Es ist Carrick Millier«, flüsterte sie, als sie neben mir stand. »Ich habe dich gewarnt. Gleich reißt mein Geduldsfaden, ich garantiere für nichts. Dein Kunde, Tereza.«
Sie war dagegen gewesen, Carrick Millier zu engagieren, obwohl er als einer der namhaftesten Shakespeare-Experten Europas galt und außerdem Bretone war. Ein Snob, fand Sylvie, ein Glücksfall, fand ich, als mir Henry Beaumont vor einigen Monaten den Kontakt vermittelt und Millier in der Folge sogar zugesagt hatte.
»Findet er das Turquoise zu popelig?«, flüsterte ich zurück. Dabei gehörte das Zimmer mit seiner türkisgrün schillernden Tapete, in dem die seidene Bettwäsche nach Meersalz roch, zu unseren Prunkstücken, außerdem war es bestückt mit den seltensten Ausgaben von Shakespeares »Sommernachtstraum«. Offenbar war es nicht gut genug.
»Dann trete ich ihm das Atlantique ab«, ergänzte ich.
In der »Villa Wunderblau« hatten alle renovierten Zimmer Namen, unser jüngstes Goldstück war das Armorique im zweiten Stock, eben erst fertig geworden, ein Traum in Apricot und Pulverblau. Im Gegensatz dazu stand das Dachzimmer, mein Reich, das Atlantique, ziemlich karg ausgestattet, dafür als Einziges mit Meerblick. Trotzdem schlief ich meist auf dem Klappbett in dem kleinen Kabuff direkt neben der Buchhandlung. Nur jetzt gerade nicht, weil es zu stickig war, darum die Hängematte im Garten.
»Wir sollten ihn im Hotel einquartieren.« Sylvies Flüstern wurde zum Zischen. »Es gibt ein weiteres Problem. Er denkt, dass sein Workshop ausgebucht ist. Dabei kommt kein Mensch. Beim Eröffnungsfest sieht es nicht viel besser aus. Wir haben zu wenig Werbung gemacht, wir Idiotinnen. Magalie hätte längst neue Flyer liefern sollen.«
Magalie gehörte zu den Frauen von Camaret, sie war Barfrau im »La Coquille«, einer Bar-Tabac an der Mole, und Armand Kerouags Strohwitwe. Mehrfach hatte ich sie in der Vergangenheit mit einem blauen Auge gesehen, ihre Erklärungen waren so phantasievoll wie hilflos gewesen. Nach seinem Verschwinden war sie allmählich aufgeblüht, aufgewacht aus einem Alptraum, so kam es mir vor. Sie traute sich sogar, den Job der Marketingfrau für unser Festival zu übernehmen, und hatte einen Flyer kreiert. Auf dessen Nachlieferung warteten wir allerdings seit Tagen vergeblich.
»Irgendetwas ist da schiefgegangen, ich schreibe ihr gleich.«
»Tu das. Sie soll nachdrucken und die Halbinsel mit Flyern überschwemmen.« Vor sich hin schimpfend, verschwand Sylvie wieder im Laden, während ich mich Carrick Millier zuwandte, der sein Gepäck sortierte.
»Monsieur Millier, herzlich willkommen. Tut mir sehr leid, dass das Turquoise nicht nach Ihrem Geschmack ist. Aber Sie müssen verstehen, Camaret ist nur ein kleines Dorf, es ist Hochsaison und …«
Er unterbrach mich. »Mir egal. Ich wohne nicht in einem Zimmer neben dieser Pimperlise.«
»Meinen Sie mich?«
Eine zweite Person trat auf die Straße. Sie war zierlich, trug orangefarbene Latzhosen, ein gepunktetes Shirt und Wanderschuhe, hatte kupferrote Zöpfe und eine Zahnspange. Konnte das Elinor Fettiplace sein, unsere Expertin aus Britannien, ein literarisches Schwergewicht?
Als sie Millier erblickte, fiel sie gespielt in Ohnmacht. »Sieh, wer da steht. Ein Geist.«
»Falsch zitiert, Fettiplace.« Millier schäumte. »Madame Berger! Rufen Sie ein Taxi.«
Elinor Fettiplace stellte sich ihm in den Weg. »Pimperlise ist beleidigend, unterstellend, üble Nachrede. Ein Straftatbestand.« Sie blinzelte mir zu. »Sie sind meine Zeugin.«
Ich versuchte, die Wogen zu glätten. »Ich denke, Monsieur Millier meinte nicht Pimperlise, das Wort existiert gar nicht, sondern das französische Chanson ›Für Elise‹. Dass Sie aussehen wie Elise.«
Der Versuch war so kläglich, dass Millier selbst mich korrigierte. »Natürlich gibt es das Wort. Liederliche Lise, genau das habe ich gemeint.«
»Quatschen Sie nur weiter.« Fettiplace holte ihr Handy heraus. »Ich habe alles aufgezeichnet. Gleich kommt’s auf Instagram. Hashtag Millierbelästigt.«
Social Media war Millier egal. »Meine Zunge wird die Wut meines Herzens erzählen …«
»Sie schmeißen mit Zitaten um sich? Der Widerspenstigen Zähmung, hab ich recht?« Sie tippte auf das Display. »Da. Der Post hat bereits zehn Likes. Die verdoppeln sich sekündlich. Nur um es zu sagen, ich habe 5K Follower.«
»Fünf? Ich bin beeindruckt.« Zynismus triefte aus Milliers Stimme. »Meine handgeschriebenen Newsletter erreichen Hunderte.«
»Ich spreche von Tausenden, Sie Frosch. Und wenn Sie nicht sofort das Maul halten, poste ich, wie unerträglich versnobt Sie sich benehmen.«
Mit seinen aufgeblasenen Wangen sah Millier tatsächlich ein wenig aus wie ein Giftfrosch. Bevor er platzte, stellte ich richtig, dass ich nicht die Köchin, sondern die Chefin war.
»Wir würden Sie ausgesprochen gern hier im Ort haben, Monsieur Millier. Der Presse haben wir das bereits so mitgeteilt, eine Konferenz ist für morgen angesetzt …«, ich machte eine geistige Notiz, Vivienne Danieau zu informieren, eine junge Bekannte, die gerade ein Praktikum bei der neuen Onlinezeitung »Breizh News« machte, »… und wir disponieren um. Sie kriegen das Atlantique, die Dachsuite.«
Er musterte mich. »Das heißt, ich muss das Bad nicht mit dieser …«
»Aufgepasst!«, warnte Fettiplace und drückte erneut den Aufnahmeknopf.
»… mit der da teilen?« Millier war etwas zahmer geworden.
Ich nickte und sah zu der jungen Frau. »Und Sie sind also Elinor Fettiplace?«
»Du darfst gern Du sagen.« Sie grinste mich an. »Ich weiß, man erwartet anderes.«
Sie war wirklich eine Erscheinung, kein Wunder, dass Millier sich provoziert fühlte. Rivalisierende Poeten, dachte ich, »the Rival Poets«, ein Shakespeare-Motiv, das oft in seinen Schriften anzutreffen war.
Ich packte Milliers Koffer. »Ein herzliches Willkommen also Ihnen beiden. Ein missglückter Start ist der Auftakt für eine lange Freundschaft. Altes bretonisches Sprichwort.«
3
»Wie lautet der Dresscode im Grandhotel?«, fragte ich Sylvie einige Stunden später.
»Du meinst, weil ich da Stammgast bin? Der Kasten heißt zwar so, aber die Zimmer sind auch nicht schöner als bei dir. Geh, wie du bist«, sagte sie, damit beschäftigt, einer Horde deutscher Touristinnen Strandkrimis herauszusuchen, während die aufgestellten Miniventilatoren daran scheiterten, die Luft im Laden abzukühlen.
»Sylvie, es ist mein erstes Rendezvous seit Severin!«
»Sei nicht hysterisch. Eines deiner Strandkleidchen passt prima.«
»Die haben Löcher und sind ungewaschen.«
»Dann leih dir was von mir.«
Sylvie war doppelt so groß wie ich. Ich packte die antiquarische Normandie-Ausgabe, die ich Henry versprochen hatte, und stieg in den zweiten Stock, in Tante Annies altes Schlafzimmer, als einziges noch unrenoviert. Mit der »Villa Wunderblau« hatte sie mir so allerlei hinterlassen. Nebst einem Bett mit Baldachin und einer altmodischen Nähmaschine, einer Truhe voller Fotos und Gegenstände sowie einem Brief, den ich bis heute nicht geöffnet hatte, auch einen Schrank voller Mäntel, Hosen und Blusen. Sie waren praktisch, rochen nach Kampfer und gepressten Veilchen, Vintage, wie meine Tochter Lovis es nennen würde.
In dem einzigen Kleid, das ich fand und anprobierte, sah ich aus wie eine verschrumpelte Kartoffel. Dann doch lieber mein Flatterlook im Shabby Chic.
Ein letzter Blick unter den marineblauen Regenmantel, wo tatsächlich ein weiteres Kleid hing. Was soll ich sagen, es entpuppte sich als Trouvaille, fast so aufregend wie eine antiquarische Schrift. Es fühlte sich schwer an, fließend, mit einem schwingenden Rock, Dekolleté, einer breiten Schärpe, einer verspielten Halbmaske samt Fächer. Was die Kreation einzigartig machte, war die Farbe. Schillernd in allen Varianten von Gelb, Grün und Schwarz. Es saß etwas eng, aber wenn ich den Bauch einzog und den Atem anhielt, würde es gehen, zumal die Schärpe kaschierte und mich die dazugehörigen Schuhe in den Olymp der Großgewachsenen hoben. Zur Komplementierung hängte ich mir Mondsteinohrringe an, die Augen umrandete ich schwarz, die Lippen dunkelrot, die Haare steckte ich hoch – von einer überarbeiteten Buchhändlerin hatte ich mich in eine geheimnisvolle Fremde verwandelt, das sagte mir der Spiegel, der etwas versteckt hinter der Tür hing.
Ich machte eine Drehung, werweißte, ob das Knistern eingebildet oder real war. Hatte sich Tante Annie auch so gefühlt, wenn sie das Kleid trug? Hatte sie es überhaupt je getragen?
The Dark Lady, dachte ich. Die Frau in Schwarz trifft den verarmten Adligen, auch das ein Shakespeare-Motiv.
In Ermangelung von etwas Besserem packte ich die antiquarische Rarität in Kinderweihnachtspapier, steckte sie in meine Boule-rouge-Tasche, eilte lautlos die Treppe hinunter und entschwand durch Garten und Hinterausgang.
***
»Chante la vie chante«, dudelte der Song von meiner Playlist. Die Hitze flirrte, auf dem Weg nach Morgat war Stau, Bauer Francis machte mit dem Verkauf von überreifen Pfirsichen am Straßenrand das Geschäft seines Lebens. Ich duckte mich hinters Steuer, nicht nötig, dass er mich erkannte, bevor ich bei der neu eröffneten Biobäckerei anhielt, um einen gâteau breton mit Pflaumen zu kaufen.
Gerade als sich nach der Weiterfahrt ein metallfarbener Wagen vor mich quetschte und ich mich fragte, ob es der Verrückte vom Vormittag war, wechselte meine Musik auf den Song »Caruso« von Lucio Dalla. Ich stoppte nur Bruchteile von Millimetern vor der Stoßstange des Vordermannes. Mince! Wie war diese Musik auf meiner Playlist gelandet? Ich warf einen Blick aufs Display, bemerkte, dass es von einer Person ohne Profilbild hochgeladen worden war, der Username war John Doe.
»Kann man fremde Playlists entern?«, textete ich an meinen Sohn Kai, der bei uns für alle IT-Sachen zuständig war. Er lebte in Berlin, im Sommer neuerdings auf Crozon.
»Wenn du das entsprechende Häkchen falsch gesetzt hast …«, schrieb er lapidar zurück. Dazu hängte er ein Foto an, Ayala und Mathilde, meine Fast-Enkelin, zu dritt waren sie unterwegs in die Bretagne. »Ich helf dir morgen dabei. Gleich wenn wir angekommen sind.«
Ich löschte den Song und fuhr weiter bis zum Grandhotel, wo der Parkplatz voll besetzt war, was mich zwang, ziemlich weit ins Quartier auszuweichen, um DD abzustellen. Als ich nach längerem Marsch wieder beim Hotel eintraf, hatte ich Blasen an den Füßen, der Lippenstift schmeckte ranzig, und meine Stirn glänzte wie eine Speckschwarte. In Gedanken bedankte ich mich bei Tante Annie für die Halbmaske, die ich mir nun übers Gesicht schob. Ein Blick in den Taschenspiegel: The Dark Lady war bereit für ihren Auftritt.
Die großzügige Hotellobby entpuppte sich als eine andere Welt. Gekühlt von einem Deckenventilator, mit einer breiten verglasten Front, die Ausblick auf die Bucht von Morgat bot, wo sich das Meer gesäumt von den felsigen Klippen, dem schimmernden Sandstrand und den bunten Häusern der Hafenzeile in gleißender Weite verlor.
Der Concierge zuckte bei meinem Anblick mit keiner Wimper, er schien über meine Ankunft informiert. »Zimmer 413. Da vorn ist der Aufzug. Gute Malstunde, Madame!«
Wie peinlich. Bestimmt traf Henry jeden Abend eine andere aus dem Kurs.
Beim Lift erwartete mich ein livrierter Boy, auch er wusste, wohin ich wollte.
»Vierter Stock«, sagte er und zeigte auf mein Kleid. »Besondere Farbe. Sieht aus wie das Meer im Sturm, nur dass es im Moment ohne Sturm ist.«
Ein verkappter Poet, dachte ich, zog das Handy raus und schrieb an »Presqu’île Sophie«. »›Meer ohne Sturm‹, ein Name für das windlose Phänomen.«
Der Lift rumpelte unerwartet laut, Türen glitten auseinander, der Boy zeigte nach links und wünschte mir einen wundervollen Abend. Meinte er das ironisch?
Im spiegelnden Schein einer Glastür kam mir die Maske plötzlich lächerlich vor. Ich nahm sie ab, stopfte sie zurück in die Boule-rouge, war drauf und dran, durch den Notausgang ins Treppenhaus zu verschwinden, als sich vor mir eine Tür öffnete. Henry, im weißen Hemd, dazu Shorts und Flipflops, mitten in einem Telefonat.
»Mein Bruder«, formten seine Lippen, während er mir ein Glas Champagner in die Hand drückte und mir bedeutete, ihm zu folgen, um gleich darauf den Kuchenkarton achtlos auf den Tisch zu stellen und mich in Richtung Balkon zu schieben, an Stapeln mit Büchern und einer halb offenen Tür vorbei, die den Blick auf ein großzügiges Bett zuließ, die Laken aufgeschlagen, mit einem Strohhut darauf.
»Gehen Sie schon mal raus«, sagte er leise. »Es dauert nicht lang.« Eine kleine Verbeugung, bevor er die Flügeltür hinter sich zuzog.
Da stand ich nun und leerte das ganze Glas in einem Zug. Schlechte Idee, bei vierunddreißig Grad, ohne Mittagessen. Darum hielt ich mich am Geländer fest, sah zu den vielen Menschen am Strand einige Stockwerke unter mir, hörte Gesprächsfetzen, Lachen, Kreischen.
Gerade war ich dabei, mich von dieser besonderen Stimmung einlullen zu lassen, als ich etwa hundert Meter entfernt, da, wo sich die Felsen nach oben zogen, die Kapuzengestalt zu bemerken glaubte, kaum zu unterscheiden vom Gestein. Verfolgte sie mich?
»Mince«, sagte ich laut.
»Sehr schön, Sie haben gelernt.«
Ich zuckte zusammen. Henry war lautlos hinter mir aufgetaucht.
»Pardon, eigentlich fluche ich selten.« Noch ein Blick, die Gestalt war weg. Die Hitze, ich hatte sie mir eingebildet.
»Leben Sie immer im Hotel?«, fragte ich und wandte mich Henry zu.
Er schien aufgebracht, das Telefonat musste der Grund sein. »Wieso meinen Sie?«
Ich zeigte um mich. »Es sieht nicht gerade billig aus.«
»Ein Appartement wäre preisgünstiger, da haben Sie recht. Aber ich bin nicht so praktisch. Das Kochen ist ein Problem. Sonst besorgt das meine Frau.«
Seine Frau? Du hast die Zeichen völlig falsch interpretiert, Tereza, du dumme Nuss.
»So jemand hätte ich auch gern«, sagte ich leicht. »Ich kann nicht kochen.«
»Trotzdem müssen Sie essen.« Er hob eine Metallhaube vom Bistrotisch, womit ein Schälchen sel de Guérande zum Vorschein kam, bretonische Butter, aufgeknackter Hummer, dazu eine Sauce, deren Knoblauchduft sich mit Henrys Eau de Toilette vermischte. Es sah appetitlich aus.
Er streute ein wenig Salz auf ein Stück Fleisch, tauchte es in die Sauce und wollte es mir in den Mund schieben. »Eine rouille bretonne. Mit extra viel Knoblauch.« Er grinste, der Anblick des Essens hatte ihn offenbar entspannt. »So stinken wir beide.«
Ich gab nach. War er halt verheiratet …
Wir setzten uns auf die Bistrostühle, fielen über den Hummer her, tunkten die Sauce mit Baguette auf, tranken Champagner, sahen der Sonne beim Sinken zu, während ich ihm alle Aktivitäten des Literaturfestivals aufzählte und mein Mitbringsel, die antiquarische Shakespeare-Ausgabe, aus der Boule-rouge nestelte.
Er verbiss sich einen Kommentar zum Einwickelpapier und warf einen flüchtigen Blick auf den Buchdeckel, der Shakespeare beim Flanieren in Honfleur zeigte.
»Das habe ich bereits. Meine Ausgabe ist sogar noch älter als diese hier.« Er spürte wohl meine Enttäuschung und versuchte, mich zu trösten. »Shakespeare ist wie mein großer Bruder. Ich besitze alles von ihm.« Er zog sein Handy hervor, zeigte mir eine Liste von universitären Arbeiten. »Verschiedene Abhandlungen zu seinen Stücken«, erklärte er und zerknüllte das Einwickelpapier. »Wieso lieben Sie eigentlich Shakespeare, Tereza?«
Ich schluckte. »Er hat mich durch die schlimmste Zeit meines Lebens begleitet, Trennung, Scheidung, Wiederaufbau.«
»Ablenkung?«
»Eher Identifikation.«
»Darum auch das Festival.« Aus dem Papier war ein kompakter kleiner Ball geworden. »Sie sind eine mutige Frau.«
Ich wurde dunkelrot. »Na ja, es ist natürlich ein unternehmerisches Risiko, so ein Festival.«
»Ich meine, den Bretonen Shakespeare vorzusetzen. Wenn es sich um Merlin, Gilles de Rais oder Tristan und Isolde drehen würde … aber Shakespeare?«
Diese Frage hatte mir auch Sylvie gestellt. »Wieso nicht keltische Legenden? Dann würde das Publikum strömen.«
Ich war stur geblieben. »Bei Shakespeare ist alles drin. Verrat, Liebe, Hass, Treue, Freiheit, Sex. Und Herz. Der alte William hatte sehr viel Ahnung vom Leben. Das will ich den Leuten in Camaret-sur-Mer zeigen …«
»Tereza?« Neugierig sah Henry mich an. »Wieso sind Sie verstummt? Ein Penny für Ihre Gedanken.«
Ich wechselte das Thema. »Man munkelt, Sie seien ein verarmter Adliger.«
Einmal mehr wich er einer direkten Antwort aus. »Der Malkurs entpuppt sich als Gerüchteküche … Flix hat mir davon erzählt.« Wie leicht ihm der Name unserer Mallehrerin von den Lippen ging.
»Woher kennen Sie Flix eigentlich?«
»Keine Ahnung, sie ist eine alte Familienfreundin. Trimède, das Apfelschimmel-Pony in ihrem Stall, gehört mir. Einmal pro Woche reiten wir zusammen aus.«
»Und wovon leben Sie?«
Er zwinkerte. »Sie meinen, wenn ich nicht reite, nicht male, keine literarischen Abhandlungen schreibe? Ich habe das Glück, oder das Pech, je nachdem, wie man es betrachtet, dass ich nichts weiter tun muss, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen.«
»Die Last der Reichen.«
Er überhörte meinen ironischen Ton. Rutschte näher. »Dann würde ich jetzt gern auf mein Anliegen zu sprechen kommen.«
»Wenn es um das unbekannte Shakespeare-Manuskript geht, das Sie beim Malen erwähnt haben«, ich rückte ebenfalls näher, »wir haben kein solches im Laden.«
»Sind Sie sicher?« Er flüsterte. »Es könnte irgendwo sein. Im Keller, Dachboden, einem alten Gartenhaus, vielleicht auch in einem Gemäuer. Ich helfe Ihnen gern beim Suchen.« Gleich würden seine Lippen meine berühren.
Ich schüttelte den Kopf. »Wir bauen gerade um. Daher kenne ich jeden Winkel. Da ist kein unbekanntes Shakespeare-Manuskript.«
Henry löste seinen Blick, schmiss den zerknüllten Papierball in den Abfalleimer im Zimmer, zog ein dünnes Büchlein aus der Tasche seiner Leinenjacke und legte es auf den Tisch. Der Einband war aus Leder, er wirkte matt und glänzend zugleich.
»Das ist erst kürzlich in meinen Besitz gekommen.«
Augenblicklich vergaß ich den peinlichen Moment, Aufregung bemächtigte sich meiner. Sie stellte sich immer ein, wenn ich irgendwo in einem überfüllten Regal, einer verstaubten Kiste oder einer verklemmten Schublade eine Entdeckung machte.
»Haben Sie mich gefoppt? Ist es das Manuskript? Haben Sie es bereits gefunden?«
»Nein.« Er deutete auf die verblichenen Buchstaben auf dem Deckel. »›Hannas Journal‹«, las er vor. »Es ist eine Art Novelle, zumindest der Beginn davon. Es wurde von Hand verfasst, in einer altmodischen Schrift. Ich habe sie mit einer Notiz von ihr verglichen, es scheint, dass sie die Autorin ist.«
War er plötzlich verrückt geworden? Wovon sprach er? »Wer?«
»Ach so, Verzeihung. Ihre Patentante.«
»Annie Gisler? Sie soll das geschrieben haben?« Ich war fassungslos. »Wie um alles in der Welt kommt es zu Ihnen?«
Er winkte ab. »Erzähl ich Ihnen ein anderes Mal. Das Journal ist nicht vollständig, auf den fehlenden Seiten wird vielleicht eine Verbindung Ihrer Tante zum Besitzer des Shakespeare-Manuskripts beschrieben. Möglicherweise gibt es sogar Hinweise auf seinen Verbleib.« Er zeigte mir die ausgefransten Stellen. »Können Sie bitte, bitte in Ihrem Haus nach den restlichen Seiten suchen? Es dürften etwa dreißig sein.« Seine Stimme wurde so drängend, wie ich mir das eben gewünscht hätte. »Möglicherweise gibt es weitere von diesen Notizbüchern, möglicherweise sind sie an irgendeinem ungewohnten Ort versteckt, in einem Schlupfloch, das Sie bislang übersehen haben. Aber Sie müssen vorsichtig sein. Jemand weiß davon.«
»Und dieser jemand …?«
»… würde sie selbst in seinen Besitz bringen wollen.«
»Der Kapuzenmann«, entfuhr es mir.
»Wer?«
Da klingelte Henrys Handy.
»Schon wieder«, murmelte er. »Idiot. Sie verzeihen, Tereza. Oder wollen wir zum Du übergehen?«
Er wartete meine Antwort nicht ab, ging ins Zimmer, sprach über die Schulter. »Es wird einen Moment dauern, entschuldige bitte. Gehen wir nachher an den Strand? Den Kuchen essen?«