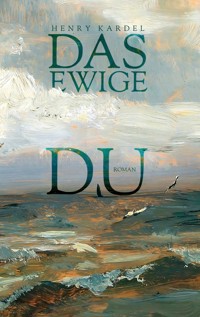Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Adrian liebt Iona. Iona liebt Adrian. Daran können auch die 1107km, die sie normalerweise trennen, nichts ändern. Jedoch soll ihre gemeinsame Reise ins nordnorwegische Tromsø endlich ihre Feuerprobe sein. Bleibt nur noch ein Problem: Wenn es um Liebe geht, ist Adrian Romantiker und Zyniker zugleich... "Wie das mit der Liebe funktioniert? Keine Ahnung! Deswegen schreibe ich ja ein Buch darüber." - Henry Kardel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Liebe verreist wohl einmal,
aber sie wandert nicht aus.«
Sextus Aurelius Propertius
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7: Herkunft
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11: Kindheit
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14: Späte Kindheit
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21: Jugend
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26: Adoleszenz
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31: Erwachsenwerden
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36: Erwachsensein?
Kapitel 37
Kapitel 38: Was so bleibt...
Kapitel 39
Kapitel 40
1
Ich blicke auf, atme aus. Lichtstrahlen benetzen mein Gesicht. Die Sonne wärmt vom höchsten Punkt des azurblauen und von Wolken befreiten Himmels. Zu dieser Zeit des Tages sind die Schatten am kürzesten. Ich bin gedankenversunken. Noch viel tiefer versinke ich aber im schwarzen Ledersessel und zähle die landenden und fortgleitenden Flieger.
Das Vorfeld liegt wie ein breiter, grauer und kerosinbefleckter Teppich vor mir und das metallende Dröhnen der Maschinen kommt nur als leises Surren an, während der Menschenlärm der Abflughalle von der hohen Konstruktion des Gebäudes aufgesogen und verschluckt wird. Lethargisch und gelangweilt von der Welt verbringe ich meine Zeit im Transit. Ja, das ganze Leben ist eigentlich ein schlecht belüfteter und immerwährender Transitbereich. Bin irgendwie zu statisch, bewege mich seit Stunden nicht wirklich vom Fleck, gehöre damit bereits fast zum Mobiliar und das Warten wird zur einzigen Direktive. Lange ist es her, dass ich mich so ungebraucht gefühlt habe. Ob ich jetzt hier in Oslo bin oder meine Zeit an den Stränden der Karibik totschlage, das macht im Prinzip keinen Unterschied.
Um mich herum ist niemand Bekanntes. Ich bin allein. Doch ist das nicht wirklich schlimm. Ledersessel sind sowieso nicht zum Teilen. Man hätte sicher einiges zu reden, doch wahrscheinlich nichts zu sagen. Lieber würde man sich dann energisch und vollends anschweigen. Aber das ist nicht einfach. Ich meine, Stille allein? Okay, das ist billig. Sich aber anzuschweigen, ohne zornig aufeinander oder beleidigt zu sein, das ist viel anspruchsvoller. Was eigentlich schade ist. Denn nur ohne Worte können wir uns die schönsten Dinge mitteilen.
Da steht das Paar mit dem überbeladenen Gepäcktrolley. Es hat sich auch nichts mehr zu sagen. Es schaut sich nur abfällig und verachtend an. Wenn Blicke töten könnten, so läge das halbe Terminal voller Leichen und ich versuche nur, mich nicht von diesen Blicken erfassen zu lassen, nicht in die optische Schusslinie zu geraten. Mit abwehrender Geste verabschiedet sich der Mann, ergreift die Flucht zum Schnellrestaurant, um seiner Familie das Mittagessen zu bringen. Seine Frau bleibt zurück, mit Kind auf dem Arm, welches verträumt das Vakuum bestarrt und nichts von den diabolischen Blicken seiner Eltern ertragen muss. Die junge Mutter schüttelt genervt den Kopf, doch ihr Seufzen bleibt unbeachtet, verpufft im Jenseits. Und ich sage mir nur eins: So werde ich nie. Nie.
Gleich neben dem Mann, hinter dem Stahlpfeiler, erscheint Iona. Sie tippelt auf dem anthraziten Schieferboden auf mich zu und unsere Blicke fangen sich sofort. Der übergroße Rucksack auf ihrem Rücken lässt sie noch zierlicher als gewöhnlich aussehen. Dann stehe ich auf, mit selbigem Gepäck, und es scheint, als wenn dort nichts weiter als zwei überdimensionierte Backpacks aufeinander zu laufen. Meine Damen und Herren, das Warten hat sein Ende gefunden, ich darf vorstellen: Meine Freundin.
Unserer Umarmung, der Rucksäcke wegen sehr unelegant, folgt ein dreisekündiger Kuss, dann wieder eine Umarmung. Wir haben uns 57 Tage nicht gesehen. Ihre nussbraunen Haare sind ein wenig kürzer. Reichten sie vorher noch etwa bis zur Mitte des Brustbeins, so reichen sie jetzt nur noch gerade bis zum Schlüsselbein. Dafür sind ihre Locken etwas schwacher geworden und mit ihren kubanischen Absätzen wächst sie ein kleines Stück über mich hinaus, was sie im ersten Moment sichtlich genießt. Meine Güte, beim ersten Treffen wirkt sie doch immer am schönsten.
Ich streife mit meinem Zeigefinger durch ihr Haar. Fast eine Minute verstreicht, bis wir unsere ersten Silben verbrauchen.
»Deine Haare wirken kürzer«, sage ich, gedrungen, weil mir nichts Gehaltvolleres einfällt.
»Und? Sagst du mir, wie du es findest?«
»Sieht wirklich gut aus. Besser als vorher.«
»Du willst sagen, du mochtest es vorher nicht?«
»Ja. Also, nein. Zumindest... Ich meine...«
Ist sie nicht toll? Sie kann jeden Satz, und sei es das mächtigste Kompliment, aus einer Richtung beleuchten, aus der er schnell infam wirkt. Ich bemerke aber sofort, dass ihre Frage wenig Ernsthaftigkeit birgt. Nur ein kleiner rhetorischer Trick ihrerseits, eine Falle und sie genießt gerade grinsend ihre Beute. Mich.
Mit unseren Rucksäcken machen wir uns auf den Weg zum Zoll. Man könnte nicht unbedingt formulieren, dass wir darauf so scharf wären, aber wir können ja nicht ewig im Transit bleiben.
Wenige Sekunden später werden wir bereits vom Zollbeamten in sein Revier gelotst. Mit penibler Genauigkeit filzt er unser Gepäck, durchleuchtet es, fragt uns nach unseren Vorhaben - wir verschweigen die obszönen Details - und ob wir denn Medikamente oder Fleisch dabei hätten. In jeder von solchen Situationen bin ich ernsthaft versucht, mich mutwillig verdächtig zu machen, indem ich irgendwelche Scherzchen mache oder zwielichtige Antworten gebe. Sich als Psychopath oder potentieller Terrorist zu geben, ist in diesen Tagen nun mal kinderleicht.
Iona und ich, wir könnten Bonnie und Clyde sein. Würden gemeinsam im Kugelhagel sterben. Wie romantisch doch der Gedanke, dass unser beider Gehirnmasse durch die Gegend fliegt, man würde sich vielleicht nochmal mit Blut bespucken, überströmt von Lebenssaft, unsere Blicke würden sich vielleicht ein letztes Mal völlig apathisch treffen, dann ginge das Licht aus. Aber die Zeiten sind vorbei, es würde heute keinen Spaß mehr machen. Die Polizei ist heute weit besser organisiert als zu Zeiten der US-amerikanischen Depression und was sollte man schon ausrauben? Amazon?
Deswegen bleiben meine suspekten Erwiderungen aus. Ich will den heutigen Tag lieber in der Mitternachtssonne verbringen und nicht im grellen Licht einer Untersuchungszelle.
Die Anwesenheit von Iona macht mich ziemlich unsicher. Ich bin mir ungewiss, ob sie auf die Fragen des engherzigen Zollbeamten antwortet, oder ob ich das übernehmen soll. Denn ein oder zwei Mal setzen wir beide zum Reden an, überrümpeln uns gegenseitig verbal, wollen aber dann doch dem Anderen den Vortritt lassen. Das muss beknackt wirken und unsouverän dazu. Eine ähnliche Situation kenne ich lediglich vom Volleyball, wenn zwei Mitspieler zum Ball rennen und sie am Ende miteinander kollidieren. Wären wir Terroristen, so hätten wir unsere Antworten sicherlich besser vorformuliert. Das erkennt auch der Beamte und so blickt er uns ein letztes Mal stirnrunzelnd und erfüllt von Skepsis an, bevor er uns in die norwegische Freiheit entlässt.
Wir geben unser Gepäck neu auf und lassen uns erneut durchleuchten und befummeln, um in den Inlandsteil des Flughafens zu gelangen. Als wir für die Sicherheitskontrolle anstehen, fällt es mir auf: Sie lehnt ihren Kopf auf mein Schulterblatt und schließt die Augen. Von nun an ist sie weit, weit weg. Es ist eines ihrer besten Charakteristika. Sie kann allen Trubel um sich herum ausblenden und vergessen, wenn sie will. Diese Eigenschaft ist mir leider abhanden gekommen. Sie schließt die Augen, taucht ab in ein Paralleluniversum, in eine Existenz, die ihr für diesen Moment etwas attraktiver erscheint. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber vielleicht genießt sie gerade das Meer der Côte d'Azur oder den Himmel ihrer schottischen Heimat. Als wir dran sind, muss ich sie zärtlich aber bestimmt anticken, um sie aus ihrem Tagtraum einzusammeln. Eine halbe Sekunde der Desorientierung und sie ist wieder bei mir.
»Weiter geht’s«, sage ich.
2
Sie wirkt sehr ausgemergelt und müde. Und eigentlich hätte sie längst vor mir hier sein sollen, ihr frühes Aufstehen hat sich aber nicht gelohnt, ihr Flug aus Edinburgh wurde gestrichen und sie wurde über Brüssel umgebucht, deswegen war ich vor ihr da.
Im Flieger nach Tromsø zieht sie sich die Kapuze über den Kopf und lehnt sich wahlweise bei mir oder an der Bordwand an und schläft. Ich lasse meinen Blick aus dem Fenster wandern, sehe die vorbeiziehenden Berge und Fjorde, die sich wie verbogene Kartenhäuser aus dem Wasser aufrichten, und ich spüre bereits, dass es weit in den Norden geht. 350 Kilometer über den Polarkreis, um genau zu sein, auf die Höhe von Nordalaska, wo zur Zeit, im Juni, die Sonne nicht untergeht. Zum Nordkap ist es dann auch nur noch ein Katzensprung.
Eine Stadt mit 72.000 Einwohnern, ohne Frage, für Norwegen ist das metropolitisch, aber dennoch nur ein kleiner Mikrokosmos inmitten der weiten Natur. Und wer immer dort ankommt, der wird dort immerhin die nördlichste Universität, die nördlichste Kathedrale, den nördlichsten botanischen Garten und am allerwichtigsten, die nördlichste Brauerei der Welt, vorfinden. Was aber auch nur die halbe Wahrheit ist, da die Produktion mittlerweile woanders stattfindet. Wie dem auch sei. Es interessiert sowieso keine Menschenseele.
Zumindest werden wir für neun Nächte Teil dieser arktischen Sphäre sein.
Meine Liebste schläft, sieht lieblich dabei aus. Ich habe mir nie beim Schlafen zugeschaut, doch wenn ich es mir vorstelle, sehe ich dabei mürrisch aus, nicht wie sie. Sie hat ihren ganz eigenen Frieden.
Da sie schläft, habe ich meine Gedanken ganz für mich. Sehe die sanften Wolkenfelder vorbeigleiten, wie eine Leinwand, die man am Flieger hinfortzieht. Bewege mich vorwärts, blicke zurück. Das habe ich in den ersten Stunden in Ionas Gegenwart immer gemacht. Ich muss retrospektiv werden und in die dritte Person gehen, um das alles zu verstehen. Denn es kommt mir immer noch unwirklich vor, wenn ich das letzte Jahr, meinen Weg bis zu diesem Zeitpunkt vor meinem inneren Auge abspiele: Vor neun Monaten reist ein verzweifelter Philosophiestudent aus Kiel nach Schottland, allein, ins malerische Edinburgh, lässt sich ein wenig von den Stadtlichtern treiben und bemerkt, wie einsam er sich fühlt. Deswegen setzt er auf die entlegene Hebrideninsel Dearinish über. Ein Ort, an dem sich jeder einsam fühlt. Durch eine Verkettung von Absurditäten grenzt es fast an ein Wunder, dass er dort - vor allem trotz seines Hanges zum stimmungsabhängigen Single-Malt-Verzehrs - die junge Schottin Iona für sich „annektieren“ kann, die eine Ähnlichkeit zu einer (ebenfalls) jungen Sängerin aufweist, die sich einst der Thematik von neun Millionen Fahrrädern in der Hauptstadt Chinas angenommen hatte. Sie ist eine junge Schönheit und außerdem Dearinishs Eigengewächs. Darauf kann sich Dearinish etwas einbilden, meint er immer.
Iona... Eine zarte femme fragile voller Verve und Anmut. Das ist wohl die präziseste Beschreibung ihres Wesens. Sie ist zweiundzwanzig, zwei Jahre jünger als er.
Durch diese Irrfahrt, diese Reise durch den Nebelschleier seiner selbst, bekommt sein Leben einen neuen Turn. Alltägliches füllt sich für ihn wieder mit Sinn. Das erste Mal hat er das Gefühl, nicht nur den Trostpreis bekommen zu haben. Was er mit Iona hat, das ist der Jackpot. Doch natürlich gestaltet sich eine Fernbeziehung dieser Art nicht einfach. Er fühlt sich ständig schäbig, weil er ihr keine dichtere Verbindung bieten kann, denn ihre physische Liebe wird immerhin von 1107km getrennt. Gelegentlich mag Adrian deswegen gewisse Gedankenspiele: Wenn er zur Universität fährt, kommt er ihr um genau zwei Kilometer näher. Es ist, als könnte er sie schon fast spüren, so nah fühlt es sich an.
Bis jetzt haben die beiden erst 34 Tage miteinander verlebt. Sie sprechen zwar jeden oder jeden zweiten Tag miteinander, sehen sich sogar meistens dabei, jedoch ist es für beide hart.
Einmal, da treffen sie sich in der Mitte, in London, was sich als äußerst romantische Idee herausstellt. Die beiden Jungverliebten tollen durch die Stadtgefilde, es ist wie Schicksal, dort zu sein. Desweiteren fassen sie dort relativ schnell den Entschluss, einen gemeinsamen Sommerurlaub zu verbringen. Die Wahl fällt auf Nordnorwegen. Sie wissen, dass ihre Herzenswärme füreinander nicht ortsgebunden ist, nicht sein darf, weil sie sonst daran zerbrechen könnte. Und als wäre das nicht genug, bleibt da ja auch noch die Sprachbarriere. Adrian findet es aber spannend, mit seiner Geliebten auf Englisch zu reden und schmelzt hoffnungslos dahin, wenn sich Iona die Mühe gibt und sich ab und zu an der deutschen Sprache ausprobiert. Das sind die Momente, die ihm bleiben und das Gedächtnis des vergangenen Jahres bestimmen.
Er sieht die Tage, an denen Iona und er sich bisher sahen, als beeindruckend und auf stürmische Weise magisch und anheimelnd. Sie halfen ihm sehr, sich zu wandeln. Er ging nicht mehr „einen trinken“, sondern ging lieber mit ihr feiern oder zumindest hockten sie gemeinsam in Bars, wenn sie sich denn mal sahen. Und manchmal, da tanzten sie bis zum Ergrauen des Morgens. Sie blieben gesprächig und erhielten sich damit eine wichtige Eigenschaft, die er sonst nur von der Zeit vor einer Beziehung kannte. Ein freundschaftlicher Aspekt, zu reden, nicht in einen Beziehungshabitus zu fallen, nicht alles zu einer Konstante machen zu wollen, niemals zu nah beieinander zu sein, lieber umeinander kreisen, wie Planeten und Monde, für Ebbe und Flut zu sorgen, keine Lethargie und damit das Abdriften von der Umlaufbahn zu kennen.
Er wusste schon jetzt: Es würden wunderbare Zeiten mit ihr sein. Zeiten, an die er sich im hohen Alter voller Nostalgie und romantischer Verklärung erinnern wird.
Doch so weit ist es ja noch nicht. Er ist jung. Es gibt keine Verklärung, kein künstliches Beschönigen. Es gibt nur das, was es gibt. Wer dieser junge Mann ist, fragen Sie? Na, das bin ich.
»Jeg må fortelle deg noe«, sagt die eine Flugbegleiterin zur anderen. Ich verstehe kein Wort norwegisch, aber sie wirken in kurzen Momenten spöttisch und ziemlich amused. Ich stelle mir anschaulich vor, wie sie untereinander Anekdoten ihres Flugbegleiterdaseins austauschen. Sätze, die anfangen mit: »Ich hatte mal einen Passagier, der...« und aufhören mit: »...und am Ende roch die ganze Kabine nach Erbrochenem.«
Hinter all der Schminke und dem Make up sehe ich echtes Lächeln, natürliche Falten und wahre Belustigung. Sie schimmert in Millisekunden hindurch, verflüchtigt sich sofort. Man muss sie wirklich suchen, damit man sie entdeckt.
Iona ist wach.
»I dreamed of youuu«, fängt sie leise an zu singen.
»Oh, tell me, was it looovely?«, singe ich so tief ich kann, wie ein brummender Sinatra, zurück. Unglücklicherweise beginne ich ein wenig zu krächzen.
»Natürlich nicht!«, lacht sie.
»Ich weiß. Ich war schon immer ein Albtraum für die gesamte westliche Welt.«
»Nein, das bist du nicht. Wieso solltest du?«
»Ich bin fast pleite, sehe aber unheimlich gut aus!«, sage ich ironischerweise.
»Hey, dir sowas einzureden, ist mein Job«, flüstert sie. Sie drückt mir einen Kuss auf meine bärtige Wange und stimmt noch einmal zum Singen an: »Rasiiier diiich...«
3
Die Welt ist in ein tiefes Grau getunkt. Über den Wolken war noch alles vom Abendlicht durchflutet, doch nun haben wir uns unter den ermüdenden Schleier begeben, der uns vor dem Blau des Himmels beschützen will. Es ist halb zwölf, bald Mitternacht. Von da an wird es wieder heller.
Ein Farbton, den ich noch nie gesehen habe. Es ist nicht wirklich hell, auch nicht dunkel, eher halb erleuchtet, wie die Welt im Halbschlaf, Grau in Grau, einzig die Ampeln leuchten in vollem Rot. Am Horizont über den Gipfeln der Wolkenbruch, das hereindringende Gelb, zerrissene Wolken und das Gefühl, nun wirklich da zu sein: Das ist der Außenposten der Zivilisation.
Am Gepäckband herrscht Wirbelei, doch wir, Iona und ich, sind wie zwei Wandelnde, müde Zombies, die niemandem mehr etwas tun wollen. An der Wand der Gepäckabgabe erstrahlt ein großes tromsøisches Panorama-Winterbild mit Polarlichtern über der hell erleuchteten Stadt, das mir sofort ins Auge fällt.
Am Band, mir gegenüber, steht ein nettes Mädchen. Sie sieht auf irgendeine Weise erfrischend aus. Kurze Pants, Lippenstift, Sonnenbrille in die Haare gesteckt. Als wollte sie den hier herrschenden acht Grad Celsius trotzen. Sie lächelt. Ich auch. Beim ersten Gedanken an Iona höre ich auf. Ich bin nicht allein auf dieser Welt. Demonstrativ gebe ich meiner Freundin einen Kuss. Das Mädchen von gegenüber versteht und wendet sich ihrem Vater zu, der sie abzuholen scheint. Eigentlich eine Anmaßung, zu glauben, sie könnte etwas von mir wollen. Es ist mir auch egal.
Mein Rucksack wiegt so schwer wie das Grau auf mir, besonders um diese Zeit. In unserem Taxi läuft Message in a Bottle von The Police. Aber auch nur bis wir in das Tunnelsysten fahren, welches die gesamte Stadt unterführt und mit einigen unterirdischen Kreisverkehren versehen ist. Wir lauschen Stings heiserer und stacheliger Stimme, bis das Rauschen beginnt und der Fahrer das Radio abschaltet.
Auf den kurzen Metern ins Taxi haben wir bereits die Kälte gespürt, hier ist kein Sommer, hier ist nie Sommer. Hier ist gerade nur kein Winter, obwohl die Bergkuppen stets von Schnee bedeckt werden. Wie widersinnig mir doch der Gedanke, im Juni mit Wollpullover und Jacke hinausgehen zu müssen. Doch wir haben uns dazu entschieden. Nun ja, ich habe sie eher dazu gedrängt, wollte ich natürlich sagen.
Und jetzt, wo die Mitternachtssonne plötzlich hereinbricht, wir den frischgemähten Rasen im Vorgarten riechen, sich das Licht glitzernd im Sund bricht, bin ich eigentlich ganz froh darum.
Ich werfe meine Jeansjacke auf unser Bett, finde meine Freundin außerhalb unserer kleinen Wohnung. Sie ist auf der hölzernen Terrasse und beobachtet das nächtliche Lichtspiel auf dem Wasser, was ich gut verstehen kann, auch wenn sie das Meer ebenso in ihrer Heimat hat. Ich greife von hinten um sie, halte sie fest und schließe meine Augen, senke meinen Kopf in ihre Locken. Ich bin so froh. Wir sind da, wir sind endlich angekommen.
Sie dreht ihren Kopf zu mir, sieht mich über ihre Schulter an und liebkost mein Gesicht.
In der Liebe soll man sich gegenseitig überraschen, nicht? Und so beißt sie mir mit einem eifrigen „Ich bin hungrig!“ spaßeshalber in meine Wange, bis ich voller Verwirrung ein hektisches
„Aah!“ von mir gebe. Ich spüre ihre Zähne noch in meiner Haut. Die Gute will mich essen!
Bevor sie mich noch verspeist, schlage ich ihr vor, einen letzten Happen auf dem Balkon zu essen, um nicht ganz mit Loch im Bauch ins Bett zu gehen. Und so decken wir behelfsmäßig den Teakholztisch, er ist neu, aber ein wenig wackelig, zweimal fällt mir die Butter hinunter.
»Die will ich doch noch essen, du Held«, merkt sie verzweifelt an. Kaum gesagt, fällt sie ein drittes Mal hinab. Mir ist nicht mehr zu helfen, das muss Karma sein.
Wenige Minuten später schläft sie mit dem Kopf auf der Tischplatte ein.
Der Tisch kippt.
4
Wie wir ins Bett gingen, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber wenn ich Iona nicht gezwungen hätte, hätte sie auf dem Balkon geschlafen und sich ihren süßen Hintern abgefroren. Können Sie sich vorstellen, dass sie eigentlich die Vernünftige von uns beiden ist?
Als ich aufwache, bin ich allein. Kurz denke ich, dass es ja schon hell ist, dabei will das nichts heißen, es war nie dunkel. Die Laken sind verschwitzt, was ich ziemlich hasse. Irgendwer muss die Klimaanlage hochgedreht haben. Ich nenne diesen Jemand lieber nicht Idiot, das könnte auch ich gewesen sein. Zumindest versuche ich, meine faltige Bettdecke loszuwerden und mich auf die Bettkante zu setzen. Gestern steckt mir noch in den Knochen. Ich fühle mich wirklich wie neugeboren: schleimig, schwach und zum Schreien.
Iona kommt aus der Küche, nur ein überdimensioniertes T-Shirt umhüllt sie bis zum Ansatz der Oberschenkel. In der Hand ein dampfender Becher Kaffee.
»Bist ja schon wach«, murmelt sie. »Hab ich dich geweckt?«
»Glaube nicht. Hab' von Hemingway geträumt. Das war irre. Dabei weiß ich nich' mal, wie er aussah. Und du?«, frage ich.
»Ich weiß auch nicht, wie er aussah.«
»Wie du geschlafen hast, wollte ich wissen.«
»Irgendwo zwischen nicht und gar nicht.«
Sie stellt ihren Kaffee auf die Fensterbank und lässt sich in die verbrauchten Laken fallen. Krallt sich um ihr Kopfkissen und nuschelt in den Stoff. Sie nickt weg. Die Welt hat mir gerade einen Becher frisch gebrühten Kaffees geschenkt.
Ich stelle mich an die Fensterfront unseres Wohnzimmers und stelle mir vor, ich würde einen Bademantel tragen. Nur, dass ich keinen trage. Deswegen stelle ich es mir ja vor. Ich habe ja auch nur Kaffee in meiner Hand und keinen Champus.
Dass ich mich morgens so gut fühle, ist überaus selten. Na gut, körperlich bin ich etwas gerädert, aber meine Laune ist gut. Auf Reisen kommt das häufiger vor, aber im Alltag nicht. Ich war noch nie jemand, der morgens aufwacht und sich sagt: »Wunderbar! Ein neuer Tag!« Ich musste mir das schon immer erst erarbeiten und mit Glück bin ich dann am Abend so weit, dass ich sagen kann: »Wunderbar! Das war ein neuer Tag!« Und dann ist es Zeit fürs Bett.
Aber heute bin ich weder düster noch angsterfüllt gestimmt. Ich bin bereit, um endlich Zeit mit meiner Freundin zu verbringen, bereit für Tag Nummer 35 - diese Stadt wird unsere Bühne sein - bin bereit entlegene Winkel ihres Wesens auszuleuchten, sie zu studieren. Studienfach: Iona. Klingt das nicht nett?
Ich muss Ihnen aber ein Geständnis machen: Ich bin glücklich. Tut mir wirklich leid, jetzt ist es raus. Was für eine bittere Konsequenz das nun für Sie haben wird, wissen Sie wahrscheinlich noch gar nicht. Fangen wir mal so an: Die ganzen großen Komponisten - mir steht es eigentlich nicht frei, mich mit ihnen zu vergleichen - haben wann am meisten geschrieben? Genau!