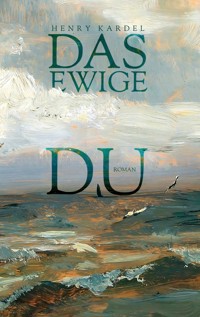
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Spalte in der Lokalzeitung deckt auf: Pastor Gerd Stöver glaubt gar nicht an Gott. Das versetzt nicht nur die Schäfchen in seiner Gemeinde an der Ostsee in Aufruhr, sondern auch die Landeskirche. Während Gerd um sein berufliches Dasein bangen muss und sich ein Verhältnis mit einer Kirchenvorsteherin anbahnt, zieht im Leben des Pfarrers ein Sturm aus existenziellen Fragen und Ängsten auf. In schlaflosen Sommernächten ringt er um Halt - und verliert sich in seiner Obsession für eine Frau aus der Vergangenheit. Vielleicht liegt gerade in ihr die Antwort auf seine Sinnfragen... Ein atmosphärischer Roman über eine Biografie, die ins Wanken gerät, und das Festhalten an dem, was nicht greifbar ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry Kardel, geboren 1996 in Walsrode, wuchs in einem evangelischen Pfarrhaus auf und arbeitet als Redakteur und Moderator für einen Radiosender. Er schreibt seit 2015 Romane und lebt in Lüneburg.
»Ich möchte Leuchtturm sein
in Nacht und Wind –
für Dorsch und Stint –
für jedes Boot –
und bin doch selbst
ein Schiff in Not!«
– Wolfgang Borchert: Laterne, Nacht und Sterne.
Inhaltsverzeichnis
Motto
TEIL I
TEIL II
TEIL III
Zwischen Zweifel und Berufung
TEIL I
Und auf einmal lebt alles in einem anderen Licht.
Der ganze Raum ist in ein helles, strahlendes Licht getaucht. Aber ich kann nicht sagen, was für ein Raum das ist, in dem ich liege, in dem ich aufgewacht bin. Ich lasse meinen Blick über jede Linie wandern. Über den Kleiderschrank aus Kirsche, über dessen Knauf eine Krawatte hängt. Über die fuchsrot lackierte Kommode, auf der sich die Hemden türmen. Über den blauweißen Wollteppich auf dem Boden und das Chagall-Bild an der Wand, in dessen Glas ich gespiegelt die Bäume im Garten sehe.
Mit einem Mal ist mir klar, dass es mein Schlafzimmer ist, in dem ich aufgewacht bin. Und dass es mein Bett ist, in dem ich liege, wie jeden Morgen. Dass meine Möbel und meine Kleidung den Raum säumen. Und dass es mein Bild ist, das ich an die Wand gehängt habe. So, dass man die Bäume des Gartens darin sehen kann.
Und doch ist alles fremd gewesen, für zwei oder drei Sekunden. Vielleicht liegt es in der Natur des Aufwachens, denke ich, dass ich nichts sofort erkennen konnte. Vielleicht liegt es daran, dass meine Augen verklebt sind und mein Blick verschwommen ist. Und daran, dass ich nicht ganz bei mir bin, noch nicht. Oder es liegt am Licht, denke ich. Am Licht dieses Morgens, das anders ist, das allen Dingen eine neue Hülle gibt und jede Oberfläche fremd macht.
Hinter der Wand, drüben im Pfarrbüro, klingelt das Telefon. Genauso wie ich mit einem Mal wusste, dass ich in meinem Bett liege, weiß ich jetzt, dass der Anruf für mich ist.
Ich höre, wie Frau Eggers abhebt. Sie ist die Pfarrsekretärin. Sie begrüßt die andere Seite gutgelaunt, mit ihrem bäuerlichen Elan, und ich springe aus dem Bett auf und schlüpfe in die Hose, die auf dem Boden liegt und von der Nacht noch ganz kalt ist. Auf dem Stuhl am Fußende liegt mein dunkelgrüner Pullover. Ich nehme ihn in die Hand, ziehe die nach innen gestülpten Ärmel nach außen, raffe ihn in meinen Händen zusammen und ziehe ihn über meinen Kopf. Auf dem Weg in den Flur taste ich mein Haar nach eigenwilligen Strähnen ab.
»Ich schaue mal, ob er da ist«, kündigt Frau Eggers an.
Schon klopft es an der Tür, die das Gemeindehaus mit meiner kleinen Pfarrwohnung – ein Fachwerkhäuschen ohne zweite Etage – verbindet.
Frau Eggers ist zweimal in der Woche da. Wenn sie an einem Donnerstag an meine Tür klopft, klingt sie emsig, selbstbewusst. Es macht: Klopf, klopf, klopf. Als warte sie nur auf meine Aufforderung, hereinzukommen. Heute hingegen ist Montag – und sie weiß, dass ich heute frei habe. Deswegen klingt auch ihr Klopfen zurückhaltender. Sie klopft nicht dreimal, sondern viermal, sehr viel leiser. Als klopfe sie die Tür ab, als lausche sie, was dahinter vor sich geht.
Mir ist vom schnellen Aufstehen eine Welle von Übelkeit in den Kopf gestiegen. Ich tapere in den Flur, öffne die Tür und nicke Frau Eggers entgegen.
»Oh, gut, Sie sind schon wach«, sagt Frau Eggers. Sie steht da, in ihrer dunklen Wollweste, mit ihren erwartungsvollen Augen und ihren roten Bäckchen, ja, ihrem Kindergesicht, das von kurzen, mausgrauen Haaren eingerahmt wird.
»Ich habe da jemanden am Telefon«, sagt sie. »Er meint, es ist dringend. Mögen Sie da rangehen?«
»Ja, gut«, sage ich, selbst überrascht davon, wie breiig meine Stimme klingt. »Wer ist es denn?«
»Henning Karstens.«
»Ich komme gleich«, sage ich, denn ich trage noch immer nichts an den Füßen. Ich sause zurück in mein Schlafzimmer, nehme ein frisches Paar Socken aus meiner Kommode, ziehe sie über und schlüpfe in meine Hausschuhe aus Filz. Und dann folge ich Frau Eggers, die schon vorgegangen ist, über den Flur des Gemeindehauses ins Büro.
Das Gebäude steht mittlerweile fast leer. Bis auf einen Raum im ersten Stock, den ich für Besprechungen nutze. Und das Pfarrbüro natürlich, im Erdgeschoss. Dann gibt es noch ein wenig Gerümpel, hier und da. Aber sonst findet das meiste im neuen Gemeindehaus statt, auf der anderen Straßenseite, zwischen Kirche und Dorfanger.
Als ich das Pfarrbüro betrete, kommt mir ein Schwall warmer Heizungsluft entgegen. Ja, so ist es immer, denke ich. Draußen herrscht schon Frühling und Frau Eggers dreht die Heizung auf. Es ist wie in einem warmen Kokon, in dem sich der Duft von Filterkaffee ausgebreitet hat. Und das lindert meine Übelkeit ein wenig.
Die Pfarrsekretärin steht über den Schreibtisch gebeugt, hält den Hörer in der Hand und sagt: »Dann gebe ich mal weiter.«
Mit ihrer Mimik fragt sie, ob sie rausgehen soll, doch ich schüttle den Kopf, nehme den Hörer entgegen und setze mich ihr gegenüber an den Schreibtisch.
»Hallo Henning«, sage ich.
»Gerd, mein Großer, da hast du ja einen Klops gelandet!«
Ich frage ihn, was denn eigentlich los ist.
»Na, die Zeitungsandacht. Von Sonnabend.«
»Ja... Was ist damit?«
»Stimmt das denn wirklich?«, fragt er. Und ich sehe ihn vor mir. Wie er mit seinem bohnenförmigen Gesicht am Küchentisch sitzt, die eckige Brille in der Hand. Und ihm steht der Mund leicht offen. Und ich sehe seine untere Zahnreihe, ja, die vielen Zähne, die so eng und schief stehen, dass es aussieht, als würden sie drängeln.
»Stimmt was?«, frage ich.
»Ja, dass du nicht an Gott glaubst?«
Als er das sagt, schießt mir das Blut zwischen die Ohren. Ich schaue Frau Eggers an, die aufrecht auf ihrem Platz sitzt und in einen aufgeschlagenen Aktenordner starrt. Ihr Gesicht ist neutral, der Blick hat etwas von einem Passfoto, denke ich. Doch da ist eine fast unmerkliche Regung in ihren Mundwinkeln. Ja, sie kann mithören, denke ich. Denn Henning hat ein lautes Organ und ist einer dieser Menschen, die telefonieren, als müsse die räumliche Distanz mit Lautstärke überwunden werden. Also drücke ich den Hörer fester an mein Ohr. Ich habe schon länger nichts mehr gesagt. Henning atmet schwer.
»So, jetzt nochmal von Anfang«, sage ich. »Wer behauptet das denn, was du gerade meintest?«
»Ja, du! In der Zeitungsandacht. Von Sonnabend.«
»Aha?«, sage ich. »Das klingt ja komisch. Was war denn der Wortlaut?«
»Jaaa...«, gesteht er. »Das weiß ich auch nicht. Ne, weißt du, ich hab das nur von den Simonsens gehört, heut' Morgen. Die meinten, dass du ja gar nicht an Gott glaubst. Und...«, fährt er nachdenklich fort: »Und ich glaube, du musst dich da schnell drum kümmern. Bevor das noch die Runde macht. Du weißt ja, wie der Schnack hier op'n Dörpen ist! So eine Sache zieht dir ganz schnell die Schuhe aus.« »Okay?«, sage ich. »Na gut, ja. Ich werde mich darum kümmern. Mach dir da mal keine Sorgen.«
»Ja, gut...« Er ist fast außer Atem von der ganzen Aufregung. »Aber, sag mal, wie ist denn die ganze Sache jetzt? Bist du gar nicht gläubisch?«
Und ich muss aus irgendeinem Grund lachen, als ich das höre. Ja, richtig lachen muss ich. Und ich sehe, dass Frau Eggers mich anschaut.
»Na ja«, seufze ich dann. »Ich bin doch der Pastor.«
In diesem Moment steht Frau Eggers auf und verlässt, mit dem Wasserkocher in der Hand, den Raum. Ich höre, wie in der alten Waschküche der Hahn aufgedreht wird.
»Henning, warum hast du eigentlich hier im Pfarrbüro angerufen?«
»Tja«, sagt er. Und jetzt muss auch er lachen. »Du Schelm, bei dir geht ja keiner ran. Ich dachte schon, du wirst jetzt von der BILD-Zeitung belagert oder irgend so ein Dingens.« »Ja...«, sage ich. »Nein, noch nicht. Aber danke für deinen Anruf.«
»Ja, ja«, sagt er. »Halt mal die Ohren steif.«
»Ja, das mache ich. Du auch. Tschüss.«
Und jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, bevor ich gestern Abend ins Bett gegangen bin, habe ich den Telefonstecker gezogen, denke ich, und lege den Hörer zurück auf die Station. Und ich fahre in Gedanken mit den Fingern über den Schreibtischkalender, der vor mir liegt. Er ist in der letzten Märzwoche stehengeblieben. Mein Blick wandert über die pastellgelbe Bürotapete. Frau Eggers kehrt aus der Waschküche zurück.
»Sie steigen auf Tee um?«, frage ich.
»Ja, genau«, sagt sie beschwingt. »Und? Bei Ihnen ist alles gut?«
Ich nicke. Und versuche einen liebevollen Blick aufzusetzen. Doch mit meinen Lippen und Wangen lässt sich jetzt nur ein gedämpftes Lächeln formen. Und ich bitte Frau Eggers, heute nichts mehr an mich weiterzuleiten. Es ist ja Montag, mein freier Tag. Und sie kann mir ja einen Zettel schreiben, wenn etwas ist, sage ich. Ich würde ihn mir dann gleich morgen früh anschauen.
Frau Eggers hebt unter dem Lärm des Wasserkochers zustimmend die Hand und sagt: »So machen wir's. Dann noch einen schönen freien Tag!«
Ich ziehe die Türen hinter mir zu und setze mich an meinen Schreibtisch. Nur ein paar Sekunden. Dann stehe ich wieder auf, weil ich wissen will, wie spät es überhaupt ist. Im Schlafzimmer nehme ich meine Armbanduhr vom Nachttisch. Es ist kurz vor halb zehn. Ja, so etwas in der Art habe ich auch vermutet, denke ich mir. Und zur Sicherheit schaue ich noch ein zweites Mal auf das Ziffernblatt. Kurz vor halb zehn.
Dann setze ich mich erneut.
Immerhin, denke ich mir, hat Henning zuletzt nicht mehr ganz so aufgeregt geklungen. Ich habe gefasst auf seine Nachricht reagiert. Und das hat ihn beruhigt.
Ich schließe meine Augen. Habe meine Ellenbogen auf die Tischkante und meine Finger an die Schläfen gestützt. Und versuche, mich an die Zeitungsandacht zu erinnern. Wenigstens an Satzteile, einzelne Worte oder Phrasen. Oder doch zumindest das Thema, über das ich geschrieben habe. Aber es ist, als weiche mir die Erinnerung aus. Als entstehe immer dort eine Lücke, wo mein Gedächtnis versucht, hinzufassen. Weder will mir der Text selbst einfallen, noch kann ich mich entsinnen, wie ich ihn geschrieben habe. Er ist einfach weg.
Ich erinnere mich nur daran, wie ich – es muss am Donnerstag gewesen sein – abends am Schreibtisch gesessen habe. Donnerstag ist der Tag gewesen, an dem ich nachmittags die letzte Konfirmandenstunde gegeben habe, die letzte Stunde des Jahrgangs vor der Konfirmation. Und dann bin ich am frühen Abend noch ins Krankenhaus nach Fruerlund gefahren, um eine alte, krebskranke Frau auszusegnen. Und die Verwandten und ich mussten lange, vier oder fünf Stunden, darauf warten, dass sie einschläft. Den Abend über habe ich dann nichts mehr gegessen und war, als ich nach Hause kam, vollkommen erledigt. Ich musste aber noch diese Zeitungsandacht für die Samstagsausgabe schreiben. Also habe ich mir – ja, jetzt habe ich es wieder vor Augen – ich habe mir eine Flasche Aquavit aus dem Tiefkühlfach geholt und mir nach und nach ein paar Gläser eingeschenkt. Flasche und Glas standen auf der Ecke des Schreibtischs, im gelblichen Licht meiner grünen Bankerlampe. Und ich räume die Ecke auf meinem Schreibtisch frei, nehme den Papierkram beiseite, und entdecke – tatsächlich – zwei kreisrunde Wasserflecken.
Ich erinnere mich, dass ich am Sterbebett nichts Hoffnungsvolles zu sagen gewusst habe. Ja, weil es mir an diesem Abend selbst an Trost gefehlt hat. Und vielleicht sind meine Gedanken deswegen so radikal gewesen. Und dann, denke ich jetzt, ist alles möglich, so betrunken und hilflos ich war. Immer wieder hat es diesen subversiven Gedanken in mir gegeben. Den Gedanken, es einfach zu sagen. Aber er ist mit der Zeit immer seltener geworden. Und ich habe ihn so weit von mir wegschieben können, dass ich ihn nicht mehr angetastet habe. Und ich weiß nicht, wieso ich es gerade in dieser Nacht getan habe. Oder haben soll. Denn genau weiß ich ja gar nicht, was ich geschrieben habe.
Aber ich muss den Text noch am selben Abend fertig bekommen haben. Denn mir ist so, als sei ich direkt am Freitagmorgen nach Flensburg gefahren und hätte einen Umschlag bei der Zeitung eingeworfen. Ja, ich erinnere mich sogar noch an die Erleichterung darüber, es noch geschafft zu haben, als ich am Freitagmorgen aufgewacht bin. Das war am Freitag, denke ich. Und jetzt ist es Montag.
Ich starre auf die dunkelrote, fast heruntergebrannte Stumpenkerze, die mittig vor mir steht. Daneben eine leere Milchpackung. Tassen und Gläser. Eine offene Lutherbibel. Notizen für meine letzte Predigt.
Und jetzt muss ich wieder an die Konfirmation gestern denken. Es ist, als würden die Details des gestrigen Tages wie ein Rasiermesser durch mich hindurch schneiden. Denn jetzt, nach Hennings Anruf, ist alles anders. Jede Einzelheit faltet sich in ganzer Größe vor meinen Augen auf und alles in mir zieht sich aus Scham zusammen, vor den Augen der Gemeinde. Dem Gedränge in der Kirche, den gefüllten Bankreihen, der vollen Empore. Vor den vor mir knienden Konfirmanden. Vor meinen zitternden Hände auf ihren Haaren. Und dem Klackern ihrer Metallkreuze auf den gerahmten Konfirmationsurkunden.
Ich stehe auf und tigere in Gedanken durch meine Wohnung, stelle mich vor meiner Fensterfront auf. Ich sehe, wie die gelbgrünen Blätter der Birke in meinem Vorgarten schüchtern im Wind flattern. Ich sehe Kirche und Friedhof auf der anderen Straßenseite. Und ich sehe die kräftigen Grüntöne, die der erste üppige Frühlingsregen vor ein paar Tagen gebracht hat.
Anselm, ja, Anselm Hebedanz, den Küster, sehe ich nicht. Aber ich sehe, dass er am Wochenende die Rasenfläche vor dem Haus gemäht hat. Viel gründlicher als ich es je tue. Und meine Augen finden Gefallen am Anblick dieser gepflegten, zur Straße hin leicht abfallenden Ebene. Ja, der Blick aus dem Fenster beruhigt mich, auf irgendeine Weise. Denn da draußen hat sich nichts verändert. Nein, viel besser noch: Da draußen geht alles weiter. Wie gehabt. Und weshalb soll ich meinen freien Tag nun damit zubringen, in Gedanken an das zu versinken, woran ich mich ohnehin nicht erinnere? Warum soll ich mich dazu verdammen, daran zu denken, denke ich.
Ich taste die Arbeitsfläche meines Schreibtischs nach meinem Terminkalender ab und ziehe ihn unter den losen Zetteln hervor. Ich sehe, dass die Spalte für heute leer ist, nur am unteren Ende habe ich einen Termin eingetragen: ein Telefonat mit meinem Bruder um neunzehn Uhr.
Ich schlage den Kalender wieder zu und suche meine Kaffeetasse. Sie steht auf dem Lautsprecher meiner Stereoanlage, rechts neben dem Schreibtisch. Die braune Pfütze, mit der ich sie gestern Morgen vor dem Gottesdienst habe stehen lassen, ist zu einem vertrockneten Ring geworden. Nach einem Frühstück ist mir nicht. Aber ein schöner, heißer Kaffee, das wird mir helfen, denke ich.
Ich gehe nach hinten in die Küche, entsorge den alten Kaffeefilter aus der Maschine, spreize mit Daumen und Mittelfinger einen neuen in die Halterung und öffne die Kaffeedose. Das Häufchen Pulver darin riecht holzig und abgezehrt. Vielleicht würde ich noch eine Kanne damit zusammenbekommen, denke ich. Doch ich kippe es in den Mülleimer unter der Spüle und schneide mit einem geriffelten Messer in die Oberkante einer neuen Packung. Sie zischt und gibt einen nussigen, fast scharfen Duft ab. Ich stecke die Verpackung kopfüber in die Kaffeedose und lasse das Pulver in den Behälter rieseln.
Während die Maschine zufrieden vor sich hin röchelt, setze ich mich zurück an den Schreibtisch. Und zugleich frage mich auch, weshalb ich das eigentlich tue. Heute ist doch mein freier Tag. Frau Eggers hat es mir eben noch bestätigt. Ich muss hier also eigentlich überhaupt gar nicht sitzen. So wie ich es sonst schon jeden Tag tue. Zwischen all meiner Arbeit. Andererseits, denke ich, kann ich an meinem freien Tag tun und lassen, was ich will. Und so kann ich, wenn mir danach ist, auch am Schreibtisch sitzen, ohne Aufgabe. Zumindest, bis ich weiß, was ich mit meinem Tag anfangen will.
Mir fällt ein, dass ich am Wochenende neue Bücher gekauft habe.
Ich gehe hinaus und schließe meinen alten Saab auf, der auf dem Rasenstreifen vor dem Gartenzaun steht. Die Tüte mit den Büchern liegt im Fußraum des Beifahrersitzes. Ich nehme sie mit ins Haus und lege das Gekaufte auf den Beistelltisch zwischen Kamin und Lesesessel, während die Plastiktüte auf den Boden segelt. Oben auf liegt das neue Buch von Günter Grass, Im Krebsgang. Ich lasse mich in den Sessel sinken, lege das Buch in meinen Schoß und nehme Werk für Werk vom Stapel. Da ist die New York-Trilogie von Paul Auster. Und Jon Krakauers Bericht vom Unglück am Mount Everest. Dann ein Buch von Jürgen Moltmann über Das Kommen Gottes und die christliche Eschatologie. Und das neue Buch über Dostojewski von Eugen Drewermann, dessen beschwörenden Tonfall und grabesernste Miene ich eigentlich nie habe leiden können.
Die New York-Trilogie verbleibt in meinem Schoß, der Rest wandert zurück aufs Tischchen. Ich schlage die erste Seite auf und lese: Mit einer falschen Nummer fing es an, mitten in der Nacht läutete das Telefon dreimal, und die Stimme am anderen Ende fragte nach jemandem, der er nicht war. Und ich lese weiter, Satz für Satz. Und irgendwann, nachdem ich mehrmals umgeblättert habe, lese ich, ohne noch den Inhalt zu durchdringen. Und ich zwinge mich, die Sätze, die mir entgangen sind, noch einmal zu überfliegen. Doch nach und nach verliert sich mein Blick zwischen den Zeilen. Und erst denke ich, dass es am Buch liegt. Aber dann passiert mir dasselbe bei Günter Grass. Und ich verstehe, dass es mit den Büchern nichts zu tun hat. Und ich bin frustriert. Und gehe, wieder einmal, auf und ab. Starre aus dem Fenster. Sortiere ein paar herumliegende Bücher ins Regal. Und begutachte den Inhalt meines Kühlschranks.
Hunger habe ich noch immer keinen, denke ich, aber mit einem Mal einen unglaublichen Durst. Ich fülle ein Glas mit Leitungswasser und leere es auf der Stelle. Ich fülle es wieder auf und trinke erneut, jetzt nur einen Schluck. Und durch das Küchenfenster sehe ich, wie sich im hinteren Teil des Gartens zwei Amseln auf der Lehne meiner Bank niederlassen. Auf dem Feld dahinter sind erste grüne Linien zu sehen. Zwischen den Ackerfurchen sind in den letzten Wochen Büschel gewachsen. Und ich stelle mir vor, wie die Sommergerste in zwei oder drei Monaten hüfthoch hinter dem Haus stehen wird. Erst grünlich gelb und dann in gelbgoldener Farbe.
Ich könnte ein wenig Gartenarbeit machen, denke ich. Den Rasen mähen. Ein paar Pflanzen zurückschneiden. Ein oder zwei Stellen umgraben. Und etwas Ordnung in den Schuppen bringen. So, wie er da unschuldig, fast schlafend in der hintersten Ecke des Gartens steht, rot gestrichen wie ein Schwedenhaus, sieht man ihm gar nicht an, wie chaotisch es in ihm aussieht. Der Rasenmäher steht direkt im Eingang, weil sich der Rest der Werkzeuge gemeinsam mit dem Brennholz zu einem großen Haufen formiert hat. Es ist ein Gewühl aus Äxten, Astscheren, Handschuhen, Sägespäne, Besen und Harken, Schaufeln und Spaten, einem Sägebock und dem Fahrradträger meines Autos. Die Halterungen an den Wänden sind leer, alles liegt wild herum. Und ich kann mich nicht erinnern, womit der Haufen einmal angefangen hat. Ich weiß nur, dass das Gewirr von Mal zu Mal größer wird. Wenn ich etwas aus dem Schuppen brauche, suche ich eine Ewigkeit in diesem Durcheinander. Und meist bin ich beim Zurückbringen schon wieder so in Zeitnot, dass ich das Gebrauchte nur dem Haufen überlassen kann.
Ich öffne die Küchentür und trete in Socken auf die Terrasse. Meine Arbeitsschuhe, ein Paar alte Turnschuhe, lehnen an der Hauswand. Ich nehme einen Schuh in jede Hand und schlage beide gegeneinander, so wie die Becken in einem Orchester. Ein wenig Erde rieselt auf die Pflasterung. Ich lasse die Schuhe auf den Boden fallen und bücke mich, um sie überzuziehen.
Es klingelt an der Haustür.
Ich streife die Schuhe wieder von meinen Füßen und durchquere meine Wohnung. Vielleicht ist es die Post, denke ich. Doch außer meinem ist kein Auto zu sehen.
Ich öffne die Haustür. Vor mir steht ein Mann. Er sieht aus wie ein Handwerker, denke ich, trägt eine braune Funktionshose und eine schwarze Arbeitsjacke. Seine schwarzen Haare sind kurzgeschnitten, an den Seiten grau. Und sein Stoppelbart ist wie ein dunkler Schatten. Seine Unterlippe hat er ein wenig hervor geschoben. Und in seinen Augen wohnt ein suchender Blick, der mich regelrecht anfasst.
»Sind Sie der Pastor?«
»Ja, Gerd Stöver«, sage ich und nicke ihm zu.
»Ja«, antwortet er. Und er ist leiser als zuvor. Als wisse er nicht, was er weiter sagen soll. Er ist rot um die Augen. Sein Mund steht einen Spalt weit offen.
»Thorsten Rodewald, von nebenan«, fährt er fort und deutet auf die Straße hinter dem Dorfanger. »Ich wohne dahinten... Am Hain.«
»Ah. Okay? Was gibt’s?«
»Ich muss Sie sprechen. Es geht um meine Tochter.«
Und auf einmal bebt seine Stimme. Ja, es ist das Wort Tochter, denke ich, das die Stimme zum Beben gebracht hat. Und das Wort Tochter ist es auch, das nun die Fassung aus seinem Gesicht sickern lässt. Ja, es ist, als würde seine ganze Miene einfach zerfallen. Und er fängt fürchterlich an zu weinen.
Wie gelähmt stehe ich da, im ersten Moment. Das ist immer so, auch nach zwanzig Jahren noch. Noch immer stehen der Weinende und ich uns für einen Moment vereinzelt gegenüber – so wie Thorsten Rodewald und ich uns nun gegenüberstehen. Getrennt von der Tatsache, dass einer von uns weint und der andere nicht. Getrennt davon, dass wir einander nicht im selben Gefühl begegnen können. Und das muss man akzeptieren, denke ich. Denn schließlich kann ich ihm nur helfen, weil ich nicht so aufgelöst bin wie er. Und erst, wenn ich das begriffen habe, kann ich dazu übergehen, ihm etwas anzubieten.
Ich atme tief ein und bitte ihn, erst einmal hereinzukommen. Ich öffne die Tür zum alten Gemeindehaus. Immer wieder entschuldigt er sich für seinen Gefühlsausbruch. Beteuert, dass so etwas eigentlich nie bei ihm vorkommt. Und wischt sich dann die seltenen Tränen mit dem Ärmel aus dem Gesicht. Während der Geruch von Alkohol meinen Flur füllt, sage ich: »Einfach nach rechts die Treppe hoch.«
Ich gehe hinter ihm und achte auf seine ausfallenden Schritte. Frau Eggers steckt den Kopf durch die Tür des Pfarrbüros. Ich gebe ihr ein Handzeichen, dass alles in Ordnung ist und warte darauf, dass sie wieder verschwindet. Doch sie schaut uns den ganzen Weg hinterher, bis wir oben angekommen sind.
Im ersten Stock ist es dunkel. Alle Türen des Flurs sind geschlossen. Thorsten Rodewald bleibt orientierungslos stehen. Er schwankt dabei wie eine Kiefer im Wind, denke ich, und öffne die Tür zum Besprechungsraum. Das Licht, das aus dem Fenster in den Flur fällt, scheint so hell in sein Gesicht, dass er seine nassen Augen zusammenkneift.
Die Tische sind in U-Form aufgebaut. Herr Rodewald setzt sich, ganz in der Nähe der Tür, während ich zum Regal auf der rechten Seite gehe, um einen Tee aufzusetzen.
»Wollen Sie einen Tee?«, frage ich und nehme zwei Tassen vom Stapel und stelle sie vor mir auf. Er gibt keine Antwort. Ich wende mich ihm zu. Sein Kopf dreht sich langsam zu mir. Ich sehe ein leichtes Nicken. Und ich frage ihn, welchen Tee er denn will. Aber er antwortet nicht mehr. Er schaut nur blass aus dem Fenster.
»Ach, ich mache Pfefferminze«, sage ich, eher zu mir selbst, um nicht noch einmal eine Frage zu formulieren. Es dauert eine Ewigkeit, bis der Wasserkocher nicht mehr aufdringlich faucht, sondern zittert und brodelt und ich die Tassen füllen kann.
Dann setze ich mich zu ihm und frage, was geschehen ist. Und mit schwerer Zunge erzählt er von seiner Familie. Von seiner Tochter, die gerade elf geworden ist. Und von seiner Frau Sonja, mit der er nicht mehr klarkommt. Streitereien habe es schon länger gegeben, sagt er, und er beschreibt, wie sie immer schreien würde, wenn ihr etwas nicht passt. Nun sei es aber am Geburtstag der Tochter vollkommen eskaliert. Sie sei abends einfach auf ihn losgegangen.
»Sie sagt, ich hab' meine Tochter angefasst«, dröhnt er. »Und sie will sich deswegen von mir trennen. Sie hat gedroht, das Jugendamt einzuschalten. Und will, dass ich ausziehe.«
Ich müsse ihm unbedingt helfen, meint er. Und er redet und redet und redet. Über dieses und jenes, über nichtige Details, die überhaupt nichts mit irgendetwas zu tun haben. Und ich sitze die ganze Zeit über still da und höre seinen Ausführungen zu. Ab und zu nicke ich. Manchmal schaue ich grübelnd aus dem Fenster, um seine Erzählungen in meinem Kopf zusammenzusetzen.
Irgendwann klingt sein Redeschwall ab. Seine Augen haben sich entleert, sein Gesicht ist getrocknet, seine Stimme stabil. Ein Speichelfaden hängt noch auf seinem Kinn. Und er hebt zum ersten Mal seine Tasse an, um einen Schluck daraus zu nehmen.
»Was sagt denn Ihre Tochter dazu?«, frage ich.
Und er setzt die Tasse, ohne getrunken zu haben, wieder ab und seufzt erschöpft.
»Die sagt nichts. Und dann sage ich immer: Kleine, du
kannst doch sagen, dass das nicht stimmt, was Mama sagt. Aber meine Frau keift dann, dass ich sie nicht unter Druck setzen soll.«
»Und wann soll das gewesen sein? Also, dass Sie Ihre Tochter angefasst haben? Gab es da eine Situation, in der ihre Frau das so hätte wahrnehmen können?«
Er zuckt mit den Schultern.
»Nichts? Aber irgendwo muss sie das doch herhaben, oder?«, meine ich.
»Ich weiß nicht. Ich schätze, sie will mich einfach loswerden.«
»Auf diese Weise?«, sage ich, etwas lauter als gewollt. »Hat sie denn irgendeine Forderung? Also, wie soll es denn jetzt weitergehen?«
»Ich weiß nicht. Jugendamt, schätze ich. Wenn ich nicht ausziehe.«
»Und wenn es nach Ihnen geht?«, frage ich. »Wie würde es dann weitergehen?«
»Ich will doch einfach, dass alles beim Alten ist.«
Ich nicke. Und ich sehe, dass ihm neue Tränen in den Augen stehen.
»Wie kommen Sie denn im Moment klar? So allgemein?«
»Es geht«, sagt er und macht eine lange Pause. Und man hört die Vögel im Garten zwitschern. »Aber manchmal bleibe ich ganze Nächte weg. In der Spielhalle. Und bin so besoffen, dass ich mich hinterher an nichts mehr erinnere.«
Und dann erzählt er von seiner Arbeit als Elektroinstallateur. Und dass sein Chef ein Mistkerl ist. Dass er ihm Druck machen würde, weil er bei seinen Hausbesuchen immer zu viel Zeit braucht.
»Aber ich kann doch nicht einfach hin und weg, ohne mal eine Minute mit jemandem zu reden. Das ist doch unfreundlich.« Er schüttelt den Kopf. »Es ist einfach... Es bricht gerade alles auseinander. Was soll ich denn jetzt nur tun?«
Er legt seinen Kopf in die Hände. Und ich gebe einen nachdenklichen Laut von mir. Nach einer Weile sage ich: »Also, ich kann Ihnen ein Mediationsgespräch anbieten, zusammen mit Ihrer Frau. Aber bei so einer Sache... Für so etwas ist eigentlich das Jugendamt zuständig.«
Es ist länger her, dass er mir in die Augen geschaut hat. Doch jetzt färbt sich sein Blick und er starrt mich ungläubig an.
»Aber... Sie müssen mir glauben. Ich mache solche Dinge nicht!«
Und ich schüttle sanft den Kopf.
»Das habe ich auch nicht gesagt. Ich meinte nur, dass ich... Na ja, ich bin nicht dazu da, um das zu entscheiden. Ich werde Sie nicht verurteilen. Aber eben auch nicht freisprechen können. Bei so einem Vorwurf.«
»Aber es ist doch nur ein Vorwurf… Das Jugendamt... Die hauen mich doch in die Pfanne!«
Und ich schaue ihn lang und ernst an. Ja, jetzt kann ich es zum ersten Mal tun. Jetzt bin ich zum ersten Mal stark genug, denke ich, um ihm lange und konzentriert in die Augen zu schauen.
»Es geht um Ihre Tochter«, sage ich. »Und Ihre Tochter wird auch eine große Rolle in alldem spielen. Wenn sich also die Vorwürfe als haltlos herausstellen, dann vor allem, weil ihre Tochter Sie in Schutz genommen hat.«
»Ja, aber was, wenn meine Frau ihr das nur lange genug einredet? Das tut sie doch jetzt schon.«
»Das Jugendamt hat sicherlich nicht das erste Mal mit so einem Fall zu tun«, meine ich.
Er seufzt.
Ich habe meine Ellbogen auf den Tisch gestützt und die Hände gefaltet. Ich löse die Finger voneinander, lege sie flach auf die Tischfläche und schiebe meinen Kopf ein wenig nach vorne.
»Ich glaube, in dieser Phase müssen Sie einfach Vertrauen haben. Ich meine, Sie wissen, dass Sie Hilfe brauchen, auf allen Ebenen. Das war der erste Schritt und das war sehr gut von Ihnen. Wenn Sie am Mittwoch noch einmal vorbeischauen mögen, dann können wir gucken, an wen Sie sich wenden können, okay? Zwischen fünfzehn und sechzehn Uhr habe ich Sprechstunde.«
»Ja«, sagt er, tonlos.
»Sollen wir noch zusammen beten?«, frage ich. Und er schüttelt den Kopf. Und ich bin erleichtert deswegen.
»Einen Fuß vor den anderen setzen«, sage ich. »Es ist ein ernstes Thema, aber Sie werden ja tätig. Und das ist gut. Wollen wir das erst einmal so stehenlassen?«
Wir beide nicken uns zu und stehen auf. Ich stelle die Teetassen auf das Regal an der Seite und begleite Thorsten Rodewald nach unten.
»Alles Gute Ihnen!«, sage ich und schließe die Haustür.
Ich öffne in meiner Wohnung alle Fenster. Und habe zum ersten Mal Hunger. Also gehe ich in die Küche. Und ich sehe, dass die Tür zum Garten angelehnt ist. Ich muss sie aufgelassen haben, als es vorne geklingelt hat, denke ich. Und ich erinnere mich daran, dass ich im Garten arbeiten wollte. Aber jetzt ist es zu spät, um damit noch anzufangen, denke ich. Dabei weiß ich gar nicht, wie spät es genau ist. Und ich schaue auf meine Armbanduhr und sehe, dass es bald eins ist. Eine gute Zeit zum Essen.
Ich hole einen Topf aus dem Schrank, fülle ihn halb mit Wasser und stelle den Herd auf die höchste Stufe. Ich suche noch den Deckel. Mir fällt ein, dass er wahrscheinlich noch im Geschirrspüler liegt. Also nehme ich den gewölbten Deckel meiner Pfanne. Er ragt ringsherum ein paar Zentimeter über den Rand des Topfes und lässt ihn wie einen Pilz aussehen.
Es klingelt wieder an der Tür.
Kurz überlege ich, ob Thorsten Rodewald vielleicht etwas vergessen hat, doch dann sehe ich das Auto vor dem Haus. Es ist ein roter Polo, Kennzeichen SL B 349. Und ich denke, ich kenne das Auto. Aber der Weg bis zur Tür reicht nicht, um den Wagen zuzuordnen, diesen roten Polo, mit diesem Kennzeichen.
Als ich die Tür öffne, steht Gudrun vor mir. Gudrun aus dem Kirchenvorstand. Mir funkelt das kleine, goldene Kreuz entgegen, das sie um den Hals trägt, über einem Pullover, der in etwa den Farbton eines faulen Apfels hat. Ihre braunen Haare sind hochgesteckt und vorne zu einem Pony geschnitten. Aber die Strähnen, die ihr ins Gesicht hängen, sind fast zu dünn, um dafür herzuhalten. Auch ein Pony kann ihrem Gesicht keine Leichtigkeit geben, denke ich. Oder Reiz. Sie ist eine hagere und glanzlose Erscheinung. Mit gräulichen Augenringen. Und runden Augen, die zu groß wirken, neben den tiefen Mulden unterhalb ihrer Wangenknochen. Sie hat nicht einmal viele Falten, denke ich. Aber die, die sie hat, etwa jene von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln, sehen wie geschnitzt aus. Ich würde nicht sagen, dass sie eine unschöne Frau ist, nicht an sich. Doch sie hat schon immer gewirkt, als habe sie eines Tages beschlossen, auf Äußerlichkeiten keinen Wert mehr zu legen. Oder nein, mehr noch: sie zu verneinen. Denn sie wirft Frauen, die sich zurechtmachen, immer einen scharfen Blick zu. Als sei Schönheit etwas Böses. Oder eine Täuschung.
Gudrun lebt mit ihrem Mann auf einem Hof hier in der Nähe, draußen auf den Feldern. Er unterhält einen Mastbetrieb für Hühner. Ihre beiden Kinder sind schon aus dem Haus, ich habe sie beide konfirmiert. Und das Leben auf dem Hof, ja, das Leben im Hause Köhler-Niemetz stelle ich mir irgendwie gleichförmig und blass vor. Aber vielleicht ist das ja auch der Grund, weshalb sie so treu in die Kirche kommt. Ja, und sie ist so inbrünstig, wenn sie da ist. Bei der ganzen Gemeindearbeit. Aber auch immer irgendwie verkümmert und erloschen.
»Hallo, Gerd«, sagt sie und macht ein schönes Gesicht.
»Oh, hallo Gudrun«, sage ich. »Was gibt’s?«
»Ja, ich hatte dich telefonisch nicht erreicht. Und dann war ich sowieso hier in der Gegend und dachte, ich schaue einfach mal nach, ob du da bist. Und da sah ich, dass du gerade Besuch hattest...«
»Ah ja, das war nur jemand aus der Gemeinde.«
»Ach so«, sagt sie. »Ich wollte nur nochmal kurz etwas mit dir besprechen wegen der Kinderbibeltage. Kann ich hereinkommen?«
Sie hält einen quittengelben Schnellhefter aus Pappe in den
Händen.
»Okay? Ja, komm herein«, sage ich.
Erst jetzt, als sie mit klackernden Schritten in meinen Flur tritt, fällt mir auf, dass sie Spangenschuhe mit Absatz trägt.
»Schön hast du es hier«, sagt sie und wirft im Vorbeigehen einen verstohlenen Blick ins Schlafzimmer. »Oh, und so eine schöne Bücherwand hast du. Und einen Ofen.«
»Ja«, sage ich. »Ich habe es gerne gemütlich.«
»Das sieht man«, entgegnet sie. »Hast du vielleicht irgendwo einen Tisch?«
»Einen Tisch?«
»Ja, wo wir uns setzen können. In deiner Küche vielleicht?«
Und mit einem Mal zischt und brodelt es. Ja, ich habe den Topf auf dem Herd vergessen!
Ich mache einen Sprung in die Küche und lege den Deckel an die Seite. Eine Dampfwolke steigt, in der Form eines Atompilzes, bis zur Decke auf. Jetzt schnell die Kartoffeln herein, denke ich. Aber ich habe sie ja noch gar nicht geschält, fällt mir da auf. Also schalte ich den Herd wieder aus.
Gudrun steht hinter mir und lächelt schüchtern.
»Also, es geht um das Theaterstück, das die Kinder spielen sollen. Ich habe da am Wochenende noch einmal drauf geschaut. Und Gerd, ich muss sagen, die Botschaft des Stücks ist wirklich...« Sie schüttelt den Kopf. »Es ist ein verdorbenes Stück, ja, kränkend. Kränkend für ihn. Vielleicht gucken wir uns den Text gemeinsam nochmal an?«
Und sie zieht einen Stuhl von meinem Küchentisch weg.
»Was ist damit falsch?«, frage ich.
»Also, erst einmal... Wie Jesu als Kind dargestellt wird...
Er... Er wirkt so wie alle anderen Kinder auch.«
»Na ja, auch Jesus war mal ein Kind«, sage ich.
»Aber doch nicht so wie alle anderen Kinder. Wie kann man... Er ist eben nicht einfach wie all die anderen Kinder.«
»Aber... Er ist in allem uns gleich, außer der Sünde«, sage ich. »Sind die Kinderbibeltage nicht noch zwei Monate hin?«
»Ja, wieso?«
»Dann haben wir doch noch Zeit, um das zu klären. Wir haben doch nächste Woche sowieso Kirchenvorstand. Magst du da nicht einfach ein bisschen früher kommen und wir besprechen das dann? Weil streng genommen bin ich ja heute gar nicht im Dienst.«
»Ach so«, sagt sie erstaunt. »Na ja, dann... Tut mir leid, dass ich dich gestört habe.« Und als sie das sagt, wird ihr Ton herb. Sie bleibt reglos stehen.
»Kein Problem«, sage ich. Und lächle.
Sie setzt sich mit ihren Schuhen in Bewegung und klackert über meinen Holzboden zurück zur Haustür.
»Ich bin mir sicher, wir können das mit dem Theaterstück klären«, sage ich, als sie zur Tür hinausgeht. Gudrun bleibt stumm. Auf dem Weg zum Gartentor dreht sie sich zu mir um und sagt, ohne eine Miene zu verziehen: »Tschüss«. Dann steigt sie wieder in ihren roten Polo und fährt davon.
Zurück in der Küche schäle ich Kartoffeln, bringe das Wasser wieder zum Kochen, hole ein paar Bohnen aus dem Tiefkühler und setze einen zweiten Topf auf. Ich lasse Butter in der Pfanne zergehen und röste den alten Schinken, den ich noch im Kühlschrank gefunden habe.
Aus irgendeinem Grund verschlinge ich das Essen, als es fertig ist. Ja, wie ich es sonst nur tue, wenn ein Termin drängt. Dabei ist ja heute mein freier Tag, denke ich. Und ich muss mich gar nicht beeilen.
Nach dem Essen gehe ich ins Bad und lege meine Kleidung ab. Ich drehe die Dusche auf und halte meine Hand unter den Strahl. Als er heiß wird, trete ich in die Duschwanne. Und erst jetzt spüre ich, wie ausgekühlt mein Körper ist. Ich lasse das Wasser heißer und heißer werden, bis es am Rande des Erträglichen ist. Ich genieße den Dampf, der das Bad und allmählich auch das Schlafzimmer ausfüllt und mein Blut zirkulieren lässt. Ja, es fällt mir richtig schwer, mich vom heißen Wasserstrahl zu trennen. Erst als auch das Fenster des Schlafzimmers vollkommen beschlagen ist, drehe ich den Hahn wieder zu, trockne mich rasch ab und ziehe meine Kleidung wieder an. Aus dem Kleiderschrank suche ich meinen alten Wollpullover. Ich entferne ein paar Fusseln und ziehe ihn über.
Dann packe ich einige Sachen zusammen: ein Handtuch, eine Packung Kekse, mein Fernglas, eine Flasche Wasser, meine Sonnenbrille, ein Buch. Alles kommt in den kleinen Seesack, den ich vom Haken an meinem Kleiderschrank nehme. Mit nassen Haaren trete ich in den Garten und schwinge mich aufs Fahrrad. Die Wolken sind zierlich und stehen hoch am Himmel. Die frische Luft, die Farben, die Gerüche, alles ist betörend.
Ich rolle aus der Ausfahrt und biege nach rechts.
Auf der anderen Straßenseite steht die Kirche von Agerby, ja, meine Kirche. Und ich denke daran, wie viele Stunden ich schon in ihr verbracht habe, seit ich mein Vikariat begonnen habe, vor zwanzig Jahren. Wie oft ich schon zwischen diesen dicken Mauern auf der Kanzel gestanden und gepredigt habe. Und getraut. Und getauft. Nur beerdigen, das tue ich drüben in der kleinen Friedhofskapelle. Und ich denke daran, dass mir jeder Winkel dieser Kirche nah ist. Die taubenblauen Bankreihen und Emporen. Die weiß gekalkten Wände. Die drei winzigen Fenster auf jeder Seite des Kirchenschiffs. Die Apsis mit ihrem länglichen Altarraum. Der goldene Kronleuchter an der Balkendecke. Der goldene Flügelaltar mit seinen Szenen aus der Bibel. Der Gestühlskasten für den Adel aus der Renaissance.
Ja, und wie oft ich die Feldsteinmauern und den Turm aus dunkelrotem Backstein von außen angeschaut habe, drüben von meinem Schreibtisch aus. Obwohl sich ja nicht viel daran tut. Aber ich mag ihn, den Anblick dieses massigen Turms. Denn ich muss immer daran denken, dass Kirchtürme für einige Menschen wie der Zeigefinger Gottes sind. Ja, aber ich, ich kann bei diesem dicklichen Exemplar seit jeher nur an einen Daumen denken.
Ich lasse den Friedhof, die Kirche und das neue Gemeindehaus hinter mir, auch Priens Gasthaus auf der anderen Straßenseite. Dann kommt der Dorfanger mit seiner leeren Rasenfläche und dem Kriegerdenkmal, unter den großen, brokkoliförmigen Eichen. Und ich biege nach links auf die Bundesstraße ein, am Kindergarten und Bäcker vorbei, und fahre bei nächster Gelegenheit wieder nach rechts, raus aufs Feld, in Richtung Telt.
Ich denke daran, dass ich schon eine schöne Kirche habe, für so ein kleines Dorf wie Agerby. Für die paar Höfe und schlichten Einfamilienhäuser, den Bäcker, den Kindergarten, das Gasthaus. Die Kirche hätte genauso gut in Kilderup stehen können, das viel größer ist als Agerby, mit seiner Mühle am Fluss. Oder in Nienholz. Und auch Auby ist größer, obwohl Auby im Kern nur eine Ansammlung von Scheunen ist. Aber stattdessen müssen alle, die Menschen aus Kilderup, aus Nienholz und aus Auby, sie alle müssen nach Agerby zur Kirche kommen. Denn Agerby heißt die Gemeinde und in Agerby steht die Kirche. Und dann kommen natürlich auch jene, die in diesen vielen kleinen Nestern wohnen, die es in Angeln gibt. Und auf den stattlichen Höfen, wie der Lundhof einer ist. Er steht wie eine grüne Insel in der Hügellandschaft, denke ich. Und andere leben auf den urigen kleinen Höfen, wie Aubyholz einer ist. Und dann gibt es ja auch noch Marienbiel, wo die Häuser wie auf einer Perlenkette aufgereiht stehen. Und im Wald gibt es auch eine Handvoll Häuser, die Siedlung Munkholz, wo früher die Bezirksförsterei war. Ja, und dann gibt es noch den Gutshof Dux, den altehrwürdigen Dreiseithof.
Über die Felder steuere ich auf die Geltinger Bucht zu. Ich kenne alle Risse, Schwellen und Löcher im Asphalt und versuche, ihnen im Zickzack auszuweichen. Mein Schlüsselbund klappert im Fahrradkorb.
Auf der linken Seite liegt der große Buchenwald, rechts eine sanfte Landschaft aus Getreidefeldern, die von Wallhecken eingehegt ist. Von weitem betrachtet sehen die Felder aus, als hätte jemand unförmige Bodenplatten aneinandergeklebt, und als quolle nun der Kleber aus den Fugen, in Form von Hecken und Bäumen, die auf den Grenzlinien wachsen. Auf den Knicken stehen die Schlehen weiß und die Hainbuchen grün in Blüte. Die letzten Felder vor dem Meer erheben sich noch einmal, bevor sich dann die Kanten, direkt am Wasser, steil nach unten neigen.
Sobald ich die Förde vor mir sehe, atme ich schwer auf, angestrengt vom Widerstand der Pedale, und lasse mich die letzten Meter bis zum Strand hinabrollen, bis die Reifen im Sand versinken. Ich nehme meinen Seesack aus dem Fahrradkorb und lasse das Rad in die Wildrosen fallen, die am Rand wachsen. Ich stelze durch den Sand und über das breite Band aus Steinen zur Schorre, wo sich die Wellen nuschelnd und säuselnd auswalzen, und halte kurz meine Hände ins Wasser. Dann setze ich mich auf die Bank neben dem weißen Schiffsmast. Er ist als Denkmal errichtet worden, für ein Schiff, das in der Förde untergegangen ist. Das alte Tauwerk ist mit Haken im Boden befestigt und stabilisiert den Mast von vier Seiten. Einmal im Jahr hängt an der Rah ein weißes Segel.
Auf der Förde sind keine Boote zu sehen. Es ist ja auch Montag, denke ich. Zwar sonnig, aber kalt. Rechts liegt die andere, östliche Hälfte der Bucht und die Geltinger Birk mit ihren Sümpfen, Wäldern und Wiesen. Sie ist die letzte Landzunge vor der Ostsee. Ja, und wenn die Luft klar ist wie heute, dann tritt die ewige Gerade des Meereshorizonts so exakt und deutlich hervor wie es keine andere Kontur in irgendeiner Landschaft je kann.
Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite der Förde, da liegt die dänische Insel Alsen, deren Umrisse mich auf Karten immer an die Form eines Dinosauriers erinnern. Und davor liegt die Halbinsel Kegnæs. Und weiter links ist neben einem großen Wald die Stadt Sønderborg zu sehen, die Alsen mit dem Festland verbindet.
Ich schaue durch mein Fernglas. Die unzähligen Masten des Yachthafens ragen wie kleine Zahnstocher in die Höhe. Und da steht der Schornstein aus roten Ziegeln, der zu irgendeiner alten Fabrik gehört. Und die historische Schlossmühle lugt leicht erhöht und weiß getüncht aus den Häusern hervor. Sie hat winzige Fenster, eine mattschwarze Haube mit grünlicher Patina auf dem kegelförmigen Rumpf und feingliedrige Jalousieflügel. Und da steht auch das Schloss aus rotem Backstein, direkt an der Einfahrt zum Alssund.
Nachdem ich meine geliebte Kulisse in Augenschein genommen habe, lege ich mein Fernglas zur Seite und schlage das Buch auf, das ich mitgenommen habe. Ab und an nehme ich mir einen Keks, schaue wieder ins Buch und dann aufs Meer. Ja, immer wieder blicke ich auf. Auf die Bucht. Die Bewegung der Wellen. Und auf die andere Seite. Allzu lange kann ich nicht davon wegschauen, denke ich. Als gäbe es eine unruhige Kraft in mir, die mich davon abhält, mich ganz den Zeilen hinzugeben. Als müsse ich mich – immer wieder – irgendeiner Sache vergewissern, die im Anblick des Meeres liegt.
Und dann denke ich, dass es Cordelia ist. Ja, es ist der Ort, an dem sie sich immer anschleicht, hineinschleicht in meine Gedanken. Es geschieht wie von ganz allein. Nein, ich denke gar nicht an sie. Aber an diesem Ort ist sie anwesend, auf irgendeine Weise. Und erst, wenn ich das spüre, stelle ich mir sie vor. Stelle mir vor, wie sie sich zu mir auf die Bank setzt. Wie sie ihr kinnlanges Haar hinters Ohr streicht. Wie sie sich einen Keks nimmt und mich nach dem Buch fragt, das ich in meinen Händen halte. Und so sehr diese Vorstellung auch eine alte Glut in mir neu entfacht und mich sofort nach Luft schnappen lässt, so schnell sterben auch wieder die Flammen unter der Vernunft, die ich mir verordnet habe. Ja, ich halte den Raum eng, in dem sie lebt. Denn unter der schützenden Kuppel der Vernunft gibt es keine Luft zum Lodern.
Und ich denke daran, dass sie irgendwo dort drüben sein muss. Ja, es ist ihr Land, die Nation, der sie entstammt. Und ich denke, ebenso gut könnte es für mich das Land Søren Kierkegaards oder Carl Nielsens sein. Ja, einige Figuren, die in meinem Leben eine Rolle spielen, stammen von dort. Doch wenn ich hinüber schaue, auf die dänischen Ufer, kommt nur Cordelia mir in den Sinn. Dabei verbindet sie wohl nichts mit diesem Ort da drüben. Er liegt bloß in denselben willkürlichen Grenzen, in denen sie auch lebt.
Und ich stelle mir vor, wie sie jetzt vielleicht in irgendeinem bunten Häuschen in Aarhus sitzt. Oder in einem großen Apartmentgebäude in Kopenhagen. Vielleicht lebt sie aber auch in einer dieser malerischen Kleinstädte, die – wie ich es oft auf Straßenkarten gelesen habe – so entzückende Namen haben. Wie Bjerringbro, Fuglebjerg oder Humlebæk. Vielleicht wohnt sie aber auch ganz entlegen, denke ich. Wo die Orte keine Namen mehr haben. Und es nicht einmal eine richtige Landschaft gibt, weil weit und breit keine einzige Kontur zu erkennen ist.
Als es Abend wird und die Sonne tief im Westen steht, zieht Wind auf. Er kriecht durch die Maschen meines Pullovers. Während sich meine ausgekühlten Finger in meinen Hosentaschen vergraben wollen, legt sich die Kälte, wie eine eisige Hand, in meinen Nacken. Mein Buch und mein Fernglas verschwinden wieder im Seesack, ich fahre zurück nach Agerby.
Es ist halb acht, als ich zu Hause ankomme. Mir fällt sofort ein, dass ich das Telefonat mit meinem Bruder vergessen habe. Mit dem Haustürschlüssel noch in der Hand wähle ich seine Nummer, doch niemand nimmt ab. Dann fällt mir ein, dass er gemeint hatte, dass er mich anrufen würde. Und das heißt, dass er wieder einmal unterwegs ist. Irgendwo im Ausland, denke ich. Ich versuche es eine halbe Stunde später noch einmal, mit demselben Ergebnis, demselben nöligen Tuten, während mein Herz immer schneller schlägt. Ich weiß gar nicht, worüber ich mit ihm hätte sprechen sollen, denke ich dann. Und vielleicht ist ihm das auch ganz recht, dass ich gar nicht zu Hause war. Denn auch er meldet sich nicht mehr.
Ich schmiere mir ein paar Scheiben Brot mit Käse und Fleischsalat, trinke dazu ein Bier und ein Glas Milch, während im Fernsehen Der Landarzt läuft und es draußen immer dunkler wird, bis schließlich nur noch die undeutlichen Schatten der Äste vor dem Fenster gestikulieren.
Es ist viertel vor zwölf, kurz vorm Zubettgehen, als ich im Terminkalender nachschlage, was am nächsten Tag ansteht. Am Morgen ein neunzigster Geburtstag, mittags ein Trauergespräch. Unten, bei den Notizen, steht: Tagesordnung KV-Sitzung, bis mittags.
Ich seufze. Und lese die hingeklierten Worte wieder und wieder. Als würde das etwas ändern. Dann schlage ich den Kalender wieder zu und koche mir eine Kanne Kaffee. Ich schenke mir einen getorften Whiskey ein und setze mich an den Schreibtisch, mittlerweile froh darüber, dass mir der Eintrag noch aufgefallen ist.
Anfangs ist es mühsam, die Sache überhaupt anzugehen. Doch als das Papier erst einmal in meine elektrische Schreibmaschine eingelegt und der Briefkopf erstellt ist, geht es ganz schnell. Die anderen belächeln mich dafür, dass ich das alte Ding immer noch benutze, sie wollen, dass ich einen Computer bekomme, doch mein Brother läuft und läuft – und so finden auch die sieben Tagesordnungspunkte, von denen drei ohnehin immer dieselben sind, ihren Weg aufs Papier. Fehlt nur noch meine Unterschrift und der Stempel aus dem Pfarrbüro, dann wandert das Blatt in den Fotokopierer und seine sechs Duplikate in Briefumschläge.
Um kurz nach eins habe ich alles erledigt. Und ich kann mich endlich ins Bett legen und schlafen. Und das tue ich auch. Für dreieinhalb, vier Stunden vielleicht. Dann überfällt mich die Erinnerung an den morgendlichen Anruf von Henning. Und ich denke, er hat recht. Ich muss etwas tun.
Draußen steht ein schwaches rosa Licht am Himmel. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Mir ist übel, ich bin aufgeregt, mein Herz pocht. In meinem Bett ist es wohlig warm, doch ich zittere in der Kälte meiner Gedanken. Noch einmal versuche ich mich daran zu erinnern, was ich geschrieben habe, in meiner Andacht. Aber ich kann es einfach nicht. Es ist, als versuchte ich, mich an einen Traum zu erinnern, der Wochen her ist. An dem Ort, an den ich gehe, um mich zu erinnern, ist aber nichts. Nur ein Phantomschmerz für jene Worte und Sätze, die mir abhanden gekommen sind.
Und ich denke über die Menschen nach. Frage mich, wem es zuerst aufgefallen ist. Und was so unmissverständlich gewesen sein kann. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich – selbst betrunken – so einen Satz zu Papier bringen könnte wie: Gott existiert nicht. Solche Sätze brüllen, wo ich doch eigentlich leise sprechen will. Sie sind zu ungefähr. Sie sind genauso richtig wie sie falsch sind. So sprechen Atheisten, denke ich, und ein Atheist bin ich nicht. Doch was ich geschrieben habe, muss eindeutig gewesen sein. Denn so hat Henning ja am Telefon geklungen. Was er von den Simonsens gehört hatte, war nicht wie eine Vermutung formuliert gewesen. Sie sagten, dass du ja gar nicht an Gott glaubst.
Ja, vielleicht ist es den Simonsens zuerst aufgefallen. Aber vielleicht waren sie auch ein späteres Glied in der Kette der Eingeweihten. Wem haben sie es, abgesehen von Henning, noch erzählt, denke ich. Und mit welcher Geschwindigkeit wandert die Nachricht nun von Haus zu Haus? Ja, wer hat überhaupt die Flensburger Zeitung abonniert, frage ich mich dann. Eigentlich jeder, denke ich. Eigentlich hat jeder die Flensburger Zeitung abonniert. Nur ich nicht.
Zuerst sind die quälenden Gedanken noch alptraumhaft aus der Unbestimmtheit des Halbschlafs aufgestiegen. Inzwischen aber ist das, was mir durch den Kopf gleitet, so klar, dass es zwar mein Gemüt beschweren, aber meinen Puls nicht mehr aufscheuchen kann.
Ich nehme einen Schluck Wasser aus der Flasche, die auf dem Boden steht, und sehe, dass draußen die ersten Sonnenstrahlen mit bleierner Schwere auf die Rasenfläche hinter dem alten Gemeindehaus fallen. Ich nehme die Armbanduhr vom Nachttisch. Es ist kurz nach sechs.
Ich schlage meine Bettdecke zur Seite. Das Aufstehen fällt mir nicht schwer. Es ist kalt, aber auch so, als wäre ich innerlich längst aufgestanden. Als müsste mein Körper nur nachholen, was gedanklich längst geschehen ist.
Ich ziehe an, was ich verteilt auf dem Boden finde und fahre im Badezimmer mit einem Kamm durch mein Haar. Im Briefkasten ist nichts Entscheidendes zu finden. Ich steige in meinen Wagen, lasse den Motor an, rolle vom Rasenstreifen auf die Straße und biege nach links auf die Bundesstraße ein. Der Tag wirft lange Schatten voraus. Mit der Sonne im Rücken fahre ich an der Windmühle Fortuna vorbei, die unbewegt bei Langballig im Grünen steht. Die Granitmauer am Turm der Laurentiuskirche in Munkbrarup ragt wie eine Felswand in die Höhe. Im Hochhaus des Kraftfahrt-Bundesamts in Mürwik gehen die ersten Lichter an. Es wäre ein schöner Morgen, denke ich, wenn mir nicht gerade jede Landschaft aufstoßen würde. Denn ich habe nur ein Ziel. Und jede Nebensache – jede Schönheit, jedes Muster – ist mit Ekel behaftet.
Ich stelle den Wagen an der Hafenspitze ab. Die Müllabfuhr ist unterwegs. Einzelne Gestalten sind auf dem Weg zur Arbeit. Aus einer Bäckerei weht der Duft von frischem Kaffee und Brötchen.
Der Kiosk in der Rathausstraße ist der einzige, der mir jetzt einfällt. Der Laden ist noch verrammelt. Vor der Tür steht schon ein Aufsteller, durch die Ritzen dringt Licht. Ich schaue auf meine Uhr. Es ist zehn vor sieben.
Wie ein Straßenhund lungere ich noch ein paar Minuten vor dem Laden herum. Gehe im Kreis, lese den Fahrplan an der Bushaltestelle nebenan. Von Minute zu Minute werde ich aufgeregter. Als es sieben ist, bin ich so unruhig wie ich es beim Aufwachen gewesen bin – und muss doch andauernd gähnen.
Ein dicklicher Mann mit goldener Brille und dünnen, nach hinten gewachsten Haaren öffnet die Ladenfenster.
»Oh, ein Frühaufsteher«, sagt er, als er mich sieht und wischt seine Hand an seiner sandfarbenen Cargoweste ab. Darunter trägt er ein blau gestreiftes Hemd. Und er ist wirklich dick, denke ich. Aber trotzdem scheint ihm das Hemd zu groß.
»Guten Morgen«, antworte ich und muss erst noch meine Stimme finden.
»Warten Sie 'nen Moment, hier fehlt noch die Hälfte.«
Und er bückt sich und hebt einen Stapel unterschiedlicher Zeitungen empor, die er vor mir auf der Theke auffächert.
»Was darf's denn sein?«
»Haben Sie zufällig noch die FZ vom letzten Samstag?«
»Von Samstag?«, sagt er.
Ich nicke. Er schüttelt mit vorgeschobener Unterlippe den Kopf.
»Neee, die habe ich ganz bestimmt nich mehr da. Das ist doch längst durch, sowas. Kalter Kaffee von gestern. Oder vorvorgestern.«
Und er lässt sich zu einem Glucksen hinreißen.
»Könnten Sie vielleicht doch noch einmal nachschauen? Zur Sicherheit?«
Und für eine Sekunde geschieht nichts. Dann verdreht er die Augen, atmet tief ein und dreht sich um. Er geht in ein unbeleuchtetes Zimmer hinter dem Ladenraum. Und ich schaue mich um. An der Haltestelle bremst ein Bus. Eine ältere Dame mit einer lila Fellmütze steigt aus. Und dann kommt der Kioskbesitzer auch schon zurück und schüttelt wieder den Kopf.
»Nix mehr da. Wo soll ich dat denn alles hintun? Nee, hier wird nix aufgehoben. Jeden Tag neu, und wat weg is, is weg.«
»Ist okay«, antworte ich. »Es hätte ja sein können.«
Und ich habe schon abgewunken und ihm den Rücken zugekehrt, da ruft er mir hinterher: »Aber wenn Sie wollen, dann können Sie im Altpapier schnüffeln.«
Und ich lächle höflich und sage, dass ich das lieber nicht täte. Und der Mann zuckt zum Abschied mit den Schultern.
Ich gehe durch die erwachende Stadt zurück zum Auto. Das Wasser im Hafenbecken ist noch ganz glatt. Nur an der Seite schwimmt eine Entenfamilie und zieht weiche Riefen in den makellosen Spiegel. Und ich überlege, ob ich es noch woanders versuchen soll. Und mir fällt ein, dass die Tankleuchte auf dem Hinweg angegangen ist. Also steige ich wieder in meinen Saab und halte auf dem Rückweg an einer Tankstelle in Engelsby.
Sonst ist niemand dort, außer der jungen Frau hinter dem Tresen. Sie hat lange hellbraune Haare, die zu einem Zopf gebunden sind. Ihre Nase ist spitz. Und sie hat ein Piercing darin.
»Nummer drei«, sage ich und zücke meine Brieftasche. »Und haben Sie zufällig noch die FZ von Samstag?«
Und als ich das sage, schaut sie von der Kasse, in deren Tasten sie gerade noch munter getippt hat, hoch in mein Gesicht. Sie neigt ihren Kopf und formt ein vertröstendes Lächeln.
»Leider nicht«, sagt sie. Und ihre Stimme klingt, als hätte ich sie etwas unverschämt Persönliches gefragt, ja, als würde sie mich höflich abweisen. Und es gibt mir das Gefühl, dass das, was ich gesagt habe, etwas Zweideutiges an sich hat, etwas Obszönes. Es gibt mir das Gefühl, zu weit gegangen zu sein. Und ich senke meinen Kopf, schaue der Kassiererin nicht mehr ins Gesicht, nein, lächle nur demütig und nehme ihre Antwort als endgültig hin. Ja, ihr Nein ist auch das Nein aller anderen, denke ich. Aller anderen, die ich fragen könnte. Und ich stelle mir vor, wie hunderte, tausende Exemplare dieser Samstagsausgabe in den Haushalten, in den Geschäften und Mülltonnen liegen. Sie sind keineswegs verschwunden oder vernichtet, denke ich, und eigentlich für mich ganz leicht aufzuspüren, wenn ich nur meine Hand danach ausstrecke. Aber das ist jetzt unerheblich, denke ich, denn jetzt fühle ich mich albern. Und mit kalter, verlegener Haut bezahle ich mein Benzin, steige zurück in meinen Wagen und fahre zurück in die Gemeinde.
Ich parke am Sportplatz bei Telt und spaziere in den Wald. Noch eine halbe Stunde habe ich, bis zum Geburtstagsbesuch. Vielleicht reicht das, denke ich, um den Kopf frei zu kriegen.
Die Forstwege auf der Strecke nach Munkholz sind rechtwinklig angelegt, die Stämme der Buchen mit ihren glatten Rinden pfeilgerade in die Höhe gewachsen. Im Dach der Bäume verschränken sich die Kronen zu großen, dicht und fein verästelten Kuppeln. Wie durch ein Gitter fällt das Sonnenlicht auf den blühenden Waldboden. Er ist voll von Klee, sieht aus wie ein frisch gereinigter Teppich.
Weiter südlich, rund um den Gutshof Dux, ist der Wald ganz anders. Er ist dunkel, verschlungen. Dicht an dicht stehen die Fichten, Lärchen, Tannen, zwischen geschwungenen Wegen, auf buckeligen Moosflächen. Hier und da eine umgestürzte Baumleiche, eine Fläche mit Farn, ein Findling.
Es ist, als würde der Wald von einer unsichtbaren Linie durchschnitten. Beide Seiten gehören zusammen, denke ich, und stehen sich doch disparat gegenüber, wie Jekyll und Hyde.
Vielleicht ist es diese Dualität, denke ich, die meine Gedanken, immer wenn ich zwischen den Bäumen des Waldes gehe, auf die Dinge meines Lebens lenkt, von denen niemand etwas weiß. Ja, denn mir kommt mein Inneres auch häufig wie eine Landschaft vor. Wie ein Wald, in dessen Tiefen sich niemand verirrt, weil die Menschen aus Angst auf den Wegen bleiben. Ein Gebirge, dessen Gipfel niemand kennt, denn das Leben findet in den Tälern statt. Oder wie ein Meer, das nur an der Oberfläche bereist wird. Ja, es gibt einen Gerd Stöver, den niemand kennt. Den niemand je kennengelernt hat. Und je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass es im Grunde doch jedem so gehen muss.
Aber vielleicht war genau das der Grund, denke ich jetzt, weshalb ich mich befreien, mich offenbaren musste, an diesem verschwommenen Donnerstagabend. Das, was ich getan habe, war ein Akt der Befreiung. Womöglich unbedacht und in der Ausführung grob, doch aus einer klar erkennbaren inneren Gewalt heraus. Und diese Gewalt hatte nichts anderes im Sinn als den Menschen etwas über mich erzählen zu wollen, von dem sie nichts wissen. Es geht dabei nicht um die Lust, Geheimes auszusprechen. Nein. Denn was ich gesagt habe, war nicht geheim. Allerdings hat auch nie jemand nach meinem Glauben gefragt. Und jetzt, wo mir das klar wird, muss ich darüber auf einmal richtig lachen. Und bin froh, dass mich niemand sehen kann.
Als ich Kind und Jugendlicher war, wollte es niemand von mir wissen. Denn ich war ja der Sohn des Pastors. Und der wird ja wohl schon an Gott glauben. Und nicht einmal in meinem Theologiestudium hat mich jemand danach gefragt. Es ging immer nur um das Wie. Denn wer Theologie studiert, der wird wohl schon an Gott glauben. Und wenn nicht, dann trennt sich die Spreu vom Weizen spätestens, wenn man durch den Feuerbach gegangen ist, so hat man damals erzählt. Dann, wenn der scharfe Wind der Lektüre Feuerbachs durch die Reihen der Theologiestudenten gebraust ist, würden nur jene übrigbleiben, deren Glaube fest ist. Das ist jetzt mehr als zwanzig Jahre her. Und ich bin immer noch hier.
Jener Gott, von dem man mir seit frühester Kindheit erzählt, hat nie zu mir gesprochen. Er ist stumm – wie die Welt es ist. Er ist so unfähig zu sprechen, dass ich nie vermuten konnte, dass er da ist. Und immer, wenn mir andere von seiner Redseligkeit berichten, denke ich, dass so ein Gott doch nur dem Menschen selbst entspringen kann. Ich kann mir nicht erklären, weshalb ich die Ordnung in der Welt nicht erkennen kann, die andere sehen, weshalb ich sie womöglich mit Notwendigkeit verwechsle. Doch Gott war für mich nie begreiflich. Anders scheint es mir etwa mit quantenmechanischen Fluktuationen, so unsichtbar und schwer zu verstehen sie auch sind, oder der natürlichen Selektion, oder der Lebensfeindlichkeit des weiten Universums. In alldem ist Gott doch nur eine unnötige Annahme, denke ich, die der sparsame Ockham mit seinem Rasiermesser herausgeschält hätte.
Und doch gibt es da eine Musikalität... Zumindest momentweise. Und dann ist mir, als ergreife mich eine ungewohnte Emotionalität. In einem Lied, auf der Kanzel, am Strand, beim Blick in den Himmel. Und dann denke ich doch, dass es Dinge gibt, die über sich hinaus weisen. Und ich fühle mich umfangen. Nicht von irgendeiner übersinnlichen Existenz, aber doch von der Wucht...
Manchmal denke ich schon, dass ein Pastor, der so von Gott spricht, seltsam wirken muss. Dabei ist es nur ein Beruf unter Berufen. Und ein Anwalt tut nichts anderes. Er vertritt jemanden. Und versucht, das Beste für ihn herauszuholen. Aber er muss er an die Unschuld seines Mandanten glauben? Den Pastor nur gespielt





























