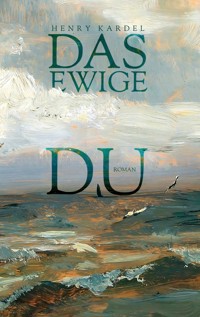Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein stilles Abenteuer. Was sucht man in einer einsamen Hütte im Wald, mitten im Winter, wenn nicht sich selbst?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Teil II
Erste Woche
Zweite Woche
Dritte Woche
Vierte Woche
Epilog
Bibliographie
TEIL I
ERSTES KAPITEL
Sie hatte mich verlassen.
Sie hatte mich verlassen, nachdem sie mir gesagt hatte, dass sie mich betrogen hatte. Und das hatte sie mir gesagt, nachdem ich ihr nichts davon erzählt hatte, dass ich sie ebenfalls betrogen hatte.
Ein halbes Jahr war seitdem vergangen und von meiner kleinen Exkursion aus unserer Beziehung hatte ich ihr noch immer nichts erzählt. Generell hatten wir seitdem, bis auf eine Hand voll Worte, gar keinen Kontakt gehabt. Ich gab es also auf, ihr davon erzählen zu wollen, um keinen weiteren Sand am Meeresboden aufzuwühlen und ihr letztlich damit doch lieber ein Schuldgefühl zu lassen. Dieses Spiel, das ich spielte, war also nicht fair, aber durchaus angebracht, um mich ganz meiner Opferrolle zu widmen. Sie hatte schließlich mich alleine gelassen, nicht andersherum.
Zeitweise war das durchaus komfortabel. Ich hatte endlich wieder etwas zu jammern, nahm den Verlust der Liebe als Rechtfertigung für Mängel, die mir auch sonst schon angelastet wurden.
»Die Hausarbeit über den Begriff der Dianoetischen Tugenden in Aristoteles' Nikomachischer Ethik? Sorry, mein Herz war gebrochen.«
»Dein Geburtstag war gestern? Leider vergessen, du weißt doch, es ist erst sechs Monate her, ich bin noch nicht so weit. Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr.«
»Warum ich mich nicht gemeldet habe? Ich habe melodramatische Briefe verfasst, sie in Tränen getränkt und daraufhin im Klo hinunter gespült. Ich war sehr beschäftigt.«
In jeder Hinsicht war ich ein Nutznießer meines Schicksals, und oh, ich hatte es so vermisst: das Mitleid.
Dass ich meine Opferrolle jedoch einer guten Freundin gegenüber ausspielen würde, war eher unwahrscheinlich. Jana war mir viel zu nah und vor allem nahm sie zu viel Anteil an meiner Situation, als dass ich sie hätte ausnutzen können. Seit Beginn meines Studiums hatten wir einen immer mehr werdenden Kontakt, immer platonisch, so zumindest bisher.
Ich konnte mich erinnern, dass ich ihr zuletzt auf einer Wohnungseinweihung gegenüber saß. Noch so ein Pärchen, das zusammengezogen war, um nun endlich der Routine Platz zu machen. In meinem Umfeld gab es eine Reihe davon und ich beäugte diese Entwicklung immer sehr skeptisch, wenn auch mit ein wenig Neid. Vielleicht war es wirklich die Tatsache, dass sich übergroße Nähe in Beziehungen für mich immer zerstörerisch niedergeschlagen hatte, zumindest auf lange Sicht. Ich vermisste lieber, als genervt zu sein, als mich für eine Sache entflammen zu müssen, für die ich längst erloschen war. Wenn es um romantische Beziehungen ging, war ich wie Feuer und Eis. Aber schließlich würden das nur meine Ex-Freundinnen wissen und ich hatte das Glück, dass diese allesamt weit weg oder vertieft in ihre Karrierelaufbahn waren oder sich einfach nicht in denselben Kreisen tummelten, in denen ich für gewöhnlich unterwegs war.
Mir war das im Prinzip alles egal geworden, auch auf dieser Feier. Die komplette Partygemeinde feierte im Wohnzimmer, nur wir, Jana und ich, saßen in der von Spaß entleerten Küche, dem Sammelbecken aller Melancholiker auf Partys, und immer wieder stolperte mal wieder jemand hinein, nicht zuletzt, weil man die Pizza auf der Küchenzeile und diverse Kisten Bier neben uns deponiert hatte.
Das kalte Küchenlicht blitzte in niedriger Hertzfrequenz auf uns hinab und ich spürte das friedliche Surren des Kühlschranks an meiner Wirbelsäule, da ich mich auf den Linoleumboden gesetzt hatte. Die Bierflasche hielt ich fest in der Hand und sie war so stark gekühlt, dass sie immer wieder kleine Perlen absonderte, die sich ihren Weg über meinen Daumen bis zum Handgelenk suchten. Jana saß ebenfalls auf dem Boden, stütze ihren Kopf an der Platte des Küchentischs und sah, immer wenn sie einen Satz beendet hatte, gedankenverloren zu mir herüber. Das löste ein zwangsläufig wohlwollendes Lächeln in meinem Gesicht aus. Aus unnötiger Verlegenheit folgte dann immer ein Schluck aus der Pulle, sodass sich folglich Flasche für Flasche leerte und man nun wirklich nicht sagen konnte, dass diesbezüglich ein Ende in Sicht war.
Schlimm war das nicht. Ich hatte gut gegessen, fühlte mich halbwegs wohl in meiner Haut, spürte die resonante Welt um mich herum, hatte immerhin jemanden zum Reden. Man konnte wirklich sagen, dass alles halb so schlimm war.
Es brauchte eine Weile, bis sie sich dabei ertappte, wie sie auf einem ihrer Fingernägel herumkaute, dann ließ sie es wieder sein. Sie fuhr mit ihrer Hand durch ihren blonden Zopf, als würde sie etwas darin suchen und wischte dann einen Fussel, sicher war er nur imaginär, von ihrem College-Pullover. Mein wohlwollendes Lächeln war noch immer in mein Gesicht geschrieben, denn es bewahrte mich davor, irgendeinen Ton von mir geben zu müssen. Folglich hatte sich eine ungewöhnliche Stille im Raum breit gemacht.
Sonst hatten wir meist ausschweifende Diskussionen geführt oder Debatten und impulsive Plädoyers über irgendetwas abgehalten und dann, wenn wir nicht schon ins Triviale abgedriftet waren, meist nach Stunden gemeinsame Nenner gefunden. Der Alkohol hatte dabei meist nur als Brandbeschleuniger unserer Thesen gewirkt und ich konnte mir kein besseres Biotop für meine abstrakten Gedanken vorstellen, denn Jana unterbrach mich nur selten. Sie trat keine mentalen Ausflüge oder Ablenker an, wie all die anderen unangenehmen Gesprächspartner. Und wenn ich mich dann um Kopf und Kragen geredet hatte, sodass ich mich selbst nicht mehr verstand, hielt sie mit ihrer Meinung dagegen und hebelte meine Argumentationen nicht selten aus den Fugen. Emotional wurden wir dabei nur in unseren Sichtweisen, aber heute war etwas anders. Sie hatte ihr dickes Fell abgelegt. Und ich? Ich hatte ja nie eins gehabt.
Mir schwebten wieder neue Erkenntnisse vor, über die ich mit ihr diskutieren wollte, denn ich hielt sie für intellektuell, dabei waren es nur wirre Annahmen ohne Hand und Fuß, die sich um Moral drehten. Dennoch hätte ich sie Jana gerne vorgetragen, um sie dann ihren vehementen Einspruch klagen zu hören, der, wenn ich zu Ende geredet hatte, jedes Mal wie ein Blitz, wie der Zeigefinger Gottes auf mich herunter gedonnert kam. Ich mochte das sehr.
Doch heute würde von ihr kein Einspruch, kein Widerspruch, nicht einmal ein einziges einwendendes Wort kommen. Sie würde mich ausreden lassen, nichts leugnen oder negieren, und mir am Ende meines Monologs mit Schweigen antworten, einem Zögern in Selbstvergessenheit. Das wusste ich genau. Ich überlegte einen Moment lang, ob ich überhaupt mit dem Reden anfangen sollte, wenn sie schon nichts erwidern würde, wenn ich letztlich nur zu mir selbst reden würde, doch ich konnte mir einfach keine Antwort geben. Sie hingegen reagierte auf meine Frage, die ich ja nicht einmal ausgesprochen hatte, sondern mir nur gedanklich gestellt hatte. Eine kleine Träne verließ ihr Auge und machte sich auf den Weg hinab, landete in ihrem Mundwinkel, der, da sie sich sehr schnell zu fassen versucht hatte, ein verspanntes Lächeln abgab.
»Ich will nicht mehr...«, meinte sie.
»Was ist denn los?«
»Ich werde mich von ihm trennen. Ja, das werde ich. Ich liebe ihn nicht mehr. Eigentlich habe ich das nie. Nie wirklich. Es war irgendwie immer so leicht, mir das einzureden. Also, dass ich ihn liebe, aber ich will mich nicht weiter anlügen. Ich bin mir einfach schuldig, es zu beenden... Es waren jetzt drei Jahre, und ja, manchmal war es ja echt schön. Aber es ist zu Ende. Einfach zu Ende.«
»Du meinst Steffen?«
»Ja... Aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll... Er ist zu nett.«
Sie gab ihre Fassung auf und fing an zu weinen. Ihre Kehle fing an zu vibrieren, sie kniff sich in die Hände und winkelte ihre Knie an. Ich zog in Betracht, sie in den Arm zu nehmen, sie würde es sicherlich gebrauchen können, aber ich fürchtete mich davor. Ich fürchtete mich davor, diesen unsichtbaren Wall zu durchbrechen, der zwischen uns existierte. Unsere Freundschaft war von einer sachlichen Contenance geprägt, einer unemotionalen Leichtfüßigkeit, jedoch konnte ich mich nun nicht mehr davon überzeugen, dass ich in dieser Lage mit Leichtfüßigkeit fortfahren konnte.
Ich versuchte, einen Mittelweg zu finden und nahm vorsichtig ihre Hand, welche, das merkte ich schnell, ebenso nass von ihrer Bierflasche war wie die meine.
»Ich weiß nicht, was ich dir sagen oder erzählen soll«, meinte ich. »Wenn du ehrlich zu dir selbst bist und das dein Resultat ist, dann könnt ihr beide daran nichts ändern. Es ist wohl nicht so, als würde man was Schönes daraus machen können, manchmal ist das ja so, manchmal braucht es ja nur eine andere Perspektive, aber hier... Musst du einfach machen. Dein Herz ist nicht mehr bei der Sache. Also musst du es machen.«
»Ich hatte ja schon lange gehofft, dass er eine Affäre anfängt oder so. Dann hätte ich wenigstens einen guten Grund gehabt. Ich meine, ich habe schon selbst versucht, ihn zu verkuppeln. Hat aber nicht geklappt.«
Ich konnte mein unbeherrschtes Grinsen nicht verbergen. Sie erwiderte es, wenn auch mit Schwermut.
»Danke, Adrian. Die Sache wurde mir gerade sowieso viel zu rührselig. Gefühle sind für arme Menschen.«
»Jana, du hast mich gerade zum ärmsten Menschen der Welt gemacht. Ich finde Leute arm, die keine Gefühle haben.«
»Das ist kitschig! Purer Kitsch ist das!«, womit sie durchaus recht hatte. Da ich aber noch immer an Iona hing, musste ich meine These verteidigen.
»Glaubst du, dass sich die menschliche Spezies auch ohne Gefühle vermehren würde? Meinst du nicht, dass Begehren notwendig für die Fortpflanzung ist? Kollege Schopenhauer, und ich bin, weiß Gott, kein Fan von ihm, war doch genauso der Ansicht, dass die Liebe eine List der Natur sei. Zur Erhaltung der Spezies.«
»Du hast gerade versucht, dein romantisches Weltbild mit einem der herzlosesten Menschen, der je existiert hat, zu unterfüttern.«
Das machte mich äußerst unzufrieden.
»Was ich nur sagen wollte... Es geht nicht ohne!«
»Mein lieber Freund, da verwechselst du aber was. Du verwechselst Gefühle mit Begehren.«
»Ist Begehren kein Gefühl?«
»Bei Rosamunde Pilcher mag Begehren ja ein Gefühl sein, aber nicht im wahren Leben. Begehren ist triebhaft, ganz zwangsläufig. Aus der Rolle kommen wir nicht raus. Und manchmal, da habe ich sogar Steffen begehrt, ganz ohne ihn zu lieben oder romantische Gefühle oder so etwas Komisches für ihn zu hegen.«
»Sind wir da nicht praktisch einer Meinung? Ich meine, ich bin kein Freund davon, alles auf Triebe zu schieben, das ist gefährlich, das würde bedeuten, dass wir nicht für uns verantwortlich sind. Ich bin aber dennoch der Überzeugung, dass wir ein reflektierfähiges Bewusstsein haben und uns, wenn es darauf ankommt, anders entscheiden können...«
Sie unterbrach mich: »Können wir das wirklich?«
Ich stöhnte genervt, da wir in einer philosophischen Kerbe festsaßen: »Die alte Leier um den freien Willen...«
Eine Sache wurde uns sofort klar. Es gab Menschen, die waren ihrem Trieb chancenlos ausgeliefert. Lorenz, der schlanke Lulatsch aus den Agrarwissenschaften, kam hereingetaumelt und stürzte sich zielsicher auf die beiden Familienpizzen.
»Ohhh, jaaa... Schinken, baby! Oaahh, geil...«
Sein Kiefer hatte sich bereits tief in den Teig gestanzt, als er uns im Augenwinkel erspähte. Seine knappe und einfältige Aufmerksamkeit richtete sich auf uns, was zur Folge hatte, dass ein Stück des guten italienischen Schinkens in seine Armbeuge fiel. Alle Anwesenden wussten um die längst verlorene und unwiederbringliche Eleganz, die Ästhetik, die gerade zu Boden gefallen war, wobei doch fraglich blieb, ob es in Lorenz' Gegenwart je so etwas wie Grandezza gegeben hatte.
Beherrscht schlich er sich wieder hinaus, zurück in den Lärm und die Blitzlichter und ich wusste nicht genau, ob er entweder so dermaßen wegen seinem Missgeschick tippelte, oder weil er dachte, dass er uns in einem ungünstigen Moment erwischt hätte.
Jedoch stellte ich fest, wie schwer es mir fiel, mich ausgelassen darüber zu amüsieren. Es war eine erschreckende Erkenntnis, dass es schon einige Zeit her war, dass ich wirklich befreiend gelacht hatte. Kein Lachen, das sich an einer Pointe oder an Situationskomik erfreut, sondern eine Bejahung, ein bekräftigendes Signal, intrinsisch und verinnerlichend zugleich, annehmend und erwidernd. Ein Lachen, das nichts zurücklässt, ein Widerhall, eine Antwort, adressiert an das Leben. Doch eine nicht zu begreifende Schwere hatte sich auf meine Mundwinkel gelegt und ich befürchtete, dass diese unbändige Trauer in mir ziellos war.
Ich dachte an Iona.
Wo sie jetzt wohl war? Würde sie womöglich gerade ein romantisches Dinner in Zweisamkeit verbringen? Mit einem Anderen schlafen? Vielleicht nur schlafen? Würde sie vielleicht spazieren? Arbeiten? Selbstvergessen am Strand sitzen? Feiern? Nachdenken? Womöglich an mich? Vielleicht sogar wirklich an mich?
Es gab diese Möglichkeit. Aber ich wusste ja irgendwie, dass es dumm war, sich das zu fragen. Bisher hatte jeder Mann seinen Verstand daran verloren, herauszufinden, was seine Verflossene gerade tat. Die andere Möglichkeit war, dass er zum Stalker wurde, wobei das weniger ein geschlechtsspezifisches Problem war, so glaubte ich zumindest. Es war eher eine Frage der aufflammenden Verliebtheit, die in dem Moment ein letztes Mal aufkeimte, als man jemanden verloren hatte. Und selbst wenn man denjenigen gar nicht mehr liebte: Wenn man verlassen wurde, dann war das mies, weil es irgendwie bedeutete, dass man die Kontrolle (die man sowieso nie hatte) verloren hatte. Einem wurde schlicht und einfach die Entscheidung abgenommen, ob man weiterhin zusammenbleiben würde.
Jedoch hatte ich Iona noch immer geliebt, als sie mich verlassen hatte. Umso schlimmer fühlte es sich an, dass ich die Antwort auf meine Frage, was sie denn gerade tat, nicht ergründen konnte. Wir wussten ja nichts mehr vom Anderen. Wenn ich sie danach gefragt hätte, hätte ich sicherlich keine Antwort bekommen und so blieb mir ja nur noch die letzte Möglichkeit: vom allerschlimmsten auszugehen.
Das war ein guter Grund, um den Gedanken an sie wieder aufzugeben. Und das, obwohl ich wusste, dass sie mich noch immer lieben würde. Das spürte ich und der Zweifel hatte es in dieser Frage ziemlich schwer. Sie liebte mich noch immer, jawohl. Aber sie wollte es nicht. Sie wollte alles andere, aber nicht das. Sie wollte keine Fernbeziehung, keinen, der nicht mindestens zwanzig Zentimeter größer war als sie und schon gar keinen gutgekleideten, aber romantischen Loser. Aber sie wollte noch immer mich.
Und wenn es still oder einsam um sie herum wurde, dann würde sie kurz an mich denken und sich dabei widerlich fühlen. Widerlich, weil sie einerseits nicht wusste, wie sie je mit so einem fragwürdigen Menschen wie mir zusammen sein konnte, oder widerlich, weil sie wusste, dass etwas sehr Intensives zerbrochen war. Ich wiederum wurde das Gefühl nicht los, dass es bedrohlich oder gar pathologisch werden konnte, sie nicht bei mir zu haben. Noch viel schlimmer die Annahme, dass ich sie eigentlich nie verdient hatte. Ich war am Verdursten, auf Entzug, die Liebe hatte mich unterzuckert.
War das wirklich ich? Derjenige, der zuvor noch gepredigt hatte, nicht auf Exklusivität zu bestehen? Sich nicht romantischen Illusionen hinzugeben? Derjenige, der die Liebe von den Zwängen moderner Gesellschaften und den utopischen Idealen der Romantik befreien wollte?
Ja, das war ich. Ich hatte mich ergeben. Hatte die Waffen niedergelegt. Ich hatte die Kriegserklärung an die Welt, die man nur verliebt vollzog, zurückgezogen. Zurückgezogen im Moment des Verlusts.
Ich hatte Iona verloren, das hatte ich wirklich. Und jedes Mal, als ich mir ein Bild von ihr ansah, verlor ich sie aufs Neue. Jeder hatte so seine wunden Punkte und an manchen Tagen regnete es Salz. Die Liebe war wunderbar einfach, bis sie einen selbst traf.
»Ich werde Kiel verlassen.«
Das hatte ich soeben beschlossen.
»Wie meinst du das?«, sagte sie. »Verlassen? Willst du woanders studieren?«
»Nein, ich denke nicht...«
»Und wo willst du bitte dann hin?«
Ich dachte kurz nach.
»Eine gute Frage. Eine wirklich sehr gute Frage. Irgendwohin, wo ich atmen kann. Ich weiß auch nicht, wo das sein soll. Meine Zeit in Kiel ist wie ein Zimmer, das man seit Jahren nicht mehr gelüftet hat. Ich will nicht länger hierbleiben.«
»Aber Adrian... Das kannst du doch nicht einfach machen...« Ihre sich fortsetzende Traurigkeit schwängerte die Luft mit betretendem Schweigen. Ich nahm den Faden wieder auf, den sie hatte fallen lassen.
»Ich muss mich einfach auf den Weg machen, weißt du? Einfach nur, um unterwegs zu sein. Ich halte mich auch sonst selbst nicht mehr aus. Meine Wehmut und mein Selbstmitleid, es dreht sich alles nur noch im Kreis. So konkret habe ich es dir ja nie erzählt, aber ich kann Iona einfach nicht vergessen. Es raubt mir Kraft. Es raubt mir die Freude. Und ich weiß nicht, ob es je besser wird, aber mir reicht es, wenn es einfach nur anders wird. Verstehst du das?«
Sie rümpfte ihre zierliche Nase.
»Also willst du vor allem weglaufen?«
»Hör mal, das ist doch kein Weglaufen. Es ist etwas Neues. Ich fange etwas Neues an. Ich meine, wenn ich eine neue Beziehung hätte, würdest du dann auch sagen, dass ich ja eigentlich nur vor meiner letzten Freundin weglaufe?«
»Du hast eine neue Beziehung?«, fragte sie.
»Nein, nur ein Beispiel.«
»Aber Adrian, du bist deinen Problemen nie wirklich begegnet. Du hast das einfach immer weggeschoben und dann war die Sache für dich geklärt. Du willst hier weg, ehe du überhaupt wirklich Fuß gefasst hast?«
»Ich studiere hier jetzt seit zwei Jahren...«
»...aber auf Leerlauf! Was hast du denn zustande gebracht? Es ist dir ja schon allein schwer gefallen, den minimalen Aufwand, der von dir verlangt wurde, zustande zu bringen. Erinnerst du dich an die idiotensicheren Semesterprüfungen? Du wärst beinahe durchgerasselt! Adrian, ich will nicht, dass das böse klingt, aber du musst erwachsen werden.« Das war ein harter Schlag... Zweifellos forderte er Gegenwind.
»Fällt dir eigentlich gerade auf, dass du die engstirnigen Argumente unserer Elterngeneration verteidigst? Was bedeutet für dich Erwachsensein? Sesshaft werden? Ein geregeltes Einkommen? Sicherheiten? Als würde sich alles mit Sicherheit oder Stabilität lösen lassen. Wenn etwas Neues entstehen soll, dann darf es aber überhaupt keine Stabilität oder Beständigkeit geben. In dem Moment, in dem etwas nicht mehr planbar oder voraussagbar ist, in dem Moment, in dem es destabilisiert wird, fängt die Veränderung an. Das wird dir jeder Wissenschaftler attestieren können. In vollkommener Stabilität gäbe es nicht einmal ein Universum!«
Es fiel mir schwer, meinen ungegorenen Einfall zu verteidigen, ich hatte ihn ja selbst noch nicht überdacht. Mein Argumentationspolster war dünn, jedoch war die Sache mit der Stabilität nicht aus der Luft gegriffen. Vor allem aber wollte ich einfach nicht mehr hören, dass ich erwachsen werden müsste. Das hatte ich schon öfter gehört, meist von Leuten, die meinten, Erwachsenwerden wäre nichts anderes als das Generieren von Arbeitskraft, aber etwas Derartiges von Jana zu hören, das war schwer. Ich hatte sie für eine Befürworterin meines Lebensstils gehalten, wenn man ihn denn so nennen konnte. Ich wusste zwar, dass wir in etwa gegenteilige Charaktere besaßen, verschiedene Vorstellungen von der Welt hegten und unsere Leben verschieden führten, aber ich hatte geglaubt, dass es so etwas wie Konträrfaszination gab. Den Bedarf, sich eine Scheibe vom Gegenüber abzuschneiden oder doch zumindest die Andersartigkeit des jeweils Anderen zu schätzen.
In der Hinsicht war mir ihr Freund, oder bald Ex-Freund, Steffen deutlich näher. Wir beide besaßen eine gewisse Nachlässigkeit was Pflichten anbelangte und einen Hang zum studentischen Hedonismus. Aber darum ging es nicht. Charakterlich gab es an ihm nicht viel zu entdecken oder auszutauschen, deswegen war ich lieber mit Jana befreundet.
Aber genau das war ja auch die Gefahr. Sie würde mir öfter unangenehme Dinge sagen. Würde sich nicht davor scheuen, mir den Spiegel vorzuhalten, wenn ich es denn mal nötig hatte. Sie würde ehrlich zu mir sein und bisher war das auszuhalten, sie hatte sich zu meinen Fehlbarkeiten und Unzulänglichkeiten, bis auf kleine Andeutungen, weitestgehend nicht geäußert. Aber was bedeutete das alles nun für mich? Hier und jetzt?
Im Prinzip war es ganz einfach: Ich war ein Trotzkind. Und das hieß: Ich würde Kiel verlassen.
Wenn sie mir auf die Schulter geklopft hätte und gesagt hätte, wie toll sie die Idee fände, dann hätte ich es mir sicher noch einmal überlegt, so gut hätte die Idee dann ja nicht sein können. Aber jetzt ging es ja nicht mehr anders, sie hatte mir die Wahl abgenommen und ich redete mir ein, dass es ein gutes Zeichen für meinen Einfall war, dass sie ihn per se ablehnte.
Ich nahm zwei Flaschen Bier in die Hand und gab die eine an Jana weiter. Die andere behielt ich und nahm mir vor, dass es die letzte sein würde. Ich spürte, dass es sonst schwer werden würde, weitere Diskussionen unversehrt zu überstehen. Das würde aber keinesfalls bedeuten, dass es wirklich die letzte war, dieses imaginäre Trinkembargo war lediglich eine Empfehlung an mich selbst, höchstens die Einleitung zum Aufhören, aber kein striktes Verbot. Ich kannte mich gut genug. Ich forderte Jana fast andächtig zum erneuten Zuhören auf.
»Vielleicht verstehst du es ja doch noch...«, was sie ein bisschen mit Unmut erfüllte. Es gefiel ihr sicher nicht, dass ich so tat, als sei sie die Uneinsichtige.
»Wie soll ich es sagen? Nun... Es fällt mir ein bisschen schwer, das auszusprechen... Wir reden ja sonst nicht so intim... Noch nie hatte ich in meinem Leben so wenig zu verlieren, so fühlt sich das an. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich an nichts mehr wirklich hänge. Ich war sonst immer derjenige, der verliebt in das Leben war und über einen unendlichen Antrieb verfügte, wenn es ums Lieben oder Leiden ging. Es war egal, wie stark der Strom war, gegen den ich schwamm, ich habe es irgendwie hinbekommen. Du weißt von all den Liedern, die ich geschrieben habe. Sie sind nichts weiter als ein Ausdruck dessen. Doch jetzt habe ich ein Problem. Mir ist der Treibstoff ausgegangen. Es hat sich herausgestellt, dass mein ewiger Antrieb endlich ist. Ich habe Iona verloren und muss nun feststellen, dass so viel nicht übrig bleibt. Nichts, worauf ich stolz sein könnte. Nichts, mit dem ich wirklich leben wollte. Und nichts, was mich bis zum Äußersten schmerzen würde, wenn ich es verlieren würde.« Ich räusperte mich kurz und fuhr dann fort: »Ich kann es verstehen, wenn das schwer nachzuvollziehen ist, aber ich bin komischerweise darauf angewiesen. Auf einen Wechsel... Ich brauche eine Herausforderung. Und nun mal ganz ehrlich, die kann ich hier nicht finden. Kiel ist nett, aber einfach nicht das, was ich mir vorstelle, wenn ich an ein intensives Leben denke. Ich denke mal, es würde gefährlich für mich werden, wenn ich all diesen Enthusiasmus, den ich einmal hatte, nicht wiedererlangen könnte. Ich will mich einfach nur wieder, und auch wenn es mein letzter Versuch ist, in das Leben verlieben. Und wenn du jetzt sagst, dass ich ein hoffnungsloser Romantiker bin, dann bekenne ich mich im Sinne der Anklage für schuldig...«
Obwohl selbst ich mich nach meiner triefenden Ansprache wie die Personifizierung des Kitsches selbst fühlte, berührte es sie. Ja, und damit meine ich nicht nur ein bisschen. Sie musste die Tränen mit großer Anstrengung zurückhalten, es wäre an diesem Abend schließlich nicht das erste Mal gewesen. Das war für Jana ein neuer Rekord, denn ich hielt sie einst für einen dieser Menschen, bei denen man sich nicht sicher war, ob sie überhaupt über Tränendrüsen verfügten. Doch nun war ja der Beweis erbracht und immerhin wusste ich, dass emotionale Tränen eine andere chemische Zusammensetzung hatten, als die gewöhnlichen Tränen zum Befeuchten oder Schützen des Auges. Unter den Bestandteilen befand sich unter anderem auch Serotonin. Und gab es etwas Schöneres? Zu wissen, dass man beim Weinen ein Glückshormon ausschüttete?
»Was ist deine größte Hoffnung im Leben?«, fragte ich sie, um einen neuen Ansatz, einen neuen Zugang zu ihr zu finden. Zugegeben, eine nicht ganz simple Frage, wo doch Hoffnung eigentlich immer nur der Ausdruck von Optimismus sein konnte. Ich meine, was hätte ein Pessimist darauf geantwortet? Es war fraglich, ob Pessimisten überhaupt über Hoffnungen verfügten. Vielleicht höchstens über solche, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso erfüllen ließen, stoische Hoffnungen sozusagen. In unserer Zeit war das ja genau umgekehrt. Wir passten unsere Wünsche nicht mehr der Realität an, sondern die Realität unseren Wünschen, was, wie wir schließlich alle wussten, katastrophale Folgen hatte.
Um zurück auf Jana zu sprechen zu kommen, sie war mit Sicherheit keine Pessimistin. Sie war abgeklärt, aber nicht desillusioniert, was sich auch darin zeigte, dass sie sich außergewöhnlich viel Zeit für ihre Antwort nahm. Pessimisten erkannte man daran, dass sie einem schon nach dem Bruchteil einer Sekunde das Wort Hoffnung auseinandergenommen und um die Ohren gehauen hatten.
»Ahm... Ja, ich weiß nicht... Vielleicht die Hoffnung auf Anerkennung oder so? Wieso fragst du?«
»Weil meine Hoffnung eine andere ist... Meine größte Hoffnung im Leben ist die Möglichkeit zur Veränderung. Es ist die größte und gleichzeitig letzte Hoffnung, die mir bleibt. Dass es noch andere Perspektiven gibt, schließe ich ja nicht aus, aber solange ich die nicht sehe, muss ich mit dem leben, was ich habe. Verstehst du? Für mich ist es einfach die größtmögliche Sicherheit, die Möglichkeit zu haben, den Ort, an dem ich mich gerade befinde, zu verlassen, um aufzubrechen und mir einen neuen Horizont zu suchen. Für viele mag das ja eine Unsicherheit sein, die Gefahr entwurzelt zu werden, aber ich sehe das ganz anders. Diese Möglichkeit generiert dir tausend zweite Chancen...«
»Also hast du das Gefühl, versagt du haben?«
»Was meinst du?«
»Na, wenn du eine zweite Chance brauchst? Vielleicht würde es einfach reichen, wenn du dir selbst vergibst. Meinst du nicht?«
Sie hatte mit ihrer spontanen Analyse ziemlich ins Schwarze getroffen und damit sicherlich eine tiefe Wahrheit ausgesprochen und ich bestritt das keineswegs, jedoch reichte das Wissen darüber nicht aus. Was nützte das Wissen über den Klimawandel, wenn man nichts gegen ihn tat? Was nützte das Wissen über Kriege, wenn man sie noch immer führte? Was nützte das Wissen über Mitgefühl, wenn man sich doch nur hasste? Was nützte das Wissen darüber, dass man jemanden nicht mehr liebte, wenn man noch immer mit ihm zusammen war? Was nützte das Wissen, jemanden noch immer zu lieben, wenn man kein Wort mit ihm wechselte?
Der Mensch hatte diese wundersame Fähigkeit der Doppelmoral, die Fähigkeit gegen sein Wissen oder gar gegen seine ihm eigenen Überzeugungen zu handeln. Da war ich nicht anders. Ich wusste, dass die Lösung dieser Sache ganz woanders liegen musste, aber Kiel verlassen wollte ich noch immer. Und ich wusste, dass ich Iona noch immer lieben würde, aber mit ihr reden würde ich dennoch nicht.
Ich versackte für einige Zeit im Schweigen und Jana verstand wieso.
»Was würdest du davon halten, wenn ich mitkomme?«
»Bitte was?!«
Mit einem verheißungsvollen Lachen gab sie ihrer mutigen Frage etwas Nachdruck.
»Na ja, ich bin gerade dabei, meinen Freund zu verlassen. Eine Abwechslung wäre also ziemlich nice. Du weißt schon, wem gehört dies, wem gehört das, hol doch bitte deine Sachen von mir ab, aber nur, wenn ich nicht zuhause bin und so weiter. Auf den Kram habe ich keine Lust. Und ich weiß ja nicht, wo du hinwillst, aber das wäre mir sowieso relativ egal.«
»Also erst einmal: Dir ist klar, dass Steffen denken wird, dass wir beide miteinander durchbrennen, oder?«, sagte ich.
Darüber mussten wir dann beide lachen, wir wussten, dazu würde es nicht kommen.
»Soll er doch. Ich fände es eigentlich ganz lustig, wenn er das glauben würde. Will man seinem Ex-Freund tendenziell nicht immer eins auswischen?«
Ich kannte das sehr gut, tat aber lieber so, als wären mir die Verhaltensauffälligkeiten von frisch Getrennten vollkommen fremd. Ein bisschen übertrieb ich es mit dem Abstreiten, damit sie wenigstens die Chance hatte, zu erkennen, dass ich ihr im Grunde zustimmte.
»Also, was meinst du? Kannst du dir das vorstellen?«
Das war nicht die Frage, dachte ich, meine Fantasie war ziemlich rege. Aber, ob ich das wirklich wollte, das stand auf einem ganz anderen Blatt. Sollte ich das denn wirklich riskieren?
Zugegeben, ich hatte immer davon geträumt. Die Vorstellung kam mir als Romantiker sehr entgegen, selbst wenn man nichts miteinander am Laufen hatte. Ich sah uns praktisch schon in Zugabteilen philosophieren, irgendwo da draußen, in Städten, dessen Namen wir nicht kannten, draußen an der Küste, an stürmischen Tagen.
Auf der anderen Seite bot eine solche Konstellation eine große Angriffsfläche für Konflikte jeglicher Art. Mann und Frau ganz platonisch? Spätestens seit Harry und Sally wussten wir zwar nicht von der Unmöglichkeit platonischer Beziehungen zwischen Mann und Frau, aber zumindest von der Schwierigkeit, dass nicht wenigstens einer der Beteiligten in den Sog des Konjunktivs kam, des Konjunktivs des Was wäre wenn...?. Das führte wohl immer zu einer schnellen Idealisierung der Umstände, weil die Freundschaft als Institution (die ja strenggenommen keine war, da sie rechtlich nicht geregelt war), Optimierungs- und Maximierungszwängen nicht so stark ausgeliefert war, wie alle anderen Arten der persönlichen Beziehungen.
Die Annahme, man könnte den Anderen problemlos vom besten Freund zum Geliebten machen, war mindestens naiv, wenn nicht sogar fahrlässig. Vor allem war schon immer das Zerbrechen einer Liebesbeziehung wahrscheinlicher gewesen, als das Zerbrechen einer Freundschaft. Ich wusste nicht genau, woran das lag. Vielleicht an der stärkeren Nähe. Doch war klar, dass danach nichts wie vorher werden würde. Man kannte sich zu gut. Aber das musste man alles in allem überblicken können, das war kein Grund, es nicht zumindest zu versuchen. Manche Fehler waren da, um sie zu machen.
Andererseits war es etwas fundamental anderes, zu zweit zu verreisen, ich kannte das von vorigen Reisen. Es hatte doch immer das Potenzial vermindert, an einer Reise wachsen zu können. Das lag wahrscheinlich daran, dass man einen Teil seiner Komfortzone einfach mitnahm. Vor allem wusste ich nicht, wo ich mit dieser ganzen Nummer am Ende landen würde. War es da gut, noch jemanden mitzunehmen?
Letztlich blieb mir aber doch nichts anderes übrig, als zuzugeben, dass ich recht angetrunken war und mir trotz allem klar wurde, dass ich Jana doch ganz gern hatte. Der Sprung zur Zusage fiel mir sehr leicht.
»Jo, lass machen.«
»Sehr schön, Adrian! Für wie lange hast du dir das denn vorgestellt?«
Ich stutzte.
»Jana, ich weiß nicht, ob du mich wirklich richtig verstanden hast. Wenn es nötig ist, dann für immer.«
»Für immer? So richtig für immer? Oder nur so ein bisschen für immer?«
»Ich denke, die Natur des Wortes ist eindeutig genug.«
Sie musste kichern. Ich konnte nicht recht einschätzen, ob sie es nun ernst meinte, oder ob das nur eine verspielte Laune einer angetrunkenen Psychologie-Studentin war. Dass sie sich wieder mäßigte, beruhigte mich nur bedingt.
»Ist okay. Mal sehen, wie lange ich das durchhalte.«
»Das möchte ich aber auch wissen.«
»Meinst du, wir verlieben uns ineinander?«
Ich verschluckte mich an meinem Bier. Das war eine gefährliche Frage und eine geschlossene dazu. Eine Frage, auf die es im Grunde keine beruhigende Antwort gab. Wer sie stellte, der wollte einen wirklich herausfordern. Man musste sich ja nur mal beide Antwortoptionen anhören:
»Option Nummer eins: Ja, wir verlieben uns in einander! Aber muss man eine Freundschaft auf so hässliche Art und Weise enden lassen? Widerlich!«
»Option Nummer zwei: Nein, wir verlieben uns nicht ineinander. Von dir geht zu wenig körperliche Anziehungskraft aus, ach ja, blond ist auch nicht so mein Ding, brünett müsstest du schon sein. Darüber ließe sich reden, aber so, um Gottes Willen! Da könntest du genauso gut Ethnopluralistin sein!«
Das klang beides nicht so sonderlich prall. Ich musste ausweichen oder darauf hoffen, dass sie die Antwort am nächsten Tag, vom Kater geplagt, vergessen hatte.
»Ich weiß nicht, man weiß das nie... was die Zeit so mit einem macht...«, antwortete ich.
»Geh' in die Politik mit deinen Phrasen! Du kannst sprechen, ohne was zu sagen«, wobei ich mir sicher war, dass sich kein Machtpolitiker getraut hätte, Ich weiß nicht zu sagen.
»Ach Jana, ich werde langsam müde...«
»Das senkt die Chancen aufs Verlieben, denke ich, wenn ich jedoch Lethargie in dir auslöse, dann sollten wir doch am besten heiraten! Die besten Chancen auf eine lange Ehe hat man, wenn man sich entweder verabscheut oder zu Tode langweilt. Weißt du, diese tollen Pärchen, die, bei denen man sagt: Wow, die hätten wirklich zueinander gepasst, die sind meist nach einem Monat wieder auseinander, aber die Ehen dieser cholerischen Frankenstein-Paare, die halten ewig! Da kannst du machen, was du willst, die bekommst du nicht auseinander!«
»Du willst sagen, eine starke Liebe ist keine gute Voraussetzung für eine Ehe?«
»Meine Güte, nein! Das ist die denkbar schlechteste Voraussetzung! Wenn man sich wirklich liebt, dann verzehrt man sich und dann bleibt nichts mehr übrig. Die Ehe wurde als Zweckbündnis erfunden oder zumindest war sie das die meiste Zeit, die Liebesheirat hingegen gibt es noch nicht so lange. Man wollte doch vorher einfach das Hab und Gut sichern, das war so praktischer. Und denke nur mal daran, für wie lange man sich heutzutage aushalten muss, wir werden ja mittlerweile neunzig Jahre alt, wer will da noch mit zwanzig heiraten?«
»Halte mich für einen Romantiker, aber die Ehe verteidigen werde auch ich nicht«, antwortete ich ihr.
»Das überrascht mich allerdings.«
»Auch von Bestimmung halte ich nichts. Komm mir bloß nicht mit so etwas wie Platons Kugelmenschen, darauf basiert leider das komplette romantische Ideal. So kühl das auch klingt, die Welt bewegt sich in Kausalitäten, wenn sich jedoch zwei Kausalitätsketten treffen, so mag das für uns zwar erstaunlich sein, aber im Grunde ist es nicht anderes als begründbar. Was nicht heißt, dass wir den Grund für alles finden können, aber sicherlich gibt es ihn. Das führt uns letztlich zu der ältesten aller Fragen: Wer ist der Urbeweger, der Erstbeweger? Da habe ich letztens eine Sendung mit Harald Lesch gesehen. Er meinte...«
»Du bist eine unheimlich schizophrene Persönlichkeit! Einerseits willst du Romantiker sein, andererseits raubst du der Welt mit deiner Philosophie den Zauber. Entscheide dich doch endlich!«
»Nein, nein. Das, liebe Jana, ist der bedeutende Unterschied zwischen Kitsch und Romantik. Das kannst du als Zynikerin wahrscheinlich schlecht voneinander unterscheiden. Das ist so, als würdest du Melancholie mit Depression gleichsetzen.«
Sie gähnte, kippte dann aber einen kühlen Schluck Pils hinterher. Sie hatte ihre Flasche gerade abgestellt, da öffnete sich die Tür und etwas laute Musik wehte aus dem Wohnzimmer hinüber. Herein kam Friedrich, der Vater von Sinah.
Sinah war diejenige, die zusammen mit Bennet die ganze Feier schmiss. Die beiden hatten sich beim Geowissenschaftsstudium kennengelernt und relativ schnell eine Schwäche füreinander entwickelt. Ich hoffte wirklich, dass ihre Beziehung noch eine Weile halten würde, denn die beiden stellten im Prinzip genau eine solche Art Pärchen dar, die Jana gemeint hatte, als sie von denjenigen gesprochen hatte, die gut zusammenpassen würden, aber nach einem Monat bereits wieder getrennte Wege gingen.