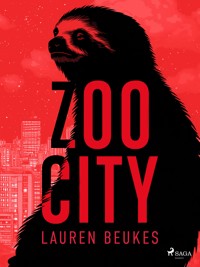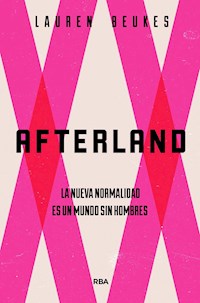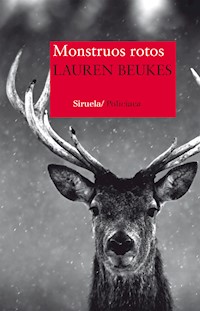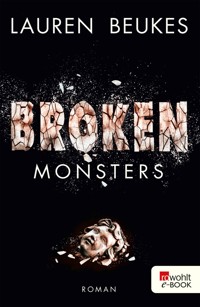
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Detroit – Symbol für den Tod des American Dream. Zwischen Industrieruinen und Kunstprojekten geschieht Grässliches. Menschen werden ermordet und zu «Kunstwerken» arrangiert: ein Junge mit menschlichem Oberkörper und den Beinen eines Rehs. Eine Keramikkünstlerin als grausige Tonskulptur. Detective Gabriella Versado hat schon vieles gesehen, doch so etwas noch nie. Sie ahnt nicht, dass sie es mit einem Monster zu tun hat – mit jemandem, der von dem brutalen Traum besessen ist, die Welt nach seiner Vision neu zu erschaffen. Und der vor nichts zurückschreckt, um diesen Traum wahr werden zu lassen. «Niemals weniger als absolut fesselnd.» (Val McDermid) «Furchterregend und hypnotisch. Ich konnte es nicht aus der Hand legen – an Ihrer Stelle würde ich es mir sofort besorgen und lesen!» (Stephen King) «Im Ernst: Was für eine brillante Krimi-Phantasmagorie!!!! Dieser umwerfende Roman ist das neue Standardwerk zum urbanen Verfall. Jetzt lesen!» (James Ellroy) «Im allerbesten Sinne verstörend … Eine Serienkillergeschichte, wie es sie noch nie gegeben hat.» (Kirkus Review) «Ein durchtrieben fieser Thriller, der wie wenige andere den Leser zum Nachdenken bringt.» (Telegraph) «Ein überragender Roman, voll lebendiger Figuren und fesselnder Dialoge.» (Times UK) «Nie voyeuristisch, nie oberflächlich, nie unkompliziert: Beukes zeigt, dass Horror der einzig mögliche Weg sein kann, unsere Realität begreifbar zu machen.» (The Guardian) «Ein ungewöhnlicher und packender Thriller.» (Sunday Express) «Ein grauenerregender Spannungsroman, der die Opfer in den Mittelpunkt stellt.» (Marie Claire) «Wie ein Ermittlerkrimi auf Halluzinogenen – brutal und hoch unterhaltsam.» (Evening Standard) «Beukes ist eine unwiderstehliche Erzählerin, die starke Figuren erschafft.» (Metro)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Lauren Beukes
Broken Monsters
Roman
Über dieses Buch
Detroit – Symbol für den Tod des American Dream. Zwischen Industrieruinen und Kunstprojekten geschieht Grässliches. Menschen werden ermordet und zu «Kunstwerken» arrangiert: Ein Junge mit menschlichem Oberkörper und den Beinen eines Rehs. Eine Keramikkünstlerin als grausige Tonskulptur. Detective Gabriella Versado hat schon vieles gesehen, doch so etwas noch nie. Sie ahnt nicht, dass sie es mit einem Monster zu tun hat – jemand, der von dem brutalen Traum besessen ist, die Welt nach seiner Vision neu zu erschaffen. Und der vor nichts zurückschreckt, um diesen Traum wahr werden zu lassen.
«Niemals weniger als absolut fesselnd.» (Val McDermid)
«Furchterregend und hypnotisch. Ich konnte es nicht aus der Hand legen – an Ihrer Stelle würde ich es mir sofort besorgen und lesen!» (Stephen King)
«Im Ernst: Was für eine brillante Krimi-Phantasmagorie!!!! Dieser umwerfende Roman ist das neue Standardwerk zum urbanen Verfall. Jetzt lesen!» (James Ellroy)
«Im allerbesten Sinne verstörend … Eine Serienkillergeschichte, wie es sie noch nie gegeben hat.» (Kirkus Review)
«Ein durchtrieben fieser Thriller, der wie wenige andere den Leser zum Nachdenken bringt.» (Telegraph)
«Ein überragender Roman, voll lebendiger Figuren und fesselnder Dialoge.» (Times UK)
«Nie voyeuristisch, nie oberflächlich, nie unkompliziert: Beukes zeigt, dass Horror der einzig mögliche Weg sein kann, unsere Realität begreifbar zu machen.» (The Guardian)
«Ein ungewöhnlicher und packender Thriller.» (Sunday Express)
«Ein grauenerregender Spannungsroman, der die Opfer in den Mittelpunkt stellt.» (Marie Claire)
«Wie ein Ermittlerkrimi auf Halluzinogenen – brutal und hoch unterhaltsam.» (Evening Standard)
«Beukes ist eine unwiderstehliche Erzählerin, die starke Figuren erschafft.» (Metro)
Vita
Lauren Beukes wurde 1976 in Johannesburg, Südafrika, geboren. Sie arbeitet als Autorin und Journalistin und schreibt Romane, Graphic Novels und Drehbücher. Heute lebt sie zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Kapstadt.
Die Autorin begeisterte mit ihren ersten beiden Romanen «Zoo City» und «Moxyland» das Feuilleton im englischsprachigen Ausland und gewann einen der beiden renommiertesten internationalen Sci-Fi-Literaturpreise – den Arthur C. Clarke Award – für ihr Werk.
Weitere Veröffentlichungen
Shining Girls
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel «Broken Monsters» bei HarperCollins, UK.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juni 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Broken Monsters» Copyright © 2014 by Lauren Beukes
Redaktion Jan Möller
Umschlaggestaltung und Motiv
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, Kim Becker
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream Inc.
ISBN 978-3-644-54261-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Sonntag, 9. November
Bambi
Last Night A DJ Saved My Life
Unter dem Tisch
Die Tochter des Detectives
ZUVOR: Traverse City
Montag, 10. November
Detroit Diamonds
Notizen auf dem Whiteboard
ZUVOR: Kunstgeschichte
Linien
Nieten und Löcher
Dienstag, 11. November
Narbengewebe
Die Haut, in der man steckt
Irgendwoland
Die Kreativen
Höhere Macht
Fischen für Fortgeschrittene
Das Spiel
Mittwoch, 12. November
Ermittlungen in alle Richtungen
Mit offenem Visier
Ausgestopft
Faygo und eine Knarre
Legaler Stoff
Der Mann, der die Welt verschlang
Botanica
Ummauerte Gärten
Donnerstag, 13. November
Ganz weit offen
Lockvogel als Hauptgang
Winterlilien
Käseträume
Freitag, 14. November
Knusperhäuschen
Alles scheiße
Opferkunde
Wie es kommen muss
Samstag, 15. November
Wie ein Geheimnis schmeckt
Hören und Sehen
Hühnerstall
Partyvolk
Unaussprechliches
Die Sache wird immer seltsamer
Zeugenaussagen
Hup Hup
Sonntag, 16. November
… und es wurde schlimmer.
Zottelhund
Ansteckend wie Ebola
Der Jünger
Verschwendete Zeit
Montag, 17. November
Blogger gegen Cop
Zähne
Fehler, die blutig enden
Prinzipien
Exil
Auf geht’s
Desozialisierung
Gegenseitige Hilfe
Freunde fürs Leben
Palaver
Dienstag, 18. November
Umdrehen, bitte
Finderlohn
Das Filmmaterial
SUBREDDIT/Monster von Detroit
Einbruch
Die Pflicht ruft
Wörter, die Wunden schlagen
Anruf-Protokoll der Hotline
Mittwoch, 19. November
Achtung, kommt alle
Loch im Kopf
Die roten Schuhe
Es geht ein Flug nach nirgendwo
Schmetterlinge im Bauch
Wie Fleisch
Hirn-Allerlei
Verlassensängste
Im Herzen der Story
Es geht aufwärts
Es gibt keine Zufälle
Metamorphosen
Montagen
Labyrinth
Beschwörungsformeln
Sparkles
Des Pudels Kern
Finaler Rettungsschuss
Die Summe deiner Ängste
Was man sehen und anfassen kann
Wenn alle Träume wahr werden
Hier werden jedem seine Wünsche erfüllt
Offen
Hinterher
Gehirnbleiche
Was man nicht abschütteln kann
Danksagung
Ich habe von einem Jungen geträumt, der Sprungfedern statt Füßen hatte, damit er hoch springen konnte. So hoch, dass ich ihn nicht fangen konnte. Aber ich habe ihn gefangen. Aber dann wollte er nicht wieder aufstehen.
Ich habe mich so bemüht. Ich habe ihm neue Füße gegeben, ihn so schön gemacht. Schöner, als man es sich vorstellen kann.
Aber er stand einfach nicht auf. Und die Tür ließ sich nicht öffnen.
Sonntag, 9. November
Bambi
Die Leiche. Die-Leiche-die-Leiche-die-Leiche, denkt sie. Wenn man Wörter wiederholt, verlieren sie ihre Bedeutung. Leichen ebenfalls, trotz all ihrer Variationen. Tot ist tot. Nur das Wie und Warum wechselt. Bitte ankreuzen: Erfroren. Erschossen. Erstochen. Erschlagen mit einem stumpfen Gegenstand, mit einem spitzen Gegenstand, ohne Gegenstand, wenn bloße Fäuste reichen. Wham, bam, thank you, Ma’am. Wir spielen Mörder-Bingo! Aber selbst Gewalt hat ihre kreativen Grenzen.
Gabriella wünscht, jemand hätte das mal dem kranken Arsch erklärt, der das hier getan hat. Das ist nämlich einzigartig, unique. Yoo-neeq hieß zufällig auch die Sexarbeiterin, die sie letztes Wochenende mit einer Warnung wieder freigelassen hat. Darin besteht im Moment die Hauptarbeit des DPD. Im Aussprechen sinnloser Warnungen. In der gewalttätigsten Stadt Amerikas. Dadadamm! Gabriella kann fast den dramatischen Trommelwirbel hören, mit dem ihre Tochter diese drei Wörter wie im Horrorfilm lautmalerisch begleitet hätte. Und damit ist Detroit umfassend beschrieben. Es schleift diesen bedeutungsschwangeren Beinamen hinter sich her wie der Wagen eines frischverheirateten Paars eine Kette aus Blechbüchsen. Macht man das eigentlich noch, fragt sich Gabriella, Blechbüchsen und Rasierschaum auf den Fenstern? Hat man das überhaupt jemals wirklich gemacht? Oder ist das reine Erfindung, wie «Hält ein Leben lang», der Weihnachtsmann in Coca-Cola-Rot oder Mütter und Töchter, die sich bei einem Magerjoghurt gegenseitig das Herz ausschütten? Die besten ihrer Unterhaltungen mit Layla finden jedenfalls nur in Gabriellas Vorstellung statt.
«Detective?», sagt der Uniformierte. Weil sie einfach nur dasteht und den Jungen im Dunkel des Tunnels anstarrt, die Hände tief in ihren Taschen vergraben. Sie hat die verdammten Handschuhe im Auto vergessen, und ihre Finger sind taub von dem kalten Wind, der sich vom Fluss herüberstiehlt. Der Winter zeigt schon Zähne, obwohl sie erst November haben. «Ist alles –»
«Ja, alles okay», schneidet sie ihm das Wort ab und schaut nach seinem Namen auf der Polizeimarke. «Ich denke darüber nach, wie der Täter das hier gemacht hat, Officer Jones.» Weil Superkleber allein nicht gereicht hätte. Um die einzelnen Teile beim Transport der Leiche zusammenzuhalten. Der Junge ist nicht hier gestorben. Dafür gibt es nicht genug Blut. Und von seiner fehlenden Hälfte ist auch nichts zu sehen.
Schwarz. Nicht weiter erstaunlich in dieser Stadt. Zehn Jahre alt, schätzt sie. Möglicherweise älter, wenn man Unterernährung und Entwicklungsstörungen in Betracht zieht. Okay, also zwischen zehn und sechzehn. Nackt. Zumindest das, was von ihm übrig ist. Kann schon sein, dass der Rest Hosen anhat, mit dem Portemonnaie in der Gesäßtasche und einem Handy ohne Guthaben, das es ihnen aber viel leichter machen würde, seine Mom zu benachrichtigen.
Wo auch immer der Rest von ihm stecken mag.
Er liegt auf der Seite, die Beine angezogen, die Augen geschlossen, das Gesicht friedlich. Fötus-Stellung. Nur dass er sein Leben nicht mehr vor sich hat. Und das sind auch nicht seine Beine. Dürr wie eine Bohnenstange. Schöne Haut, wenn auch etwas gelblich wegen des Blutverlusts. Präpubertär, stellt sie fest. Keine Spur von Akne. Auch keine Kratzer oder Wunden oder sonst irgendwelche Hinweise darauf, dass er sich gewehrt hat oder etwas Schlimmes mit ihm passiert ist. Jedenfalls oberhalb der Taille.
Unterhalb der Taille ist das schon was anderes. Oh Mann. Ganz andere Liga. Ein klaffender dunkler Schnitt genau über den nicht vorhandenen Hüften, wo er irgendwie … mit der unteren Hälfte eines Hirschs verbunden ist, Hufe inklusive. Der weiße Stummelschwanz reckt sich wie eine kleine kecke Flagge in die Höhe. Das braune Fell ist verklebt von angetrocknetem Blut. Das Fleisch wirkt am Saum wie miteinander verschmolzen.
Officer Jones hält sich im Hintergrund. Der Gestank ist grässlich. Sie vermutet, dass die Gedärme durchtrennt wurden, in beiden Leichen, und jetzt Blut und Scheiße daraus in die verbundenen Bauchhöhlen laufen. Außerdem geben die Duftdrüsen des Hirschs einen strengen Geruch nach Wild ab. Ihr tut der Gerichtsmediziner leid, der den Mist aufschneiden muss. Aber immer noch besser als der Papierkram. Oder der Stress mit den Medien. Oder, noch schlimmer, mit dem Büro des Bürgermeisters.
«Hier!» Sie fischt eine kleine rote Tube mit Lipgloss aus der Tasche. Die hat sie aus einer Laune heraus gekauft, um Layla zu bestechen. Mit Bonbongeschmack – als ob das den Graben zwischen ihnen überbrücken könnte. «Kein Menthol, aber besser als nichts.»
«Danke», sagt er erleichtert. Klarer Beweis, dass er ein VA ist. Ein ‹Verdammter Anfänger›. Er quetscht das Lipgloss auf den Finger und schmiert sich das Zeug unter die Nase; Schnodder mit Kirscharoma. Und Glitzer. Das fällt Gabriella jetzt erst auf, aber sie behält es für sich. Sie will auch mal ein bisschen Spaß haben.
«Aber nicht am Tatort damit rumschmieren», warnt sie.
«Nein, nein, mach ich nicht.»
«Und denken Sie nicht mal dran, Fotos mit dem Handy zu machen, um sie bei Ihren Freunden rumzuzeigen.» Sie schaut sich um, nimmt alles auf: den Tunnel mit dem Graffito, das leere Wände in dieser Stadt so verlässlich überzieht wie Zahnbelag, die drückende Dunkelheit vor dem Morgengrauen, das Schweigen des Verkehrs. «Wir halten da erst mal den Deckel drauf.»
Es wird ihnen wohl nicht gelingen.
Last Night A DJ Saved My Life
Jonno wird von einem Ellbogen gegens Kinn aus dem Schlaf gerissen. Verwirrt schreckt er hoch und versucht, sich zu wehren, stellt dann aber fest, dass er mit der Bettwäsche kämpft. Das Mädchen von letzter Nacht – Jen Q – dreht sich auf die Seite, die Arme über dem Kopf geben den Blick frei auf ein Sleeve-Tattoo aus lauter Vögeln, das bis zu ihrer Brust reicht und die Schulter bedeckt. Offensichtlich hat sie nichts davon mitbekommen, dass sie ihm eben fast eine Gehirnerschütterung beigebracht hat. Ihre Augenlider flattern im REM-Schlaf, im Traum geht ihr Atem stoßweise. Ungefähr so wie bei dem freudigen Stöhnen, das er ihr vorhin entlockt hat, als sie auf ihm geritten ist, seine Hände an ihren Hüften. Beim Orgasmus hat sie den Kopf zurückgeworfen und ihre Mähne aus Zöpfen dabei geschwungen. Sein Pech, dass einer davon in seinem Auge landete und die Operation daraufhin abrupt abgebrochen werden musste, weil sein Auge tränte und er unter Schmerzen blinzelte.
«Ruhig …», sagt er und reibt über ihren Rücken, um sie aus dem Traum zu wecken. Er kann die dunkle Wolke eines Katers über seinem Kopf spüren, die nur darauf wartet, sich auf ihn niederzusenken. Ist aber noch nicht ganz so weit. Pervers, aber der Schmerz von dem Schlag eben scheint die Sache aufzuhalten.
«Mmmgghhhff», sagt sie, noch nicht richtig wach. Aber er hat ihren Albtraum vertrieben. Er lässt die Hand zu ihrer Taille wandern, unter der Decke. Sein Schwanz regt sich.
Jetzt hat sie ihm zweimal in einer Nacht weh getan. Gut möglich, dass sie ihm als Nächstes das Herz bricht. Sie hat sich zwar gleich entschuldigt, konnte aber das Kichern nicht unterdrücken, hat sich auf ihn fallen lassen und Tränen gelacht, während sein Auge lief.
«Vielen Dank für deine Solidarität», hat er sich beschwert, aber sie fühlte sich gut an auf ihm, während ihr ganzer Körper vor Lachen bebte.
«Willst du nochmal vögeln?», flüstert er ihr jetzt ins Ohr.
«Morgen», murmelt sie, öffnet aber die Schenkel, um seiner Hand den Weg freizumachen. «Ist schön. Mach weiter.»
Sie seufzt und dreht sich so, dass er hinter ihr Platz hat. Er drückt seinen harten Schwanz gegen ihren Arsch, seine Finger gleiten über ihre Klit, bis er merkt, dass sie wieder tief atmet und eingeschlafen ist. Na toll.
Er lässt sich auf den Rücken fallen und schaut sich im Zimmer um, aber hier gibt es kaum sachdienliche Hinweise. Ein Deckenventilator aus Holz. Ein moderner Schrank. Geflochtene Jalousien vor dem Fenster. Ihre Kleider verteilt auf dem Fußboden. Keine Bücher, was ihm Sorgen macht, für den Fall, dass er sich in sie verlieben sollte. Hat er ihr gesagt, dass er schreibt?
Wofür wohl das Q steht? Für einen Nachnamen, oder ist das so ein DJ-Add-on? Jen X wäre wohl zu banal gewesen, vermutet er. Nicht ihr Stil, soweit er das nach den bisher vorliegenden Informationen beurteilen kann. Und das sind folgende, um sie in einer der leicht verdaulichen Listen zusammenzufassen, die er erstellt, statt einer ordentlichen Arbeit nachzugehen:
1) Die Musik, die sie gestern bei der sogenannten Geheim-Party aufgelegt hat, zu der im Studio am Eastern Market unter dem T-Shirt-Shop hundert Leute auftauchten. Welche Songs es genau gewesen sind, weiß er nicht, aber das lag an der vorgerückten Uhrzeit, zu der alles zu wummernden Bässen verschmilzt.
2) Die Art, wie sie getanzt hat, die Zöpfe hochgebunden, um genau solche Verletzungen zu vermeiden, wie sie ihm dann später beigebracht hat. Das war ihm als Erstes aufgefallen. Sie bewegte sich, als wäre sie glücklich. Und sie lächelte, als ihre Blicke sich trafen. Das gefiel ihm. Nicht zu cool zum Lächeln.
3) Wie sie ihm draußen ungeduldig die Zigarette aus dem Mund gepflückt hat. Da waren sie noch Fremde, nur verbunden durch das Schicksal des Rauchers, der draußen im Kalten stehen muss, um sich dafür in ferner Zukunft möglicherweise ein Emphysem zu verdienen. Sie redeten über Motown und Techno. Diese Rodriguez-Dokumentation. Die Pleite. Die üblichen Themen. Er dachte, sie würde jetzt an der Zigarette ziehen, aber sie küsste ihn.
4) Die Knutscherei in ihrem Auto. Er sieht in seiner Erinnerung noch Schnappschüsse, oder eher Instagram-Bildchen, ein bisschen verschwommen: wie er ihr dann an Hecken entlang und um eine Hausecke herum zu einem Cottage folgt, wie er ihren Nacken küsst, während sie mit den Schlüsseln herumfummelt, wie der Duft ihrer Haut ihn wahnsinnig macht, dann Fluchen, Lachen, und ihr ‹Psst›, als die Tür aufgeht und sie hineinstolpern.
5) Die Umrisse der Möbel, an denen sie ihn im Dunkeln vorbei zum Schlafzimmer geführt hat. Beide waren sie betrunken. Er jedenfalls definitiv. Das weiß er, weil sich kurz alles drehte. Küssen, Kleider runterzerren. Wie sie sich innen anfühlte.
Shit. Hat er ein Kondom benutzt? Bei dem Gedanken zieht sich sein Magen zusammen, aber nicht aus den Gründen, die ihm noch vor einem Jahr Sorgen gemacht hätten.
Sie gibt einen kurzen zarten Kaninchen-Schnarcher von sich, und er duckt sich, als ihr Arm wieder herumfliegt. Nicht gut. Weil er klar denken kann, weiß er, dass er nicht wieder einschlafen wird. Inzwischen ist er ein Experte, was seine Schlafstörungen angeht. Meistens reißt die Angst ihn mitten in der Nacht aus dem Schlaf, und sein Herz rast dann. Er beugt sich über den Rand des Betts, fischt in seiner Jackentasche nach dem Telefon. Vier Uhr achtundvierzig. Später als sonst, normalerweise passiert es gegen zwei. Er sollte es wirklich öfter treiben. Ach was, sag bloß!
Seine SMS checkt Jonno nicht, obwohl der kleine Briefumschlag neue Nachrichten meldet. Und auf die Mailbox hat auch jemand gesprochen, das zeigt die Zahl neben der Sprechblase an. Früher einmal konnten eine solche Panik nur Symbole auslösen, die vor der Pest warnten. Ein schwarzes X über der Tür.
Er öffnet den Browser und sucht nach Jen Q. Nur zwei Seiten mit Treffern. Sie wird bei einem Festival oder Gig erwähnt. Irgendein kleines Profil auf einer Musikseite. Aber Social Media bis zum Abwinken. Das volle Programm, sogar bei MySpace, was sie wohl etwas älter macht, als er geschätzt hat. Er klickt sich durch ihre Selfies, Sinnsprüche, Eigenwerbung. ‹Xcited 2b playing Coal Club 2nite. Eintritt: 5 $.› Alles oberflächlicher Scheiß, nichts als Image. Er kennt das selbst.
Sein Kater macht sich breit. Er muss was nehmen, damit es nicht schlimmer wird.
Er schlägt die Decke zurück, schwingt die Beine aus dem Bett und wartet darauf, dass die Übelkeit abflaut. Jen rührt sich nicht. Ihr Mascara ist verschmiert. Cate wäre nie ohne Abschminken ins Bett gegangen.
Im Zimmer ist es eiskalt. Er zieht die Decke über die Vögel auf ihrer Schulter, wirft sich die Jacke über und taumelt dann in Richtung Bad, hofft er zumindest. Vielleicht findet er da was für seinen Kopf.
Er sollte schreiben. Egal was. In Detroit wartet an jeder Ecke eine Geschichte. Aber die haben schon die echten Detroiter abgegrast. Scheiß auf dich und deinen Pulitzer, Charlie LeDuff, denkt er. Und tastet an der Wand nach dem Lichtschalter. Die Halogenleuchten lassen ihn zusammenzucken, und seine Reflexion im Spiegel des Medizinschränkchens kennt kein Erbarmen. Einfach fies. Er mustert sein Gesicht. Zumindest wird es nicht mehr so aufgedunsen wirken, wenn er mal ausgeschlafen ist. Die George-Clooney-Regeln: Bei einem Mann sind Krähenfüße sexy, und die weißen Stellen in seinem Sechstagebart sind der Lohn der Lebenserfahrung. Scheiße. Siebenunddreißig und im Bett mit einer DJane.
Gar nicht übel, er grinst das Spiegelbild an. Und ignoriert seinen inneren Troll, der hämisch kräht: Ja, aber eine Cate ist sie nicht! Woher will der das überhaupt wissen, denkt er. Könnte sie schon sein. Sie könnte intelligent sein, ernsthaft, dabei aber auch witzig. Ich könnte ihr um die ganze Welt folgen, jede Nacht ein neuer Gig in einer anderen Stadt, in Hotelzimmern schreiben.
Klar, klappt ja jetzt schon super.
«Verirrt?», fragt Jen, lehnt in einem hässlichen blauen Flanellbademantel an der Tür. Ihr Gesicht sieht auch etwas geschwollen aus – was irgendwie auf ganz eigene Art süß ist. Gedankenverloren massiert sie sich das Schlüsselbein und entblößt dabei ein Stück weiche Haut.
«Ach, hi! Ich such grad nach Aspirin. Oder so was.»
«Schon in den Medizinschrank geschaut?» Amüsiert beugt sie sich vor und öffnet die Tür. Kosmetik, Tablettenfläschchen, ein Paket Tampons, bei dessen Anblick er die Augen abwendet, als wäre er wieder zwölf. Erschreckenderweise auch ein paar noch eingeschweißte Nadeln. Sie nimmt ein Fläschchen heraus und lässt zwei Aspirin in seine Hand fallen. «Du kannst das Glas neben dem Waschbecken nehmen. Ist sauber. Kommst du zurück ins Bett?»
«Ja.» Er schluckt die Pillen und folgt ihr ins Schlafzimmer.
Wie ein Wrestler lässt sie den scheußlichen Bademantel von den Schultern gleiten und legt sich wieder hin. «Ich hab deinen Blick gesehen. Mach dir darüber keine Gedanken. Ich hab das, was meine Oma immer Zucker genannt hat.»
«Hä?»
«Die Nadeln. Ich bin Diabetikerin. Die sind für den Notfall, falls mein normales Spritzgerät ausfällt. Und du dachtest schon, du hast dich mit einem Junkie eingelassen.»
«Nur für eine Millisekunde.»
«Da bist du jetzt bestimmt froh, dass wir Kondome benutzt haben?»
«Haben wir?» Er verdrängt den Anflug von Enttäuschung. «Ich steh ein bisschen neben mir. Aber ist ja auch egal. Du bist ja kein, äh, du weißt schon …» Ihm ist bewusst, wie idiotisch er aussehen muss, mit der geschlossenen Jacke und seinem Schwanz, der darunter baumelt. Traumtyp!
«Erinnerst du dich etwa nicht mehr?» Aber sie lächelt dabei, hat die Decke bis zum Hals hochgezogen. «Ich bin zutiefst verletzt!»
«Kann sein, dass du meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen musst.»
«Komm schon her», sagt sie, lüpft die Decke und deutet mit einer Kopfbewegung zu einer Kondomschachtel auf dem Nachttisch. So ein Wink entgeht selbst ihm nicht.
«Was hast du vorhin geträumt?», flüstert er in ihr perfekt geformtes Ohr, als er in sie eindringt.
«Ist das wichtig?» Sie wölbt ihm den Rücken entgegen, und im Moment ist es das wirklich nicht.
«Komm schon, wach auf. Du musst gehen.»
«Mmmmf?», entfährt es Jonno, als sie ihn aus dem Bett schiebt. Einen Moment lang ist er verwirrt, dann erinnert er sich, wo zum Teufel er ist. Die heißeDJane. Du hast ihr den Schwanz reingesteckt. Nicht übel, Junge.
«Aber es ist noch dunkel», protestiert er verschlafen, obwohl er sich schon die Socken anzieht. Er tritt auf eins ihrer benutzten Kondome. Es schmatzt unter der Socke.
«Los jetzt, ist mein Ernst.»
«Hat die Zombieapokalypse etwa schon angefangen?» Er zieht das Hemd über, merkt dann, dass es falsch herum ist. Also zerrt er es wieder herunter und startet einen neuen Versuch. Sie sitzt mit übergeschlagenen Beinen auf dem Bett, nackt, beobachtet ihn und lächelt.
«Du bist schon witzig, Tommy.»
«Jonno.» Es gibt ihm einen Stich, obwohl das lächerlich ist.
Sie schlägt die Hände vor den Mund. «Oh Shit, sorry.» Und kichert wieder. «Oh Mann, wie peinlich. Ist mir das unangenehm.» Sie stützt den Kopf auf die Knie. Hat einen Lachanfall. «Sorry.»
«Dafür könntest du mich wenigstens zum Frühstück einladen», sagt er und bemüht sich, möglichst beleidigt zu klingen. Er zieht die Jeans hoch und knöpft sie zu. Das bekommt er wenigstens noch hin.
«Okay, aber nur wenn du sofort hier abhaust.»
«Sind wirklich die Zombies los?», fragt er flüsternd. «Dann sollten wir uns besser was zur Verteidigung organisieren.»
«Schlimmer, du Spinner. Mein Vater.»
«Moment.» Sein Gehirn läuft auf Hochtouren. Er schaut sich um. Nein, das ist kein Teenager-Zimmer. Und das auf dem Bett ist ein Frauenkörper. Voll, sinnlich und dazu Lachfältchen. Sie bemerkt seine Panik und muss noch mehr lachen, sie lehnt sich an ihn, legt ihm die Hand auf den Bauch. Er zieht ihn instinktiv ein. Sie hat dich schon nackt gesehen, du Genie.
«Du dachtest …»
«Mit Zombies komm ich klar.»
«Ich bin neunundzwanzig, du Idiot.»
«Na, Gott sei Dank.» Und glatte Lüge, denkt er. Im Profil, das er gestern Nacht gelesen hat, stand was von dreiunddreißig.
«Ich wohne zu Hause. Vorübergehend.»
«Und dein Dad glaubt, du hast keinen Sex?»
«Nicht unter seinem Dach. Oder sonst wo auf dem Grundstück.»
«Ah.»
«Ja.»
«Dann sollte ich jetzt wohl gehen.»
«Ja, wär besser.» Sie grinst breit und deutet mit dem Kopf zur Tür. «Gleicher Weg wie beim Reinkommen.»
«Aber du lädst mich noch zum Frühstück ein.»
«Nicht heute. Familienkram.»
«Dann morgen.»
Sie gibt nach. «Es gibt da dieses Café in Corktown. Zehn Uhr?»
«Das sind keine besonders genauen Angaben.»
«Findest du schon.»
«Dann nehm ich mir jetzt ein Taxi. Und wir sehen uns morgen.» Er versucht, nicht allzu verzweifelt zu klingen.
«Okay.» Sie strahlt.
«Na gut.» Er steht noch immer da.
«Du musst jetzt weg.»
«Ist bestimmt ein schlimmer Fehler, dich einfach zu verlassen.»
«Hilft aber nichts, du musst.»
«Okay. Ist übrigens süß, dass du nicht fluchst.»
«Raus jetzt! Herrgott nochmal!»
Er beugt sich zu ihr und küsst sie lang und innig. «Okay.» Er schleicht mit großem Getue auf Zehenspitzen durch den Flur, ohne sich umzudrehen, und riecht nach Eau de Pussy. Nein, es hat keinen Zweck.
«Ähm …» Er steckt den Kopf durch ihre Tür. Sie liegt mit einem Arm über dem Kopf und geschlossenen Augen da, die Hand zwischen den Beinen. «Sorry, dass ich dich unterbreche –»
Sie setzt sich auf, es ist ihr überhaupt nicht peinlich. «Haust du jetzt endlich ab?»
«Würd ich ja, aber …» Er zuckt hilflos mit den Schultern. «Ich hab keine Ahnung, wo wir hier sind. War ja dunkel vorhin. Kannst du mir wenigstens sagen, wie der Ort hier heißt?»
Unter dem Tisch
TK wacht unter dem Tisch in einem fremden Haus auf. Seine Füße schauen aus seinen abgetragenen schwarzen Stiefeln heraus. Er hat sich ein Kissen vom Sofa gezogen, und ein Vorhang dient als Decke. Man muss sich zu helfen wissen. Mit elf konnte er schon die meisten erwachsenen Männer unter den Tisch trinken, heute nicht mehr. Dreiundzwanzig Jahre trocken, er hat sogar die Medaillen der Anonymen als Beweis, die allerdings bei seiner Schwester in Flint in einem Karton liegen. Genau wie der Rest seiner Sachen.
Durch die Tischdecke wirkt das Morgenlicht verschlafen grau. Wie unter einem Leichentuch. Kein Wunder, dass er geträumt hat, er wäre lebendig begraben. Er starrt hoch zur dunklen Holzplatte und kommt sich vor wie in einem Sarg – der Luxusversion, außen cremefarben, mit goldenen Beschlägen, und innen mit Seide ausgekleidet. Nicht wie der Sarg, in dem er seine Ma beerdigt hat. Aber das sind morbide Gedanken. Der Tag liegt hell vor ihm, und er muss noch das ganze Haus absuchen.
Jemand anders hätte oben in einem der Betten geschlafen, aber die Familie hat die große Matratze mitgenommen, und in einem der Kinderzimmer zu schlafen wäre ihm falsch vorgekommen. Außerdem ist das eines seiner besonderen Talente. Er kann immer und überall schlafen. Die Fähigkeit hat er am Fließband bei der Schraubenproduktion entwickelt. Wer sich da schlau und unauffällig anstellte, konnte ein paar Stunden lang auch für zwei arbeiten, während der andere ein bisschen die Augen zumachte, danach wurde gewechselt. Den Chefs gefiel das gar nicht, aber solange die Arbeit erledigt wurde, konnte es ihnen egal sein. Wenn es laut ist, schläft er besser, hat er festgestellt. Konditionierung nennt man das wohl. Dröhnen und Bohren und das Kreischen der Maschinen? Für ihn das reinste Schlaflied. Vögel, die draußen zwitschernd den Morgen begrüßen, sind kein Ersatz.
Irgendwas fällt in der Küche scheppernd um. Sofort fährt er hoch, stößt sich den Kopf an der Tischplatte. Verdammt. Er hätte nicht so unvorsichtig werden dürfen, auch wenn die Tür abgeschlossen ist und er so was wie eine Erlaubnis hat.
Er hat versucht, die Sache auf die höfliche Art zu regeln. Er hat auf der anderen Straßenseite gestanden, während die Familie den Wagen bepackte, alles in den Kombi und einen gemieteten Anhänger lud. Die Matratze schnallten sie aufs Dach, darauf dann einen Tisch, falsch herum, mit den Beinen in der Luft wie ein toter Käfer. Die Kinder gingen ins Haus und kamen wieder raus, schleppten Kisten, während die Nachmittagssonne langsam tiefer sank. Die Frau schaute ihn böse an, als wäre das in Plastik eingeschweißte Schild wegen der Zwangsversteigerung seine Schuld. Die Kinder schauten auch. Verstohlene Blicke wanderten zu ihm herüber, dann wieder zurück zu ihrer Familie, nur vom ganz Kleinen natürlich nicht, der wollte mit den Kisten spielen. Ein wirklich niedlicher Junge, der allen zwischen den Beinen herumlief, wie eines dieser Aufziehdinger, die laufen und laufen und laufen.
TK versuchte, entspannt zu bleiben. In aller Ruhe drehte er sich eine Zigarette und zündete sie an. Er wollte nicht, dass sie ausflippten. Aber einfach weggehen und auf sein Glück vertrauen, konnte er auch nicht. Vielleicht kam ihm hier dann jemand zuvor. Klar war das in dieser Gegend nicht unbedingt wahrscheinlich. Ihr Haus war das letzte zwischen all den zugewachsenen Grundstücken und ausgebrannten Autowracks. Er war nur darauf gestoßen, weil das sein Leben ist; er wandert durch die Stadt und wartet auf den Zufall. TK hat auch schreckliche Zufälle erlebt. Da muss man nur seine Ma fragen und ihre Zwillingsschwester, die für den Tod seiner Ma verantwortlich ist.
«Bleib ruhig», murmelte der Mann und zog an den Halteseilen, um zu prüfen, ob sie auch fest saßen. Aber seine Frau kochte innerlich, schon die ganze Zeit, seit TK wartete und versuchte, es anders aussehen zu lassen, als es war.
«Nein», sagte sie, drückte ihrem Mann den Kleinen in den Arm und marschierte über den gelben Rasen auf TK zu. Sie hatte die kleinen Fäuste geballt, als wäre sie ein Footballer und kein Winzling von einem Meter sechzig. Ihr Mann starrte ihr hinterher und merkte erst jetzt, dass er nichts machen konnte, weil er den Kleinen auf dem Arm hatte.
TK ließ die Zigarette fallen und trat sie aus. Ist unhöflich, einem anderen das eigene Gift ins Gesicht zu pusten. Sind aber auch schlechte Sitten, den Gehweg zu verschmutzen und Tabak zu verschwenden, auch wenn es der ganz billige ist. Er hob die Kippe auf und steckte sie ein. Als er sich wieder aufrichtete, hatte die Frau sich schon vor ihm aufgebaut, die Hände in die Hüften gestemmt, und spuckte Gift und Galle. Natürlich war er nur der Blitzableiter, aber manchmal braucht man den. Hat er oft genug erlebt, im Asyl, bei den Meetings. Den Blitzableiter konnte er für sie spielen.
«Können Sie nicht mal warten, bis wir weg sind, Sie … Aasgeier?» Ihre Stimme überschlug sich, aber die Beleidigung prallte an ihm ab. Abgesehen von dem, was er mal im Fernsehen über Geier gesehen hat, weiß er nicht viel über sie, außer eben dass sie von einer Leiche zur anderen hüpfen. Er hätte ihr gern gesagt, dass er seiner Meinung nach eher wie einer der streunenden Hunde in der Stadt ist. Die sind auch schamlose Opportunisten, die man anschreien kann, wie man will. Die haben gelernt, das nicht persönlich zu nehmen. Jedenfalls, solange sie allein sind. Im Rudel sieht das anders aus. Ein bösartiger Hund reicht, um alle anderen in zähnefletschende, knurrende Ungeheuer zu verwandeln. Aber er ist ein einsamer Hund und kann auch mal ein bisschen mit dem Schwanz wedeln.
«Tut mir leid, dass Sie wegmüssen, Ma’am», hat TK gesagt, ganz ruhig, und ihr dabei in die Augen gesehen. «Früher sind immer nur die netten weißen Familien aus Detroit weggezogen.»
Damit hat er ihr den Wind aus den Segeln genommen. Höflichkeit und Manieren haben diese Wirkung; die drehen so eine Situation. Man muss Menschen menschlich behandeln. Das hat er bei seiner Mutter gelernt, genau wie Schießen und den billigsten Preis für eine Hure auszuhandeln.
«Tja», sagte sie und fuhr sich verärgert über die Augen. «Erzählen Sie das der Bank.»
«Machen Sie sich keine Sorgen wegen Ihrer Sachen, Ma’am. Ich sorg dafür, dass sie alle einen guten Platz finden, wo sie gebraucht werden.»
«Dann muss ich mich ja noch bedanken.» Es klang bitter. Sie rief hinüber zu ihrem Mann, der gerade abschließen wollte. «Lass! Das ist doch nun wirklich egal. Oder?» Sie schaute TK an, brauchte seine Bestätigung, für viel mehr, als er ihr wohl geben konnte. Aber er versuchte es trotzdem.
«Ja, Ma’am», sagte er ernst. «Viel Glück.»
«Ha!», sagte sie. «Das brauchen Sie – Sie bleiben ja hier.»
«Alles klar?», rief ihr Mann.
Die Autotüren knallten zu, aber das Haus hatten sie offen gelassen, damit die Dämmerung hineinkriechen konnte – zusammen mit all den schamlosen Opportunisten, die zufällig gerade in der Gegend waren.
TK wartete, bis die Rücklichter des Anhängers um die Kurve verschwunden waren, bevor er ins Haus ging und die Tür abschloss. Er probierte den Lichtschalter, aber der Strom war schon abgestellt, also traf er eine Entscheidung, die er jetzt angesichts der Geräusche in der Küche bereut – nämlich bis zum Morgen zu warten und dann zu schauen, was noch da ist.
Etwas geht in Scherben, Glas oder Keramik. Wahrscheinlich kein Plünderer, denkt TK. Das Wort mag er sonst nicht. Es klingt nach Diebstahl, dabei hat er noch nie im Leben geklaut, nicht mal in seiner kaputten Jugend. Sein Job sind Sicherstellung und Umverteilung. Ferner Karriereberatung, IT-Support, Supervision, Recycling und, wenn’s mal gar nicht anders geht, im Laden für Partybedarf an der Franklin Street den Boden wischen. Das mag jetzt ein etwas überraschender Arbeitsplatz für einen Trockenen sein, aber so bleibt er ehrlich. Er nimmt niemals Geld von Jugendlichen unter sechzehn, um ihnen ein paar Bier zu kaufen, wie es andere Obdachlose tun. Oder in wohnlicher Hinsicht Benachteiligte, wie er sie lieber nennt.
Die Geräusche aus der Küche klingen, als wäre da jemand sehr ungeschickt. Schlurfen. Vielleicht ein Betrunkener. Oder etwas anderes. Er klettert unter dem Tisch hervor und tastet nach seinem Pfefferspray. Abgelaufenes Haltbarkeitsdatum, aber man soll nicht alles glauben, was auf Verpackungen steht. Im Gehstock hat er ein Messer versteckt, das er selbst zusammengebastelt hat, doch mit Pfefferspray ist er immer besser gefahren, besonders bei verwilderten Hunden. Jedenfalls, wenn der Wind richtig stand und er nicht in einer Sackgasse feststeckte. Ist ihm auch schon passiert, aber nur das eine Mal. Thomas Michael Keen lernt schnell.
Er schleicht zur Tür, zieht die Sicherheitskappe vom Spray, hält es hoch und stellt sich dem Eindringling. In der Küche tobt das Chaos. Schränke stehen offen. Lebensmittel sind auf dem Fußboden verteilt. Die Frau von gestern hätte die Küche nie und nimmer so hinterlassen. Ein struppiges Banditengesicht lugt hinter einer der Schranktüren hervor, die Barthaare verklebt mit hellem Blut. TK flucht. Dann leckt der Waschbär weiter das Erdbeergelee vom Boden auf.
«Hau ab! Hey! Raus hier!»
Der Waschbär hebt den Kopf und schaut ihn an. Er rennt auf das Tier zu, wedelt mit den Armen und brüllt. «Beweg deinen pelzigen Arsch!»
Der Waschbär plustert sich auf, überlegt es sich dann aber anders und läuft zur Katzenklappe. Ein kalter Windzug, das Plastik schwingt, und er rennt um sein Leben hinaus ins Morgengrauen. Da haben sie jetzt beide was zu erzählen.
TK ist ganz kurz versucht, wieder unter den Tisch zu kriechen und weiterzuschlafen, bis die Sonne richtig aufgegangen ist, aber sein Puls rast wegen des verdammten Viechs.
Gegen besseres Wissen hofft er, dass wenigstens der Herd mit Gas betrieben wird und nicht elektrisch. Dann könnte er sich einen Kaffee machen. Aber natürlich läuft der Herd mit Strom. Wenn er es schafft, ihn richtig abzuklemmen und irgendwie zum Trödelladen zu schaffen, ist das Ding gut seine fünfzig Dollar wert. Im Kopf ist bei ihm schon Inventur.
Aber der Mensch ist nichts ohne Koffein, also schiebt er sich einen Löffel voll Instantpulver gemischt mit braunem Zucker in den Mund und spült mit Wasser nach. Der Wasserhahn zischt und gurgelt seltsam. Bestimmt hat die Stadt auch das Wasser abgestellt. Ein Haus wie dieses, in dem eine Familie mit drei Kindern wohnt, hat aber garantiert einen großen Brunnen. Für ein bisschen Waschen und Rasieren und eine Klospülung nach dem morgendlichen Gang wird es noch reichen. Man muss schon auf der Straße gelebt haben, um die pure Dekadenz eines Wasserklosetts aus weißem Porzellan richtig zu würdigen.
Früher einmal, vor langer, langer Zeit, ist er selber Vermieter gewesen. Mit dreizehn, als er von all den Zugedröhnten noch den meisten Durchblick hatte. Er zog in ein verlassenes Gebäude, riss die Holzbretter runter, brachte Vorhänge an, mähte den Rasen und beteiligte eine nette Chinesin, damit sie einmal die Woche vorbeikam, um Miete zu kassieren, denn wer hätte die schon bei einem kleinen Jungen abgedrückt? Von einem alten Elektriker lernte er, wie man einen Stromkasten anzapft, ohne dabei gegrillt zu werden. Ansonsten holten sie eimerweise Wasser aus dem Gartenschlauch der Nachbarn, wenn die grad nicht zu Hause waren. Das funktionierte so lange, wie seine Mieter das Haus in Schuss hielten, aber auf eine Horde Junkies kann man sich eben nicht verlassen. Schließlich feierten sie im Vorgarten Partys, die Nachbarn holten die Polizei, und schon mussten sie das verlassene Haus verlassen.
Er hatte eigentlich gleich was Neues suchen wollen, aber dann war seine Mutter gestorben, in seinen Armen verblutet, und die Justiz hatte ihn von der Straße geholt. Volle zehn Jahre, danach ging’s immer mal wieder rein und raus. Gefängnis ist wie Alkohol – man kommt schwer davon los. Früher hat er seinen Kummer im Schnaps ertränkt, was ihn dann schnell wieder in Konflikt mit dem Gesetz brachte. Inzwischen hat er gelernt, alles zu verdrängen, als wäre sein Gehirn ein Haus mit vernagelten Fenstern.
TK wühlt in den Schränken herum, bis er ein paar schwarze Müllsäcke findet, damit geht er nach oben und kämmt alles sorgfältig durch. Die Leute hatten es eilig beim Packen, auf den Kleiderbügeln hängen noch Sachen, andere liegen verstreut auf dem Boden. Er faltet alles zusammen und steckt es in den Sack. Ein Stapel für ihn, einen schickt er Florrie, ein bisschen Kram für Ramón, was übrig bleibt, spenden sie dann der Kirche.
Er probiert ein kariertes Flanellhemd an, aber die Ärmel sind zu kurz. Bei der Anzugjacke auch. Ist gar nicht so leicht für einen großen Kerl. Aber die roten Basketballschuhe, die er hinten im Schrank in einem Karton entdeckt, passen perfekt. Die sind auch noch völlig in Ordnung, praktisch brandneu, mal abgesehen von einem schwarzen Schmierstreifen auf der rechten Zehe. Er klemmt sie sich unter den Arm, packt das kaputte Spielzeug, Feuchttücher und einen halbvollen Tiegel mit Babycreme zusammen (in seinem Berufsfeld hat alles Potenzial) und wirft den ganzen Kram in den Müllsack.
Alles, was er bräuchte, ist ein bisschen Glück. Das eine leere Haus mit einem Koffer voller Geld. Dieses Haus hier könnte er der Bank für … sagen wir … zehntausend abkaufen? Vielleicht sogar für weniger in dieser Gegend. Dann renovieren, mit seiner Schwester und Freunden einziehen. Alles ganz legal diesmal.
Eigentum soll ja sesshaft machen, aber wenn man sich in dieser Stadt so umschaut, stimmt das nur bedingt. Alles, was er besitzt, passt in einen Schuhkarton. Fotos, eine Landkarte von Afrika, eine Lesebrille, die Medaillen von den Anonymen und ein altes, sechzig Minuten langes Band, auf dem sich seine Familie miteinander unterhält, aufgenommen, bevor sein kleiner Bruder gestorben ist. Kassetten halten nicht ewig. Er sollte das Band digitalisieren lassen. Von Computern versteht er ein bisschen was, hat er sich selbst beigebracht, aber Reverend Alan hat versprochen, ihn zu einem richtigen Kurs zu schicken. Und da sollen sie ihm zuerst zeigen, wie man so was digitalisiert. Fotos, Stimmen – die braucht man, wenn man enge Bindungen vermisst. Keine schicken Sneakers und Flatscreens.
Plötzlich hämmert es unten an die Tür, und er macht sich fast in die Hose. Er hatte noch nicht mal Zeit, die Örtlichkeiten zu nutzen. Vielleicht hat die Familie es sich noch einmal anders überlegt und ihm nun die Cops auf den Hals gehetzt. Die sind nicht nett zu streunenden Hunden, nicht mal zu den einsamen, die nur bellen und nicht beißen.
Bestimmt schafft er es noch durch die Hintertür. Im Kopf überschlägt er gerade, in welchem Sack sich die wertvollste Beute befindet, als er Ramóns Stimme hört: «Yo! Lass deinen schwarzen Bruder rein, Mann! Ist kalt hier draußen!»
Er macht seinem Freund auf, der heute noch nervöser als sonst wirkt, über einem ramponierten Einkaufswagen hängt und die Straße hoch und runter späht. Als er TK sieht, verwandelt sich sein misstrauischer Gesichtsausdruck in ein breites Grinsen. Er winkt ihm mit dem Billig-Handy zu, das Obama Leuten wie ihnen schenkt, damit sie sich auf Jobs bewerben können. Sie eignen sich auch, um wie heute eine Hausdurchsuchung zu verabreden. Ramón besteht allerdings darauf, lange, neutral formulierte SMS zu verschicken, falls der Staat sie über dieses Handy überwacht.
«Hey, alter Freund, hab deine Nachricht bekommen. Hat nur gedauert, bis ich einen Einkaufswagen aufgetrieben hab. Der verdammte Bioladen kettet die an.»
«Da hast du es, Bruder – Gentrifizierung! Strom gibt’s nicht hier, aber ich habe noch Aufschnitt und Käse gefunden. Willst du was?»
Ramón späht ins Innere des Hauses, und er spielt mit den Perlen des Rosenkranzes in seiner Tasche. Sein Blick wandert schnell hierhin und dorthin, dann fixiert er TK und die roten Chucks unter seinem Arm. Die kann man schlecht übersehen. «Nette Schuhe», sagt er.
«Genau meine Farbe, find ich. Passt zu meinen Augen.»
Ramón schaut verwirrt.
«Die sind gerötet», erklärt TK.
«Verstehe.» Ramón lacht schnaubend, aber man spürt seinen Neid.
«Ich würd dir mein letztes Hemd geben, Ramón, das weißt du doch», versucht TK es nochmal. «Aber die Schuhe sind was anderes.»
«Würden mir bestimmt eh nicht passen.» Ramón tritt von einem Fuß auf den anderen. Dabei klappen die Sohlen seiner schwarzen Schnürschuhe auf und hängen lose in der Luft.
TK seufzt. Der alte Schwachkopf. «Eigentlich hab ich rote Schuhe noch nie gemocht.» Stimmt zwar nicht, aber zum Teufel damit, dafür strahlt Ramón plötzlich wie eine Glühbirne. «Jetzt komm endlich ins Haus. Du lässt ja die ganze Kälte rein», sagt TK und hilft seinem Freund, den Einkaufswagen die Verandastufen hochzuschleppen.
Die Tochter des Detectives
Layla ist spät dran für die Sonntagsprobe. Schuld hat ihre Mutter, die sie um vier Uhr morgens geweckt hat, weil sie an einen Tatort musste. Und vergiss nicht den Sicherheitscode für den Waffenschrank, Erbse, nur für alle Fälle. Als sie noch zwei Eltern mit unterschiedlichen Schichten gehabt hat, war wenigstens immer einer da, da gab es kein für alle Fälle. Dafür jemanden, der sie zu ihren Verabredungen und Terminen bringen konnte – sie hat nämlich auch Termine, die sie einhalten muss, danke der Nachfrage, Mom. Stattdessen wartet sie gerade schon eine volle Stunde auf den Bus, dick eingepackt gegen die Kälte, malt in ihrem Collegeblock herum und widersteht der Versuchung, auch auf die Bank zu kritzeln, wie so viele vor ihr. Nein, sie wird auf andere Art Spuren in dieser Welt hinterlassen.
Dass sie an solchen Nachmittagskursen teilnimmt, soll Layla helfen, mehr aus sich herauszukommen. Natürlich weiß sie, dass das für ihre Mutter nichts anderes ist als billige Kinderbetreuung, damit sie sich nicht so schlecht fühlen muss. Dazu hat sie aber allen Grund. Es ist ihre Schuld, dass sie nach der Scheidung in die Innenstadt gezogen sind. Ihre Schuld, dass Laylas Freunde alle in Pleasant Ridge wohnen, was zwar bloß auf der anderen Seite der Eight Mile Road liegt, aber genauso gut ein anderer Planet sein könnte, wenn man kein Auto hat.
Sie schiebt sich durch die Doppeltüren der Masque Theater School und rennt die zwei Stockwerke hinauf zur Hauptbühne. Sie ist erleichtert, als sie auf der Treppe einen seltsamen Singsang hört. Die anderen sind erst bei den Aufwärmübungen, Gott sei Dank. Sie lässt die Tasche neben der Tür fallen und sucht nach Cas – nicht schwierig in einem Raum voller schwarzer Jugendlicher. Sie schleicht zu ihr hinüber und fällt in die auf- und absteigende Melodie der Vokalübungen ein. Mrs. Westcott zieht die Augenbrauen hoch – halb Begrüßung, halb freundliche Ermahnung.
Shawnia leitet den Chor, hebt die Faust, um anzuzeigen, dass die Übung nun wechselt. Black Power, der Redestab, all die entscheidenden Rituale. Sie halten inne, warten auf ihr Zeichen.
Shawnia beginnt, zu zucken und sich zu winden, als hätte sie einen Krampfanfall. Sie ahmen sie nach, die Knochen werden zu Gummi, die Glieder zu Tentakeln. Layla lässt den Rumpf nach vorn fallen, ihre unbezähmbaren Locken streifen den Boden. (Und das ist keine Haarverlängerung, danke der Nachfrage. Sie ist auf konventionelle Art zu den langen Locken gekommen, hat sie von ihrer Mom geerbt, und ja, ganz recht, sie ist ein Mischling, und nein, du kannst die Haare nicht anfassen, verdammt, wofür hältst du das hier, einen Streichelzoo?)
«Konnte dich niemand bringen?», flüstert Cassandra. «Ich wette, Dorian hätte dich fahren können.»
Layla versucht, wie zufällig nach ihr zu schlagen. Aber Cas duckt sich, als würde das zu ihrem Bewegungsablauf gehören.
«Oh nein, zu langsam!», flüstert sie neckend, und beide grinsen.
«Konzentration, bitte!», ruft Mrs. Westcott. Sie meint, das Theater habe sich direkt aus archaischen Opferritualen entwickelt. Irgendwelche alten Stämme hätten bei jeder Wintersonnenwende ihren Anführer den Göttern geopfert, damit der Frühling wiederkommen würde. Bis ihnen auffiel, dass es vielleicht keine besonders schlaue Idee war, immer die fähigsten Leute aus ihren Reihen umzubringen. Also begannen sie, die Rituale mit Masken bloß vorzuspielen, um die Götter zu täuschen. Der alte Anführer kehrte dann als neuer Häuptling zurück. Na ja, so gut wie neu eben.
Klar kann man das, denkt Layla, sich neu erfinden, in eine Rolle schlüpfen. Sie hat sogar geglaubt, das wäre ganz einfach: neues Schuljahr, neue Schule am anderen Ende der Stadt, brandneue Layla.
Sie nutzte das schlechte Gewissen ihres Vaters wegen der Scheidung erfolgreich aus, damit er ihr neue Klamotten spendierte und sie sich unter die coolen Kids mischen konnte. Aber die ewige Schauspielerei war nicht einfach. Sich immer zu verstellen ist ungefähr so nervenaufreibend, wie sich die Haare blond zu färben, jedenfalls wenn man Cas glaubt. «Vertrau mir, immer darauf zu achten, dass man den dunklen Ansatz nicht sieht, das ist echt anstrengend.»
Außerdem lassen alte Götter sich anscheinend leichter täuschen als Teenager. Kleider machen eben noch kein cooles Mädchen. Früher oder später geht die Sache schief, man sagt etwas unglaublich Uncooles, zum Beispiel dass man gern Shakespeare liest.
Nach einer Woche hat sie es sattgehabt, ist absichtlich aus der Rolle gefallen, damit sie wieder Jeans und Geek-T-Shirts tragen konnte wie sonst. War so schon schwer genug, eine Afro-Latina zu sein, die immer zwischen den Stühlen sitzt und sich entscheiden muss zwischen den weißen und den schwarzen Kids, weil beides zusammen nicht geht. Trotzdem war es ätzend, plötzlich wieder zur Außenseiterin zu werden und mittags allein in der Cafeteria zu essen.
Bis sie sich mit Cassandra angefreundet hat. Genau genommen ist es eher umgekehrt gewesen, denn Cassandra spielt wirklich in einer ganz anderen Liga als sie. Cas sieht echt scharf aus, obwohl sie sich nie schminkt, sie hat feines, hellbraunes Haar, große graublaue Augen und Brüste, bei denen die Jungs lang hinschlagen. Und ihr ist das alles scheißegal, sie macht, was sie will.
So sind sie auch Freunde geworden: Cas hat Ms. Combrink eine blöde Zicke genannt, und Layla hat mit einem vorgetäuschten Hustenanfall versucht, sie zu decken. Trotzdem mussten sie dann beide nachsitzen, kamen währenddessen ins Gespräch und haben sich zum ersten Mal richtig unterhalten. Dabei hat sie dann Cas überredet, doch mit zum Vorsprechen in die Schauspielschule zu kommen. Cas wurde genommen, ohne dass sie auch nur einmal zu Hause geprobt hatte und obwohl sie beim Singen klingt wie ein Frosch mit schwerem Emphysem. Lektion fürs Leben: Mit gutem Aussehen und einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein kriegt man einfach alles, was man will, jeden Jungen und die coolsten Freunde. Aber Cas’ Wahl ist trotzdem auf sie gefallen. Layla ist unglaublich dankbar dafür – und völlig paranoid. Sie wartet die ganze Zeit auf den Tag, an dem Cas ihr wie in Carrie einen Eimer Schweineblut über den Kopf kippt.
«Bäh. Würd ich nie tun», hat Cas gesagt. «Wenn ich dich öffentlich demütigen wollte, würde ich das viel subtiler und gemeiner machen.»
Kann sein, dennoch ist Layla lieber vorsichtig und bedrängt Cas nicht, wenn die jedes Mal das Thema wechselt, sobald ein Gespräch mal persönlicher wird. Das gehört zu den Dingen, die Layla an ihr bewundert. Cas ist geheimnisvoll. Wie Oz. Aber anders als bei dem Pseudo-Zauberer kann man bei Cas nicht einfach den Vorhang aufziehen. Hinter dem Vorhang hängen bei ihr nur noch mehr Vorhänge. Auch ein Grund, warum sie so verdammt cool ist. Aber das kann Layla ihr nicht sagen, steigt ihr sonst nur zu Kopf, und so ein aufgeblasener Kopf würde sie sicher ganz aus der Balance bringen, wo ihre großen Brüste schon so stark ins Gewicht fallen.
Shawnia hebt wieder die Faust, es folgt die letzte Übung, bevor es mit der richtigen Probe losgeht: der Dankbarkeitskreis. Zweimal klatschen, einmal stampfen, dann im Uhrzeigersinn weiter. «Ich bin heute glücklich», beginnt Shawnia, «weil … ich heute den Brief von der University of Michigan bekommen habe. Ich bin angenommen!»
Klatsch-klatsch-stampf. Alle jubeln.
Layla hat da für sich höhere Ziele. Nach der Schule will sie endlich raus aus Michigan. Natürlich ist ihr klar, dass sie es nicht nach New York oder Los Angeles schaffen wird, aber es gibt noch andere Städte mit großartigen Schauspielschulen. Chicago, Austin, Pittsburgh.
«Ich bin heute glücklich, weil ich ein Date für den Abschlussball habe», sagt Jessie. Klatsch-klatsch-stampf.
«Hat sie den bezahlt?», flüstert Cas, und Layla muss sich anstrengen, um nicht loszulachen. Vielleicht bietet Jessie sich für Cas als Opfer an, weil sie hier die einzige andere Weiße ist. «Ach, übrigens …» Cas hält ihr das Smartphone vor die Nase, damit sie den Tweet von Dorian sehen kann. «Bin nachher an der Rampe. Hat wer Lust auf Skaten?» Es wird wieder geklatscht, und es geht weiter im Kreis.
«Du Stalkerin», flüstert Layla und versucht, nicht zu zeigen, dass sie ganz aufgeregt ist. Wer hat ein Auto und könnte sie hinbringen?
«Mach ich doch nur für dich, Süße. Für die Liiiiebe.»
«Keine Handys!», ruft Mrs. Westcott von der Bühne.
«Ich bin glücklich, weil das Wochenende zu Ende ist», verkündet David und erntet Buhrufe. Lauter fügt er hinzu: «Morgen kann ich wieder zur Schule und meine Freunde sehen!» Klatsch-klatsch-stampf.
«Ich hab eine SMS gekriegt von einem Jungen, der mich mag», sagt Chantelle.
«Aber magst du ihn denn auch?», neckt sie Mrs. Westcott.
«Oh ja!» Chantelle macht ein selbstzufriedenes Gesicht. Klatsch-klatsch-stampf.
«Ich habe einen Jungen angesprochen, den ich mag», sagt Keith. Klatsch-klatsch-stampf, laute Pfiffe.
«Mein kleiner Bruder hat es ins Hockeyteam geschafft», sagt Cas. «Viel Training, weniger Zeit, mir auf den Nerv zu gehen.» Klatsch-klatsch-stampf.
«Ich bin glücklich, weil …» Shit, Layla hatte nun den halben Kreis lang Zeit, sich was zu überlegen. «Weil ich mich nachher mit meinem Freund treffe.» Sie wird rot. Klatsch-klatsch-stampf. Sprich es aus, und es wird wahr. Zumindest muss sie sich jetzt darum bemühen.
Sie wollte eigentlich gar nichts rauchen. Aber nach der Probe, als sie im Park den Jungs beim Skaten zugesehen hat, vertrieb das Gras die Langeweile, während sie auf ihre Mutter wartete, die immer wieder SMS schickte, dass sie aufgehalten wurde. Schließlich waren alle anderen schon weg, sogar Cas, und nur sie und Dorian waren übrig. Aber der blieb auf Distanz, und damit musste sie sich wohl abfinden.
Er will sie als kleine Schwester. Sie will etwas von ihm, das absolut nicht geschwisterlich ist. Dabei ist der Altersunterschied gar nicht so groß. Immerhin wird sie im Dezember sechzehn. Aber er ist schon fertig mit der Schule, macht ein Jahr Pause, schläft auf der Couch bei irgendwelchen Musikerfreunden in Hubbard Farms und überlegt, ob er aufs College will oder nicht. «Im richtigen Licht betrachtet ist Detroit fast wie das neue Herz der Boheme», hat er ihr erklärt, ihr den Joint gereicht und dabei aufgepasst, dass ihre Finger sich nicht berührten. Im richtigen Licht betrachtet könnte er ihr Florizel sein und sie seine Perdita, hätte sie ihm gern gesagt, aber wahrscheinlich kennt er Shakespeares Wintermärchen nicht und würde sie erst recht für eine Idiotin halten.
Er ist nicht der einzige Mann in ihrem Leben, der es einfach nicht kapiert. Gestern kam wie alle zwei Wochen der Anruf ihres Vaters (als wäre sie im Gefängnis oder so), und das Gespräch ist schlecht gelaufen, das nagt an ihr. Sie hat ihm von ihrer Rolle im Stück erzählt, das schnurlose Telefon ans Ohr gedrückt, während NyanCat zusammengerollt an ihrem Bein schnurrte, und einen Moment lang gehörte er ihr ganz allein – so wie früher. Er versprach sogar, dass er herfliegen und sich das Stück ansehen würde, falls sein Terminplan das zuließe, denn das Letzte, was er gesehen habe, sei ein schlechtes Remake von Arielle, die Meerjungfrau gewesen, zu allem Übel noch als Eisrevue.
«Ich frag mich ja, wie man auf Flossen überhaupt Schlittschuh laufen soll», sagte sie und blendete ihre kreischenden Stiefgeschwister am anderen Ende aus.
«Ach, das ging schon», sagte William, und sie konnte vor sich sehen, wie er eine Augenbraue hochzog. «Aber es war trotzdem schlimm, Lay, du machst dir gar keine Vorstellung.»
Sie lachte. «Vielleicht lande ich da ja selbst eines Tages. Als Meereshexe auf Schlittschuhen.» An dieser Stelle hätte er eigentlich sagen müssen: Machst du Witze? Du hättest natürlich die Hauptrolle, mein Schatz! Und dann hätte sie sich künstlich darüber aufgeregt und anschließend vielleicht nebenbei diesen Jungen erwähnt, den sie kennengelernt hat. Das hatte zwischen ihnen beiden Tradition, eine kleine Komödie mit festen Regeln. Aber dann hat sein neues Leben dazwischengefunkt, wie die älteren Nachbarn, die einen bei einer Party plötzlich zwingen, die Musik leiser zu stellen.
«Warte mal eben, Lay. Nein! Julie! Hör auf, dein Essen auf den Fußboden zu werfen! Du weißt doch, dass du das nicht darfst, Häschen.»
«Erklär mir doch nochmal, wieso ich in Detroit bleiben muss.» Es sollte nur so dahingesagt klingen, damit er sich wieder auf ihr Gespräch konzentrierte, aber er spulte gleich den üblichen Vortrag ab. Nur bis du mit der Highschool fertig bist. Deine Mutter braucht dich. Ich muss wirklich zusehen, dass die Sache hier funktioniert. Ist nicht einfach mit kleinen Stiefkindern.
«Klar, und das Letzte, was du dabei brauchst, ist deine halbwüchsige Tochter, die dich daran erinnert, wie du deine erste Ehe gegen die Wand gefahren hast», erwiderte sie spitz.
Darauf folgte eine lange Stille in der Leitung.
«Hallo? Noch da?» Auf einmal vermisste sie die ganzen selbstgebastelten Sachen, die sie beim Umzug entsorgt hatte. Das maßstabsgerechte Modell des Sonnensystems mit den im Dunkeln leuchtenden Planeten. Die hatte sie mit ihrem Dad in ein Gestell gehängt. Dann der Traumfänger mit den funkelnden Kristallen, bei dem er ihr geholfen hatte, als sie sieben war. Das Design war inspiriert von den Ojibwe, die hier früher ihre Jagdgründe gehabt hatten, wie er ihr erklärte. Welche Perlen der Weisheit er nun wohl an seine neuen Kinder weitergab?
«Erde an Dad?», versuchte sie es mit einem Witz.
Er klang weit entfernt. «Das war eine sehr böse Bemerkung, Layla. Damit hast du mich tief verletzt.» Da war wieder dieser flehende Ton in seiner Stimme, den sie heimlich PTSS nennt: posttraumatisches Scheidungssyndrom. Sei doch vernünftig. «Außerdem weißt du genau, dass deine Mutter dich braucht.»
«Bssss. Und das war leider die falsche Antwort! Aber danke fürs Mitmachen.» Damit hat sie aufgelegt, bevor er noch etwas anderes sagen konnte. Dann wartete sie darauf, dass er zurückrief. Tat er aber nicht. Nein, sie wird sich nicht entschuldigen, denkt sie wütend. Diesmal nicht.
Sie bemerkt gar nicht den weißen Crown Vic, der bei der Rampe angehalten hat und nun so langsam vorbeirollt, wie das nur Cops und Gangs und gelangweilte Teenager tun. Sie ist ganz benommen vom Gras, versunken in den Anblick von Dorian auf der Betonrampe, ein perfekter Moment mit dem Licht der Straßenlaterne genau hinter seinem Kopf. Jetzt beschirmt er seine Augen mit der Hand, wegen der Scheinwerfer. Die Beanie hat er weit über die Koteletten gezogen. «Hey, Lay!», ruft er. «Ich glaub, das ist deine Mom.» Aber es ist, als ob sie der Iranerin im Eckladen zuhört – Töne und Silben, deren Bedeutung ihr verborgen bleibt, rauschen einfach an ihr vorbei.
Er schiebt das Skatebord über die Kante und vertraut sich der Schwerkraft an. Er rollt die Schräge hinunter, dann an der anderen Seite wieder hinauf, beschreibt träge Kurven im grauen Matsch des geschmolzenen Schnees. Wenn sie die Augen zusammenkneift, sieht es fast aus, als würde er einen Kondensstreifen hinter sich herziehen. Wirklich schön. Wie Kunst. Oder Musik, denkt sie, dieses Kratzen der Räder auf dem Zement.
«Lay.» Er fährt einen Bogen auf sie zu und hält sich am Baumstamm fest. Sein Atem wird weiß, sieht aus wie eine Sprechblase im Comic. ‹Ley› bedeutet auf Spanisch ‹Gesetz›, so viel zum Humor ihrer Mutter.
«Was?» Sie ist böse, weil er die Magie des Augenblicks durchbrochen hat. Und dann heult kurz eine Sirene auf, und die Lichter im Kühlergrill des Crown Vics flackern blau und rot. Etwas subtiler als das Blaulicht, das sie aufs Dach stecken, aber nicht sehr.
«Shit!» Sie lässt den Joint fallen. Oh Mann, warum kann ihre Mutter so was nicht lassen? Sie rutscht vom Baum, ihre Arme und Beine fühlen sich an, als gehörten sie nicht zu ihr und wären noch nicht bereit, auf ihr Kommando zu hören. Sie steckt die Hände unter die Achseln, nicht nur damit man den Geruch vom Joint daran nicht so wahrnimmt, sondern auch, damit ihre Arme nicht einfach wegfliegen, es fühlt sich nämlich ganz so an.
«Aufwachen.» Dorian sticht ihr mit dem Finger in die Rippen. Er hat gemerkt, dass sie in anderen Sphären schwebt, und lacht über sie. Aber nicht auf die fiese Art.
«Okay, okay», murmelt sie, und ihr Gesicht läuft rot an. Sie konzentriert sich auf die lächerliche Choreographie des Gehens. Ein Fuß vor den anderen … wer hat den Mist eigentlich erfunden? Mal im Ernst!
Dorian schüttelt den Kopf und lässt das Skateboard zum Wagen rollen. Er greift nach dem Außenspiegel, um abzubremsen, und beugt sich dann durchs Fenster. «Hola, Mrs. V.!»
«Ms.», stellt ihre Mutter richtig. «Und ich bevorzuge Detective Versado. Oder Ma’am. Wie in ‹Nein, Ma’am, der Grund, warum ich wie eine abgebrannte Hanfplantage stinke, ist definitiv kein Marihuana.›»
«In einigen Staaten ist es schon legal.»
«Dann zieh nach Colorado.»
«Mom», quietscht Layla. «Lass das. Bitte.» Sie macht hinten die Tür auf und steigt ein.
«Willst du nicht nach vorn kommen?»
«Nee. Hier hinten kann ich so tun, als wäre ich ein richtiger Verbrecher. Du behandelst mich doch sowieso wie eine Kriminelle.»
«Also, wenn ich dich dabei erwische, wie du dieses Zeug rauchst …»
«Wirst du nicht», erwidert Layla. Also, erwischen soll das heißen. Und zwar weil sie sich auf dem Rücksitz versteckt und diese Unterhaltung jetzt ganz schnell beenden wird. Dann kann sie sich ausstrecken und nur die Lichter draußen anschauen, wie sie es früher als Kind gemacht hat, wenn sie essen gegangen sind und sie hinten eingeschlafen ist und ihr Dad sie ins Haus getragen und ins Bett gebracht hat. Er hat nach Zigaretten und Schweiß und einem kräftigen Aftershave gerochen, das er immer bei besonderen Anlässen auflegte. Die Sehnsucht nach diesem Kind und dieser glücklichen Familie brennt in ihr.
«Bis dann», sagt Dorian und rollt davon.
«Tschüs», sagt sie im Ton beiläufiger Geringschätzung, was bei solchen Jungs zu wirken scheint. Desinteresse und Eyeliner. Und Brüste. Und drei Jahre älter sein und dabei kein Riesenidiot. Oh Mann, sie ist ein hoffnungsloser Fall.
Ihre Mutter beobachtet sie im Rückspiegel und hat wieder diese nach unten zeigende Falte am Mundwinkel, die früher noch nicht da war. PTSS. Posttraumatisches Scheidungssyndrom. «Wusstest du, dass es Studien darüber gibt –»
«Ja, ja, ich weiß, Mom. Gras schädigt das Hirn, und es wird mir noch leidtun, wenn ich irgendwann nur noch als Burgerwenderin arbeiten kann. Oder schlimmer. Bei der Polizei.»
«Stimmt, das wollen wir unter keinen Umständen», sagt ihre Mutter ruhig, aber Layla merkt, dass sie das getroffen hat, an der Art, wie sie das Steuer herumreißt, als sie auf den Freeway fährt.
«Ich hatte da heute einen echt merkwürdigen Fall», sagt ihre Mutter dann. Bauer eröffnet das Spiel. Layla fällt nicht darauf rein. Aus dem Drop-down-Menü zur Verfügung stehender Launen wählt sie den demonstrativen Schmollmodus.
«Musst du unbedingt mit meinen Freunden reden?»
«Macht mir auch keinen Spaß. Jedenfalls, wenn es Dorian ist. Aber Cas mag ich.»
«Und hör auf, so eine Beliebtheitsskala aufzustellen, das ist kein Wettbewerb.»
«Willst du lieber nach Hause laufen?»
«Dorian hätte mich ja bringen können.»
«Ist schon ganz süß, schätze ich, soweit man das über eine lahme Haschtüte sagen kann.»
«Mom!» Layla ist am Ende. Wenn sogar ihre Mutter es sofort schnallt, dann weiß es die ganze Welt. Inklusive Dorian. Darüber mag sie gar nicht nachdenken.
«Okay, Waffenstillstand. Ich hab dir Lipgloss gekauft.»
«Spitze», sagt Layla, setzt sich auf, zückt das Handy und tippt eine SMS an Cas.
>Lay: Jetzt kommt sie mich holen! Nach drei STUNDEN!
>Cas: Immerhin, drei Stunden mit Dorian. Viel Zeit für die Liiiiebe. Oder hättest du noch lieber sex gehabt?
>Lay: Bitte???
>Cas: Aaargh! Sechs! Stunden! Nicht Sex. Scheiß Autokorrektur.
>Lay: Freudscher Versprecher, oder wie?
>Cas: :):):)
«Ich musste das Lipgloss schon mal aufmachen und benutzen», sagt ihre Mutter. «Macht dir hoffentlich nichts aus.»
«Mom, das ist Teufelszeug. Es trocknet die Lippen aus, und dann muss man es immer wieder benutzen.»
Aber der Gedanke an cremiges, süßes Lipgloss kommt ihr plötzlich sehr verführerisch vor. Sie presst die Lippen aufeinander und fühlt, ob sie trocken sind. Ziemlich trocken. Sie fährt mit der Zunge über die Schneidezähne und spürt jeden einzelnen Zahn als Teil ihres Schädels. Dass die Zähne genau genommen ein Stück freiliegender Knochen sind … bei dem Gedanken wird ihr leicht übel. Sie konzentriert sich schnell wieder auf die letzte Bemerkung ihrer Mutter. Was hatte sie doch gleich gesagt? Ach ja. «Und welche Geschmacksrichtung?»
«Kirsch. Willst du gar nicht wissen, wofür ich das Lipgloss gebraucht habe?»
«Um es dir auf die Lippen zu schmieren?» Drop-down-Menü: Sarkasmus, höchste Stufe.
«Um den Geruch einer Leiche zu überdecken.»
«Funktioniert nicht. Hab ich mal im Krimikanal gesehen. Außerdem ist das eklig. Ich will nichts von irgendwelchen Toten hören.»
>Lay: Widerliche Cop-Geschichten #Yay #notyay
>Cas: