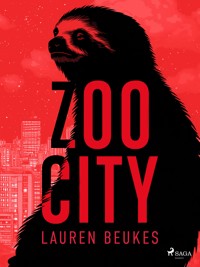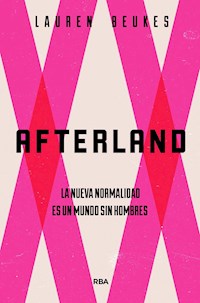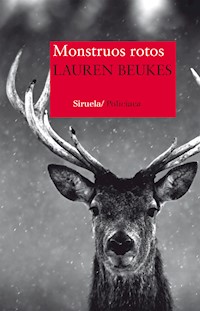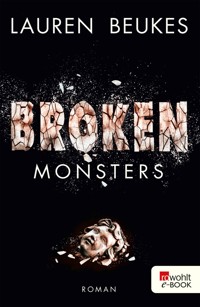9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jetzt als Serie bei Apple TV+: Der Zeitreise-Thriller mit Elisabeth Moss («The Handmaid's Tale»), Wagner Moura («Narcos») und Jamie Bell («Billy Elliot»)! Ein Mörder aus der Vergangenheit. Das Mädchen, das ihm entkam. Eine Jagd, die längst vorbei ist. Und doch erst beginnt ... Chicago zur Zeit der Großen Depression. Lee Harper lebt auf der Straße. Er ist kaltblütig, hochgefährlich, von Wahnvorstellungen getrieben. Seit er die strahlend schöne Tänzerin Jeanette sah, träumt er von seinen «Shining Girls». Er will nur eines: ihr Licht für immer auslöschen. Eines Tages fällt ihm der Schlüssel zu einem alten Haus in die Hände - ein Portal. Von nun an reist Harper durch die Zeit, um zu töten. Niemand kann ihn stoppen, keiner vermag die Spuren zu deuten, die er am Tatort hinterlässt. Dinge, die noch nicht oder nicht mehr existieren. Doch dann überlebt eines von Harpers Opfern. Der jungen Kirby gelingt es, die unmöglichen Puzzleteile zusammenzusetzen. Und sie beginnt, den Killer durch die Zeit zu jagen. «Ich komme nicht davon los.» (Gillian Flynn, Autorin von «Gone Girl») «‹Shining Girls› ist originell, brillant erzählt, und ehrlich gesagt habe ich mich zu Tode gegruselt. Dieses Buch ist etwas Besonderes.» (Tana French) «Clevere Geschichte, klasse geschrieben.» (Stephen King, The Times: Meine persönliche Ferienlektüre) «Eine Idee wie aus der Feder Stephen Kings, aber so vielschichtig und stilsicher umgesetzt, dass sie Beukes' ganz eigene Prägung bekommt.» (Time) «Ein herausragender Spannungsroman, eine großartige Zeitreise- und Serienkillergeschichte, die den Kopf schwirren, das Herz rasen lässt - und alles hält, was sie verspricht.» (Cory Doctorow) «Ich liebe die ‹Shining Girls›. Etwas völlig Neues, wie eine Mischung aus ‹Die Frau des Zeitreisenden› und ‹Das Schweigen der Lämmer›. Eine düstere, gnadenlose, zeitverdrehende und süchtig machende Mordgeschichte. Herzrhythmusstörungen garantiert! Ein Buch, das strahlt.» (Matt Haig, Autor von ‹Die Radleys›) «Sehr geistreich - und der totale Wahnsinn. Beukes hat die Verbindung von Realität und Phantastik meisterhaft im Griff.» (William Gibson) «So fesselnd wie originell ... ein wunderschöner Roman. Lesen Sie ihn - er ist hypnotisch!» (The Sun) «Eine düstere Geschichte voller Überraschungen. Lassen Sie das Licht an!» (The Daily Mail) «Willkommen auf einem gnadenlosen Ritt durch das 20. Jahrhundert - in Gesellschaft der vermutlich bissigsten und zähesten Heldin des Jahres.» (The Observer)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Lauren Beukes
Shining Girls
Über dieses Buch
Ein Mörder aus der Vergangenheit.
Das Mädchen, das ihm entkam.
Eine Jagd, die längst vorbei ist. Und doch erst beginnt …
Chicago zur Zeit der Großen Depression. Lee Harper lebt auf der Straße. Er ist kaltblütig, hochgefährlich, von Wahnvorstellungen getrieben. Seit er die strahlend schöne Tänzerin Jeanette sah, träumt er von seinen «Shining Girls». Er will nur eines: ihr Licht für immer auslöschen. Eines Tages fällt ihm der Schlüssel zu einem alten Haus in die Hände - ein Portal. Von nun an reist Harper durch die Zeit, um zu töten. Niemand kann ihn stoppen, keiner vermag die Spuren zu deuten, die er am Tatort hinterlässt. Dinge, die noch nicht oder nicht mehr existieren. Doch dann überlebt eines von Harpers Opfern. Der jungen Kirby gelingt es, die unmöglichen Puzzleteile zusammenzusetzen. Und sie beginnt, den Killer durch die Zeit zu jagen.
«Ich komme nicht davon los.» (Gillian Flynn, Autorin von «Gone Girl»)
«‹Shining Girls› ist originell, brillant erzählt, und ehrlich gesagt habe ich mich zu Tode gegruselt. Dieses Buch ist etwas Besonderes.» (Tana French)
«Clevere Geschichte, klasse geschrieben.» (Stephen King, The Times: Meine persönliche Ferienlektüre)
«Eine Idee wie aus der Feder Stephen Kings, aber so vielschichtig und stilsicher umgesetzt, dass sie Beukes' ganz eigene Prägung bekommt.» (Time)
«Ein herausragender Spannungsroman, eine großartige Zeitreise- und Serienkillergeschichte, die den Kopf schwirren, das Herz rasen lässt - und alles hält, was sie verspricht.» (Cory Doctorow)
«Ich liebe die ‹Shining Girls›. Etwas völlig Neues, wie eine Mischung aus ‹Die Frau des Zeitreisenden› und ‹Das Schweigen der Lämmer›. Eine düstere, gnadenlose, zeitverdrehende und süchtig machende Mordgeschichte. Herzrhythmusstörungen garantiert! Ein Buch, das strahlt.» (Matt Haig, Autor von ‹Die Radleys›)
«Sehr geistreich - und der totale Wahnsinn. Beukes hat die Verbindung von Realität und Phantastik meisterhaft im Griff.» (William Gibson)
«So fesselnd wie originell … ein wunderschöner Roman. Lesen Sie ihn - er ist hypnotisch!» (The Sun)
«Eine düstere Geschichte voller Überraschungen. Lassen Sie das Licht an!» (The Daily Mail)
«Willkommen auf einem gnadenlosen Ritt durch das 20. Jahrhundert - in Gesellschaft der vermutlich bissigsten und zähesten Heldin des Jahres.» (The Observer)
Vita
Lauren Beukes wurde 1976 in Johannesburg, Südafrika, geboren. Sie arbeitet als Autorin und Journalistin und schreibt Drehbücher. Für ihren Roman «Zoo City» gewann sie einen der renommiertesten internationalen Science-Fiction-Preise, den Arthur C. Clarke Award. Heute lebt sie zusammen mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Kapstadt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel «The Shining Girls» bei HarperCollins Publishers, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
«The Shining Girls» Copyright © 2012 by Lauren Beukes
Redaktion Katharina Rottenbacher
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich,
nach dem Original von: © HarperCollinsPublishers Ltd 2013
Coverabbildung Titelfoto: plainpicture/Millennium;
Titeltypografie: © Craig Ward / www.wordsarepictures.co.uk
ISBN 978-3-644-48781-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Matthew
Harper
17. Juli 1974
Er umklammert das orangefarbene Plastikpony in der Tasche seines Jacketts. Es liegt schweißig in seiner Hand. Hier ist Hochsommer, zu heiß für das, was er trägt. Aber er hat gelernt, bei diesem Vorhaben eine Art Uniform anzulegen; vor allem Jeans. Er geht mit großen Schritten – ein Mann, der zu einem Ziel unterwegs ist, trotz seines Hinkens. Harper Curtis ist kein Schmarotzer. Und die Zeit wartet auf niemanden. Außer, wenn sie es tut.
Das Mädchen sitzt im Schneidersitz auf dem Boden, ihre bloßen Knie sind so weiß und knochig wie Vogelschädel, und sie haben Grasflecken. Bei dem knirschenden Geräusch seiner Stiefel auf dem Kies sieht die Kleine auf, aber nur lang genug für ihn, um zu erkennen, dass ihre Augen unter diesem Gewirr schmuddeliger Locken braun sind, dann beachtet sie ihn nicht mehr, sondern widmet sich wieder ihrer Beschäftigung.
Harper ist enttäuscht. Er hatte sich beim Näherkommen vorgestellt, ihre Augen wären vielleicht blau; die Farbe des Lake Michigan, weit draußen, wo die Uferlinie verschwindet und man sich fühlt, als wäre man mitten auf dem Ozean. Braun ist die Farbe des Krabbenfischens, wenn der Schlamm an den seichten Stellen aufgewühlt ist und man Scheiße nicht als Scheiße erkennt.
«Was machst du da?», fragt er und lässt seine Stimme fröhlich klingen. Er geht neben ihr in dem spärlichen Gras in die Hocke. Wirklich, er hat noch nie ein Kind mit so wildem Haar gesehen. Als hätte ein Staubteufel, ihr eigener kleiner Wirbelsturm, die Kleine herumkreiseln lassen und auch noch den ganzen Ramsch durcheinandergeschleudert, der wahllos um sie verteilt ist: ein paar rostige Blechdosen, ein auf die Seite gekippter, verbogener Fahrradreifen, von dem die Speichen hochstehen. Ihre Aufmerksamkeit ist auf eine angeschlagene Teetasse gerichtet, die sie umgedreht hat, sodass die silberfarbenen Blumen am oberen Rand im Gras verschwinden. Der Griff ist abgebrochen, hat zwei grobe Stümpfe hinterlassen. «Spielst du Teekränzchen, Herzchen?», versucht er es noch einmal.
«Das ist kein Teekränzchen», murmelt sie in den blütenblattförmigen Kragen ihres Karohemdes. Kinder mit Sommersprossen sollten nicht so ernst sein, denkt er. Das passt nicht zu ihnen.
«Tja, auch gut», sagt er. «Ich trinke sowieso lieber Kaffee. Geben Sie mir bitte eine Tasse, Ma’am? Schwarz, mit drei Stück Würfelzucker, okay?» Er greift nach der angestoßenen Porzellantasse, und das Mädchen schreit auf und schlägt seine Hand weg. Ein dunkles, wütendes Summen dringt unter der umgedrehten Tasse hervor.
«Meine Güte. Was hast du denn da drunter?»
«Das hier ist kein Teekränzchen! Es ist ein Zirkus!»
«Tatsächlich?» Er knipst sein Lächeln an, das dümmliche, das sagt, dass er sich selbst nicht allzu ernst nimmt und die anderen es auch nicht tun sollten. Aber sein Handrücken brennt, wo sie ihn geschlagen hat.
Sie funkelt ihn misstrauisch an. Nicht, weil er ein böser Mann sein oder ihr etwas antun könnte. Sondern weil sie sich ärgert, dass er nichts kapiert. Er schaut sich noch einmal um, sorgfältiger jetzt, und da erkennt er ihn: ihren Ramschzirkus. Die große Hauptmanege, deren Rund sie mit dem Finger in den Schmutz gezeichnet hat, ein Drahtseil aus einem flachgeklopften Trinkhalm, der zwischen zwei Getränkedosen festgemacht ist, das Riesenrad aus dem eingedellten Fahrradreifen, der schräg an einem Busch lehnt, von einem Stein an Ort und Stelle gehalten, und aus Zeitschriften ausgerissene Papiermenschen, die zwischen seinen Speichen stecken.
Es entgeht ihm nicht, dass der Stein, der den Reifen aufrecht hält, perfekt in seine Faust passen würde. Und auch nicht, dass eine dieser nadeldünnen Fahrradspeichen so leicht durch das Auge des Mädchens gleiten würde wie durch Wackelpudding. Er presst das Plastikpony in seiner Tasche zusammen. Das wilde Summen, das unter der Tasse hervordringt, läuft ihm das gesamte Rückgrat hinunter und verursacht ein Ziehen in seinem Schritt.
Die Tasse ruckelt, und das Mädchen hält sie mit den Händen fest.
«Wow!» Die Kleine lacht, bricht den Bann.
«Wow, echt! Hast du da einen Löwen drunter?» Er schubst sie mit der Schulter an, und ein Lächeln bricht durch ihre finstere Miene, aber nur ein kleines. «Bist du Dompteurin? Bringst du ihm bei, durch einen brennenden Reifen zu springen?»
Sie grinst, ihre Sommersprossen ziehen sich mit ihren Apfelbäckchen hoch, strahlend weiße Zähne werden sichtbar. «Nö, Rachel sagt, ich darf nicht mit Streichhölzern spielen. Nicht nach dem letzten Mal.» Sie hat einen etwas schräg stehenden Eckzahn, der leicht über den seitlichen Schneidezahn ragt. Und ihr Lächeln macht ihre brackwasserbraunen Augen mehr als wett, weil er jetzt das Funkeln in ihrem Blick sehen kann. Es lässt dieses Absturzgefühl in ihm aufsteigen. Es tut ihm leid, dass er an dem Haus gezweifelt hat. Sie ist es. Sie ist eins von ihnen. Eins von seinen Shining Girls.
«Ich bin Harper», sagt er atemlos und streckt ihr die Hand entgegen. Sie muss ihren Griff an der Tasse ändern, um seine Hand zu schütteln.
«Bist du ein Fremder?», will sie wissen.
«Jetzt nicht mehr, stimmt’s?»
«Ich heiße Kirby. Kirby Mazrachi. Aber ich ändere meinen Namen in Lori Star, sobald ich alt genug dafür bin.»
«Wann gehst du nach Hollywood?»
Sie zieht die Tasse über den Boden auf sich zu, provoziert das Insekt darunter zu neuen Gipfeln wütender Raserei, und er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat.
«Bist du sicher, dass du kein Fremder bist?»
«Ich meine natürlich den Zirkus, verstehst du? Was wird Lori Star dort machen? Trapezfliegerin? Elefantenreiterin? Clown?» Er legt sich den Zeigefinger über die Oberlippe. «Die Dame mit dem Schnurrbart?»
Zu seiner Erleichterung kichert sie. «Neiiiiin.»
«Löwenbändigerin! Messerwerferin! Feuerschluckerin!»
«Ich werde Seiltänzerin. Ich habe schon geübt. Willste mal sehen?» Sie will aufstehen.
«Nein, warte», sagte er, plötzlich hoffnungslos. «Kann ich deinen Löwen sehen?»
«Es ist eigentlich kein Löwe.»
«Das behauptest du», reizt er sie.
«Okay, aber du musst wirklich vorsichtig sein. Ich will nicht, dass sie wegfliegt.» Sie kippt die Tasse ein winziges bisschen an. Er legt die Wange auf den Boden und späht darunter. Der Geruch nach zertretenem Gras und schwarzer Erde ist beruhigend. Unter der Tasse bewegt sich etwas. Pelzig behaarte Beine, eine Ahnung von Gelb und Schwarz. Fühler tasten in Richtung des Spalts. Kirby atmet scharf ein und kippt den Tassenrand hastig wieder auf den Boden.
«Das ist aber mal eine dicke Hummel», sagt er und lässt sich auf die Fersen zurücksinken.
«Ich weiß», sagt sie stolz.
«Du hast sie ganz schön wild gemacht.»
«Ich glaube, sie will nicht zum Zirkus.»
«Soll ich dir was zeigen? Aber du musst mir vertrauen.»
«Was denn?»
«Willst du eine Seiltänzerin haben?»
«Nein, ich …»
Aber er hat die Tasse schon angehoben und die verstörte Hummel in seine Hand geschoben. Ihr die Flügel auszureißen macht das gleiche dumpfe Geräusch, mit dem man den Stiel aus einer Sauerkirsche zupft, wie in Rapid City, wo er mal bei der Kirschernte gearbeitet hat. Er war kreuz und quer durch das ganze gottverdammte Land gefahren, war der Arbeit nachgejagt wie eine läufige Hündin. Bis er das Haus gefunden hat.
«Was machst du da!», schreit sie.
«Jetzt müssen wir nur noch Fliegenpapierstreifen zwischen den beiden Dosen aufspannen. So ein fettes altes Vieh wie das hier müsste es schaffen, die Füße rauszuziehen, aber es ist trotzdem klebrig genug, damit sie nicht runterfällt. Hast du ein bisschen Fliegenpapier?»
Er setzt die Hummel auf dem Rand der Tasse ab. Sie klammert sich an die Kante.
«Warum hast du das gemacht?» Sie schlägt ihm auf den Arm, ein Wirbel von Schlägen mit offenen Handflächen.
Ihre Reaktion verblüfft ihn. «Spielen wir denn nicht Zirkus?»
«Du hast sie kaputt gemacht! Geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg.» Es wird zu einem Sprechgesang, im Takt mit jedem Schlag.
«Hör auf. Jetzt hör aber auf.» Er lacht, aber sie schlägt ihn immer weiter. Er hält sie an den Handgelenken fest. «Ich mein’s ernst. Hör verdammt noch mal auf, Lady.»
«Man darf nicht fluchen!», brüllt sie und bricht in Tränen aus. Das läuft nicht, wie er es geplant hatte – soweit er überhaupt eine dieser ersten Begegnungen planen kann. Die Unberechenbarkeit von Kindern ermüdet ihn. Deshalb mag er kleine Mädchen nicht, deshalb wartet er, bis sie älter werden. Später ist das alles eine ganz andere Geschichte.
«Schon gut, tut mir leid. Heul nicht, okay? Ich hab was für dich. Aber bitte, weine nicht. Sieh mal.» Verzweifelt zieht er das orangefarbene Pony heraus, oder versucht es jedenfalls. Der Kopf bleibt in seiner Tasche hängen, und er muss es mit einem Ruck herauszerren. «Hier.» Er streckt es ihr entgegen, will, dass sie es nimmt. Einen der Gegenstände, die alles miteinander verbinden. Deshalb hat er es ja überhaupt mitgebracht, oder? Er wird kurz unsicher.
«Was ist das?»
«Ein Pony. Siehst du das nicht? Ist ein Pony nicht viel besser als so eine langweilige Hummel?»
«Es ist nicht lebendig.»
«Das weiß ich. Verdammt. Jetzt nimm’s einfach, okay? Es ist ein Geschenk.»
«Ich will es nicht», sagt sie schniefend.
«Okay, es ist kein Geschenk, es ist ein Pfand. Du passt für mich darauf auf. Wie bei der Bank, wenn du ihnen dein Geld gibst.» Die Sonne brennt herunter. Es ist zu heiß, um ein Jackett zu tragen. Er kann sich kaum konzentrieren. Er will es nur hinter sich bringen. Die Hummel fällt von der Tasse und liegt auf dem Rücken im Gras, ihre Beine strampeln in der Luft.
«Ich überlege.»
Er ist schon wieder ruhiger. Alles ist, wie es sein soll. «Also, pass darauf auf, okay? Das ist wirklich wichtig. Ich komme wieder, um es abzuholen. Verstehst du?»
«Warum?»
«Weil ich es brauche. Wie alt bist du?»
«Sechsdreiviertel. Fast sieben.»
«Das ist toll. Wirklich toll. Jetzt geht’s los. Eine Runde nach der anderen, wie bei deinem Riesenrad. Wir sehen uns wieder, wenn du groß geworden bist. Halt Ausschau nach mir, okay, Herzchen? Ich komme zu dir zurück.»
Er steht auf, klopft sich den Staub vom Hosenbein. Er dreht sich um und geht eilig über das Grundstück, ohne sich umzudrehen, nur ganz leicht hinkend. Sie beobachtet ihn, wie er die Straße überquert und Richtung Bahnlinie hinaufgeht, bis er zwischen den Bäumen verschwindet. Sie betrachtet das Plastikspielzeug, das noch feucht ist von seinem Griff, und ruft hinter ihm her: «He! Ich will dein blödes Pferd nicht!»
Sie wirft es auf den Boden, und es prallt einmal ab, bevor es neben ihrem Fahrradreifen-Riesenrad liegen bleibt. Sein aufgemaltes Auge starrt ausdruckslos auf die Hummel, die sich aufgerichtet hat und sich durch den Staub wegschleppt.
Aber die Kleine wird später wiederkommen, um das Pony zu holen. Natürlich macht sie das.
Harper
20. November 1931
Der Sand gibt unter ihm nach. Es ist überhaupt kein Sand, sondern stinkender, eiskalter Matsch, der in seine Schuhe quillt und seine Socken durchnässt. Harper flucht leise vor sich hin, er will nicht, dass ihn die Männer hören. Er hört ihre Rufe in der Dunkelheit. «Siehst du ihn? Hast du ihn erwischt?» Wenn das Wasser nicht so verdammt kalt wäre, würde er es riskieren hinauszuschwimmen, um ihnen zu entkommen. Aber er zittert auch so schon heftig unter dem Wind, der vom Lake Michigan herüberstreicht und ihm unters Hemd fährt, weil er seine Jacke, vollgeschmiert mit dem Blut dieses Arschlochs, hinter der Kneipe zurückgelassen hat.
Er watet über den Strand, sucht sich einen Weg zwischen dem Müll und dem verrottenden Gerümpel, der Schlamm saugt an jedem seiner Schritte. Er kauert sich hinter eine Baracke am Wasser. Sie besteht aus Packkisten, die mit Dachpappe zusammengehalten werden. Licht dringt durch die Spalten und die Flickstellen aus Karton, sodass es aussieht, als würde das ganze Ding glühen. Er versteht nicht, warum die Leute so nahe am See bauen – als würden sie denken, das Schlimmste wäre ihnen schon passiert und es könnte nicht weiter abwärts gehen. Als wüssten sie nicht, dass die Leute an den seichten Stellen hinscheißen. Als wüssten sie nicht, dass der See bei solchen Regenfällen über die Ufer treten und die ganze verdammte, stinkende Hooverville wegspülen könnte. Diesen Slum, die Heimstatt der Vergessenen, denen sich das Unglück bis auf die Knochen gefressen hat. Niemand würde sie vermissen. Genauso wenig, wie irgendjemand den verdammten Jimmy Grebe vermissen wird.
Er hat nicht damit gerechnet, dass Grebe dermaßen bluten würde. Dazu wäre es auch nicht gekommen, wenn der Bastard fair gekämpft hätte. Aber er war fett und besoffen und verzweifelt. Konnte keinen Schwinger landen, also hatte er versucht, Harper an den Eiern zu packen. Harper hat gespürt, wie der Hurensohn mit seinen dicken Fingern nach seiner Hose griff. Wenn einer fies kämpft, muss man sich noch fieser wehren. Es ist nicht Harpers Schuld, dass diese gezackte Glasscherbe eine Arterie erwischt hat. Er hatte schließlich auf Grebes Gesicht gezielt.
Und das alles wäre überhaupt nicht passiert, wenn dieser kranke Dreckskerl nicht angefangen hätte, auf die Karten zu husten. Grebe hatte den blutigen Schleim mit dem Ärmel weggewischt, klar, aber jeder wusste, dass er Tbc hatte und ansteckend war. Krankheiten und Pleiten und durchdrehende Männer. Das ist das Ende von Amerika.
Aber versuch das mal einem «Major» Klayton und seinem Trupp Schwanzlutscher-Bürgerwehr beizubringen, die so aufgeblasen tun, als würde ihnen ganz Hooverville gehören. Es gibt eben kein Gesetz hier. Genau wie es kein Geld gibt. Keine Selbstachtung. Er hat die Zeichen gesehen – und nicht nur die Schilder, auf denen «Zwangsversteigert» stand. Seien wir ehrlich, denkt er, Amerika hat es nicht anders verdient.
Ein blasser Lichtstrahl schwenkt über den Strand, bleibt an den Fußabdrücken hängen, die er im Sand hinterlassen hat. Aber dann schwingt die Taschenlampe in eine andere Richtung herum, und die Tür der Baracke öffnet sich, sodass es ganz hell wird. Eine magere Ratte von einer Frau kommt heraus. Ihr Gesicht ist hager und grau im Schein der Petroleumlampe – wie alle Gesichter hier –, als würden die Staubstürme den Leuten draußen auf dem Land alle individuellen Charakterzüge aus dem Gesicht blasen, während sie zugleich ihre Ernten vernichten.
Ein drei Nummern zu großes, dunkles Jackett hängt wie ein Schal über ihren knochigen Schultern. Dicke Wolle. Es sieht warm aus. Er weiß, dass er es der Frau wegnehmen wird, noch bevor er mitbekommt, dass sie blind ist. Ihr Blick ist leer. Ihr Atem riecht nach Kohl, und in ihrem Mund verfaulen die Zähne. Sie streckt die Hand aus, um ihn zu berühren. «Was ist?», fragt sie. «Was ist das für ein Geschrei?»
«Tollwütiger Hund», sagt Harper. «Die Männer jagen ihn. Sie sollten wieder reingehen, Ma’am.» Er könnte ihr einfach das Jackett von den Schultern nehmen und verschwinden. Aber sie könnte schreien. Sie könnte sich gegen ihn wehren.
Sie packt ihn am Hemd. «Moment», sagt sie. «Sind Sie das? Sind Sie Bartek?»
«Nein, Ma’am. Das bin ich nicht.» Er versucht, den Griff ihrer Finger zu lösen. Ihre Stimme hebt sich auf eine drängende Art. Die Art, die leicht Aufmerksamkeit erregt.
«Sie sind es. Sie müssen es sein. Er hat gesagt, Sie würden kommen.» Sie ist beinahe hysterisch. «Er hat gesagt, er würde …»
«Schsch, schon gut», sagt Harper. Es kostet ihn keinerlei Anstrengung, seinen Unterarm an ihre Kehle zu heben und sie mit seinem ganzen Gewicht rücklings an den Schuppen zu drücken. Nur damit sie still ist, sagt er sich. Man schreit nicht so leicht, wenn einem die Luftröhre zugedrückt wird. Ihre Wangen blähen sich auf, mit einem Ploppen öffnet sich ihr Mund. Ihre Augen treten hervor. Protestierendes Röcheln dringt aus ihrem Rachen. Sie krallt ihre Hände in sein Hemd, als würde sie Wäsche auswringen, aber dann fallen ihre Hühnerknochenfinger herunter, und sie sackt gegen die Wand. Er folgt ihrer Bewegung mit seinem Körper, lässt sie sanft hinuntergleiten, und auch das Jackett zieht er ihr sanft von den Schultern.
Ein kleiner Junge starrt ihn aus der Türöffnung des Schuppens an, seine Augen sind groß genug, um jemanden zu verschlingen.
«Was glotzt du so?», zischt Harper den Jungen an und schiebt seine Arme in die Jackettärmel. Es ist ihm zu groß, aber das macht nichts. In der einen Tasche klimpert etwas. Loses Kleingeld, wenn er Glück hat. Aber es wird sich als etwas ganz anderes herausstellen.
«Geh rein. Hol deiner Mutter ein bisschen Wasser. Es geht ihr nicht gut.»
Der Junge starrt ihn an, und dann, ohne seinen Gesichtsausdruck zu ändern, öffnet er den Mund und stößt ein schrilles Jammern aus, das die gottverdammten Taschenlampen anlockt. Lichtstrahlen zucken über die Tür und die am Boden liegende Frau, aber da rennt Harper schon. Einer von Klaytons Kumpanen – oder vielleicht ist es auch der selbsternannte Major persönlich – ruft: «Dort!», und die Männer hetzen hinter ihm her Richtung Strand.
Er flitzt durch das Gewirr der Baracken und Zelte, die ohne Sinn und Verstand errichtet wurden, dicht gedrängt, zwischen ihnen ist kaum Platz genug für eine Schubkarre. Da haben sogar Insekten noch mehr Selbstkontrolle, denkt er, während er hinter einem Schuppen abbiegt und Richtung Randolph Street rennt.
Er verlässt sich nicht auf Leute, die sich wie Termiten benehmen.
Er tritt auf eine Abdeckplane und fällt in eine Grube von der Größe eines Wandschranks, aber beträchtlich tiefer, aus der Erde gehackt, wo sich jemand den Anschein eines Zuhauses eingerichtet und als Dach einfach eine Abdeckung in den Boden genagelt hat.
Er kommt schwer auf, seine linke Ferse knallt mit einem scharfen Ton – als würde eine Gitarrensaite reißen – auf die Seite einer Holzpritsche. Der Aufprall schleudert ihn seitwärts an die Kante eines selbstgebauten Ofens, wo er mit dem Brustkorb auftrifft, sodass es ihm den Atem aus den Lungen presst. Es fühlt sich an, als hätte er einen glatten Durchschuss am Knöchel, aber er hat keinen Schuss gehört. Er kann nicht einatmen, um zu schreien, und er geht in der Ölplane unter, die halb auf ihn gefallen ist.
Dort entdecken sie ihn, wie er gegen die Plane kämpft und diesen Hurensohn verflucht, dem das Material oder das Geschick gefehlt hat, um einen ordentlichen Schuppen zu bauen. Die Männer versammeln sich am Rand des Unterschlupfs, bedrohliche Silhouetten hinter dem grellen Strahl ihrer Taschenlampen.
«Du kannst nicht hierherkommen und einfach machen, was dir gerade einfällt», sagt Klayton mit Sonntagspredigerstimme. Harper kann endlich wieder atmen. Aber jedes Einatmen brennt wie ein Messerstich in seiner Seite. Er hat sich garantiert eine Rippe gebrochen, und am Fuß hat er sich noch schwerer verletzt.
«Du musst deinen Nachbarn respektieren, und dein Nachbar muss dich respektieren», fährt Klayton fort. Harper hat ihn diesen Satz bei den Gemeindeversammlungen sagen hören, als er darüber redete, dass sie unbedingt versuchen müssten, mit den Ladenbesitzern auf der anderen Seite der Straße klarzukommen – denen, die ihnen die Behörden auf den Hals hetzten, damit Warnschilder an jedes Zelt und jede Hütte gehängt wurden, die die Bewohner der Hooverville anwiesen, innerhalb von sieben Tagen das Gelände zu räumen.
«Schwer, jemanden zu respektieren, wenn man tot ist.» Harper lacht, auch wenn es sich mehr wie ein Keuchen anhört und sich sein Magen dabei vor Schmerzen zusammenzieht. Er denkt, dass sie Schrotflinten dabeihaben könnten, aber das ist unwahrscheinlich, und erst als der Strahl einer Taschenlampe von seinem Gesicht wegschwenkt, erkennt er, dass sie mit Rohren und Hämmern bewaffnet sind. Wieder verkrampft sich sein Magen.
«Ihr solltet mich dem Gesetz übergeben», sagt er hoffnungsvoll.
«Nee!», gibt Klayton zurück. «Die Cops haben hier nichts zu suchen.» Er wedelt mit seiner Taschenlampe. «Zieht ihn raus, Jungs. Bevor noch unser Chinamann Eng zu seinem Loch zurückkommt und diesen dreckigen Abschaum dort drin sitzen sieht.»
Und jetzt folgt das nächste Zeichen, so klar wie die Morgendämmerung, die hinter der Brücke langsam über den Horizont kriecht. Bevor Klaytons Schläger herunterklettern können, fängt es an zu regnen, schneidende Tropfen, kalt und hart. Und von der anderen Seite des Lagers ruft jemand: «Polizei! Das ist eine Razzia!»
Klayton dreht sich um und verhandelt mit seinen Männern. Sie klingen wie Affen mit ihrem Geschnatter und den wedelnden Armen, aber dann jagt ein Flammenstoß durch den Regen, leuchtet bis weit hinauf in den Himmel und setzt ihrer Unterhaltung ein Ende.
«Hey, lassen Sie das …» Ein Schrei hallt von der Randolph Street herüber. Gefolgt von einem weiteren. «Sie haben Petroleum!», brüllt jemand.
«Auf was wartet ihr noch?», fragt Harper ruhig in den trommelnden Regen und den Aufruhr.
«Du bleibst, wo du bist.» Klayton richtet sein Rohr auf ihn, während sich die Silhouetten zurückziehen. «Wir sind noch nicht fertig mit dir.»
Ohne auf das kratzende Geräusch zu achten, das seine Rippen machen, stützt sich Harper auf den Ellbogen zum Sitzen hoch. Er beugt sich vor, greift nach der Plane, die an einer Seite immer noch oben an ihren Nägeln hängt, und zieht daran, fordert das Unvermeidliche heraus. Aber die Plane hält.
Über sich hört er den herrischen Ton des Majors, dessen Stimme sich schrill über den Konflikt erhebt, als er irgendwelche Leute anschreit. «Haben Sie für das hier einen Gerichtsbeschluss? Denken Sie wirklich, dass Sie einfach so hierherkommen und die Häuser der Leute niederbrennen können, nachdem wir schon einmal alles verloren haben?»
Harper packt eine dicke Falte der Plane, stemmt sich mit dem unverletzten Fuß an dem umgestürzten Ofen hoch und zieht sich nach oben. Sein Knöchel schlägt gegen die Erdwand, und ein greller Schmerzblitz, so klar wie Gott selbst, blendet ihn. Er würgt, hustet eine klebrige Mischung aus Spucke und rot durchsetztem Schleim heraus. Er klammert sich an die Plane und blinzelt heftig gegen die schwarzen Löcher, die in seinem Sichtfeld aufblühen, bis er wieder sehen kann.
Die Rufe verschwinden im trommelnden Regen. Er muss sich beeilen. Er zieht sich eine Handbreit nach der anderen an der öligen, feuchten Plane hinauf. Noch vor einem Jahr hätte er das nicht geschafft. Aber nachdem er zwölf Wochen Nieten in die Triboro Bridge in New York gehämmert hat, ist er so stark wie der räudige Orang-Utan, dem er einmal auf einer Kirmes dabei zugesehen hat, wie er mit seinen bloßen Pranken eine Wassermelone in zwei Teile riss.
Von der gespannten Segeltuchplane kommt ein merkwürdig sprödes Geräusch, das ihn fürchten lässt, in dieses gottverdammte Loch zurückzustürzen. Aber die Plane hält. Dankbar zieht er sich über den Rand, und es ist ihm egal, dass er sich die Brust an den Nägeln aufreißt, mit denen die Plane befestigt ist. Später, wenn er in Sicherheit seine Verletzungen untersucht, wird er feststellen, dass die tiefen Kratzer aussehen, als hätte ihm eine leidenschaftliche Hure ihr Zeichen eingeritzt.
Da liegt er, das Gesicht im Schlamm, der Regen prasselt auf ihn nieder. Die Rufe haben sich entfernt, obwohl es nach Rauch riecht und sich das Licht von einem halben Dutzend Bränden mit dem Grau der Dämmerung vermischt. Ein paar Takte Musik dringen durch die Nacht, herübergetragen von einem Wohnungsfenster, aus dem sich vielleicht gerade die Mieter beugen, um das Spektakel zu genießen.
Harper kriecht auf dem Bauch durch den Schlamm, der Schmerz lässt Blitze durch seinen Kopf zucken – oder vielleicht sind sie auch real. Es ist eine Art Wiedergeburt. Als er ein passendes Stück Holz findet, auf das er sich stützen kann, richtet er sich auf und hinkt weiter.
Sein linker Fuß ist zu nichts zu gebrauchen, er zieht ihn hinter sich her. Aber er humpelt trotzdem weiter, durch den Regen und die Dunkelheit, weg von der brennenden Barackensiedlung.
Alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Weil er gezwungen ist zu gehen, findet er das Haus. Weil er das Jackett genommen hat, besitzt er den Schlüssel.
Kirby
18. Juli 1974
Es ist diese bestimmte Zeit ganz früh am Morgen, wenn die Dunkelheit schwer lastet, nachdem keine Züge mehr fahren und der Verkehr versiegt ist, aber bevor die Vögel anfangen zu zwitschern. In dieser Nacht herrscht eine Affenhitze. Die Art stickiger Wärme, die sämtliche Insekten hervorlockt. Motten und fliegende Ameisen klatschen gegen die Verandalampe wie in einem ungleichmäßigen Trommeltakt. Ein Moskito sirrt irgendwo oben an der Zimmerdecke.
Kirby liegt wach im Bett, streichelt die Nylonmähne des Ponys und lauscht auf die Geräusche des leeren Hauses, auf sein Knurren wie ein hungriger Bauch. «Es arbeitet», sagt Rachel immer. Aber Rachel ist nicht da. Und es ist spät, oder früh, und Kirby hat außer muffigen Cornflakes beim lange vergangenen Frühstück nichts zu essen gehabt, und da sind Geräusche, die nicht zum Arbeiten gehören.
Kirby flüstert dem Pony zu: «Das ist ein altes Haus. Wahrscheinlich ist es nur der Wind.» Nur dass die Verandatür eingeklinkt ist und nicht schlagen sollte. Die Dielen sollten nicht knarren wie unter dem Gewicht eines Einbrechers, der sich auf Zehenspitzen zu ihrem Zimmer schleicht, mit einem Sack in der Hand, in den er sie stecken und fortschleppen will. Oder vielleicht ist es die lebendige Puppe aus dieser gruseligen Fernsehserie, die auf ihren kleinen Plastikfüßen im Haus herumtapst. Kirby darf die Sendung eigentlich nicht sehen.
Kirby schlägt das Bettlaken zurück. «Ich gehe mal nachsehen, okay?», erklärt sie dem Pony, denn der Gedanke daran, abzuwarten, bis das Monster zu ihr kommt, ist nicht auszuhalten. Sie schleicht zur Tür, die ihre Mutter mit exotischen Blumen und Kletterranken bemalt hat, als sie vor vier Monaten eingezogen sind, bereit, sie wem (oder was) auch immer ins Gesicht zu schmettern, das da die Treppe heraufkommt.
Sie steht hinter der Tür, als wäre sie ein Schutzschild, die Ohren gespitzt, und zupft an der groben Farboberfläche herum. Eine Tigerlilie hat sie schon bis aufs nackte Holz abgezogen. Ihre Fingerspitzen brennen. Die Stille schrillt in ihrem Kopf.
«Rachel?», flüstert Kirby so leise, dass außer dem Pony sie niemand hören kann.
Ein dumpfes Poltern, sehr nahe, dann ein Knallen und ein Splittern. «Shit!»
«Rachel?», sagt Kirby lauter. Ihr Herz rast in ihrer Brust.
Lange Stille. Dann sagt ihre Mutter: «Geh wieder ins Bett, Kirby, mir geht’s gut.» Kirby weiß, dass das nicht stimmt. Aber wenigstens ist es nicht Talky Tina, die lebende Killerpuppe.
Sie hört auf, an der Farbe zu zupfen, öffnet die Tür und geht über den Flur, macht einen Bogen um die Glassplitter, die wie Diamanten zwischen den verblühten Rosen mit ihren vertrockneten Blättern und schwammigen Köpfen in einer Pfütze aus stinkendem Blumenwasser liegen. Die Tür ist einen Spaltbreit für sie offen gelassen worden.
Jedes neue Haus ist älter und schäbiger als das letzte, auch wenn Rachel die Türen und Schränke anmalt und manchmal sogar die Dielen, um es für sie in Besitz zu nehmen. Sie suchen die Bilder zusammen aus Rachels großem grauen Kunstband heraus: Tiger oder Einhörner oder Heilige oder braune Inselmädchen mit Blumen im Haar. Kirby benutzt die Bilder als Anhaltspunkte dafür, wo sie gerade wohnen. Dieses Haus hat die schmelzenden Uhren auf dem Küchenschrank über dem Herd, was bedeutet, dass der Kühlschrank links steht und das Badezimmer unter der Treppe ist. Obwohl die Raumaufteilung in jedem Haus wechselt, sie manchmal einen Hof haben und es in Kirbys Zimmer ab und zu einen Wandschrank gibt, sie aber auch froh sein kann, wenn sie bloß Regale hat, bleibt Rachels Zimmer immer gleich.
Sie sieht darin eine Piratenbucht. («Piratenhöhle» korrigiert ihre Mutter, aber Kirby stellt sich eine versteckte Zauberbucht vor, eine, in die man hineinsegeln kann, wenn man Glück hat und die richtigen Hinweise auf deiner Karte stehen.)
Kleider und Schals liegen überall im Zimmer, als hätte eine Zigeunerpiratenprinzessin einen Wutanfall gehabt. Eine Sammlung Modeschmuck hängt an den goldenen Schnörkeln eines ovalen Spiegels, der das Erste ist, was Rachel aufhängt, wenn sie wieder in ein neues Haus ziehen, wobei sie sich jedes Mal unweigerlich mit dem Hammer auf den Daumen schlägt. Manchmal spielen sie Verkleiden, und Rachel schmückt Kirby mit sämtlichen Ketten und Armreifen und nennt sie «mein Weihnachtsbaummädchen», obwohl sie jüdisch sind, oder jedenfalls zur Hälfte.
Am Fenster hängt ein Zierornament aus farbigem Glas, das in der Nachmittagssonne Regenbögen durchs Zimmer und über das schräg gestellte Zeichenbrett und die jeweilige Illustration tanzen lässt, an der Rachel gerade arbeitet.
Als Kirby ein Baby war und sie noch in der Stadt wohnten, stellte Rachel den Laufstall neben ihrem Arbeitstisch auf, sodass Kirby herumkrabbeln konnte, ohne sie zu stören. Sie hat meistens für Frauenzeitschriften gezeichnet, aber jetzt «ist mein Stil unmodern, Baby – da draußen geht es sehr flatterhaft zu». Kirby gefällt der Klang des Wortes flattern. Flattern-rattern-schnattern-flackern. Und es gefällt ihr, die Zeichnung ihrer Mutter mit der winkenden Kellnerin zu sehen, die zwei buttertriefende Pfannkuchenstapel balanciert, wenn sie auf dem Weg zum Eckladen an Doris’ Pancake House vorbeikommen.
Aber jetzt ist das Glasornament kalt und tot, und die Nachttischlampe ist halb mit einem gelben Schal verhängt, sodass der ganze Raum ekelhaft ungesund wirkt. Rachel liegt auf dem Bett, hat sich ein Kissen übers Gesicht gezogen und ist noch komplett angezogen, mit Schuhen und allem. Ihre Brust zuckt unter ihrem schwarzen Spitzenkleid, als hätte sie Schluckauf. Kirby steht an der Tür, will unbedingt, dass ihre Mutter sie bemerkt. Ihr Kopf platzt gleich vor Worten, von denen sie nicht weiß, wie sie sie sagen soll.
«Du hast im Bett die Schuhe an», bringt sie schließlich heraus.
Rachel hebt das Kissen vom Gesicht und sieht ihre Tochter aus verschwollenen Augen an. Ihr Make-up hat eine schwarze Schmierspur über das Kissen gezogen. «Sorry, Honey», sagt sie mit ihrer brüchigen Stimme. (Bei «brüchig» muss Kirby an abgebrochene Zähne denken, so wie bei Melanie Ottesen, als sie vom Kletterseil gefallen ist. Oder an angeschlagene Gläser, aus denen man nicht mehr trinken soll.)
«Du musst deine Schuhe ausziehen!»
«Ich weiß, Honey.» Rachel seufzt. «Schimpf nicht mit mir.» Sie schiebt die schwarzbraunen Riemchenpumps mit den Zehen von den Füßen und lässt sie auf den Boden poltern. Sie rollt sich auf den Bauch. «Kratzt du mir den Rücken?»
Kirby steigt auf das Bett und setzt sich im Schneidersitz neben sie. Das Haar ihrer Mutter riecht nach Rauch. Sie folgt dem verschlungenen Spitzenmuster des Kleides mit den Fingernägeln. «Warum weinst du?»
«Ich weine nicht richtig.»
«Doch, tust du.»
Ihre Mutter seufzt. «Es ist einfach diese Zeit im Monat.»
«Das sagst du immer», sagt Kirby missmutig und fügt als Nachsatz hinzu: «Ich hab ein Pony.»
«Ich kann es mir nicht leisten, dir ein Pony zu kaufen.» Rachels Stimme klingt abwesend.
«Nein, ich hab schon eins», sagt Kirby genervt. «Es ist orange. Es hat Schmetterlinge auf dem Hintern und braune Augen und eine goldene Mähne, und es sieht, mmh, irgendwie bekifft aus.»
Ihre Mutter wirft ihr einen Blick über die Schulter zu, anscheinend begeistert von der Vorstellung. «Kirby! Hast du etwas gestohlen?»
«Nein! Es war ein Geschenk. Ich wollte es nicht mal haben.»
«Dann ist es okay.» Ihre Mutter reibt sich mit dem Handballen die Augen und verschmiert dabei ihre Wimperntusche zur Einbrechermaske.
«Also kann ich es behalten?»
«Natürlich kannst du das. Du kannst fast alles tun, was du willst. Vor allem mit Geschenken. Du kannst sie sogar in eine Million Scherben zerbrechen.» Wie die Vase im Flur, denkt Kirby.
«Okay», sagt sie ernst. «Deine Haare riechen komisch.»
«Und das sagst ausgerechnet du?» Das Lachen ihrer Mutter tanzt wie ein Regenbogen durchs Zimmer. «Wann hast du dir denn das letzte Mal die Haare gewaschen?»
Harper
22. November 1931
Das Mercy Hospital wird seinem Namen nicht gerecht. Barmherzigkeit, von wegen. «Können Sie bezahlen?», fragt die müde wirkende Frau am Empfang durch ein rundes Loch in der Glasscheibe. «Zahlende Patienten kommen zuerst dran.»
«Wie lange ist die Wartezeit?», knurrt Harper.
Die Frau neigt den Kopf zur Seite, um zum Wartebereich zu schauen. Es gibt nur Stehplätze, wenn man von den Leuten absieht, die halb ohnmächtig auf dem Boden sitzen oder liegen, zu krank oder zu erschöpft oder zu gottverdammt gelangweilt, um sich auf den Beinen zu halten. Ein paar sehen auf; mit Hoffnung oder Wut oder einer unerträglichen Mischung aus beidem im Blick. Die anderen haben den gleichen resignierten Ausdruck, den Harper bei Ackergäulen gesehen hat, die aus dem letzten Loch pfiffen, mit Rippen, die so weit vorstanden wie die Grate zwischen den Furchen der unfruchtbaren Erde, durch die sie den Pflug zogen. Solchen Pferden verpasst man den Gnadenschuss.
Er tastet in der Tasche des gestohlenen Jacketts nach dem Fünf-Dollar-Schein, den er darin gefunden hat, zusammen mit einer Sicherheitsnadel, drei Zehn-Cent-Münzen, zwei Vierteldollars und einem Schlüssel, der sich auf eine vertraute Art abgegriffen anfühlt. Oder vielleicht hat er sich auch nur an Abnutzung und Verfall gewöhnt.
«Reicht das für Ihr Mitleid, Sweetheart?», fragt er und schiebt den Geldschein durch das Fenster.
«Ja.» Sie hält seinem Blick stand, wie um zu erklären, dass sie sich nicht dafür schämt, etwas zu berechnen, obwohl allein schon dieses Verhalten das Gegenteil ausdrückt.
Sie läutet mit einer kleinen Klingel, und eine Krankenschwester kommt, um ihn abzuholen, ihre zweckmäßigen Schuhe klatschen aufs Linoleum. E. Kappel steht auf ihrem Namensschild. Sie ist hübsch, auf eine gewöhnliche Art, mit rosigen Wangen und sorgfältig eingedrehten kastanienbraunen Locken unter ihrem weißen Häubchen. Abgesehen von ihrer Nase, die zu stark aufwärts gebogen ist, sodass sie an eine Schweineschnauze erinnert. Kleines Schweinchen, denkt er.
«Kommen Sie mit», sagt sie, verärgert über seine bloße Anwesenheit. Schon ordnet sie ihn als das nächste Stück menschlichen Müll ein. Sie dreht sich um und geht mit großen Schritten weg, sodass er hinter ihr herholpern muss. Jeder Schritt lässt ihm Schmerzen in die Hüfte schießen wie eine chinesische Rakete, aber er ist fest entschlossen durchzuhalten.
Sämtliche Stationen, durch die sie kommen, sind an der Grenze ihrer Aufnahmekapazität, manchmal liegen sogar zwei Leute, den Kopf neben den Füßen des anderen, in einem Bett. All die Krankheiten darin quellen heraus.
Immer noch nicht so schlimm wie die Feldlazarette, denkt er. Verstümmelte Männer, die sich in dem Gestank von Verbrennungen und Wundfäule und Exkrementen und Erbrochenem und sauren Fiebergerüchen auf blutverkrusteten Pritschen drängen. Das unaufhörliche Stöhnen wie ein schauriger Chor.
Da fällt ihm dieser Junge aus Missouri wieder ein, dem das Bein abgeschossen wurde. Der wollte einfach nicht aufhören zu schreien, hielt sie allesamt wach, bis Harper zu ihm hinüberschlich, als wolle er ihn trösten. Aber in Wahrheit stach er dem dummen Jungen sein Bajonett in den Oberschenkel oberhalb des blutigen Stumpfs und schnitt ihn säuberlich auf, um die Arterie zu verletzen. Genau wie er es in der Ausbildung an den Strohpuppen geübt hatte. Zustechen und drehen. Jemanden so direkt anzugreifen, hatte Harper immer persönlicher gefunden, als eine Kugel abzuschießen. Es machte den Krieg erträglicher.
Aber hier ist Fehlanzeige, was das angeht, vermutet er. Allerdings gibt es noch andere Methoden, um anstrengende Patienten loszuwerden. «Sie sollten das schwarze Fläschchen holen», sagt Harper, bloß um die pummelige Krankenschwester zu provozieren. «Die würden sich sogar noch bei Ihnen bedanken.»
Sie schnaubt verächtlich, während sie ihn an den Türen der Privatstation vorbeiführt, sauberen Einzelzimmern, die zum größten Teil leerstehen. «Führen Sie mich nicht in Versuchung. Ein Viertel des Krankenhauses ist zur Zeit das reinste Pesthaus. Typhus, Infektionen. Gift wäre ein Segen. Aber lassen Sie bloß keinen der Chirurgen hören, dass Sie von schwarzen Fläschchen reden.»
Durch eine offene Tür sieht er eine junge Frau in einem Bett liegen, das von einem Blumenmeer umgeben ist. Sie sieht aus wie ein Filmstar, obwohl es inzwischen schon über zehn Jahre her ist, dass Charlie Chaplin von Chicago nach Kalifornien gezogen ist und die gesamte Filmindustrie mitgenommen hat. Ihr Haar liegt in schweißverklebten blonden Ringellöckchen um ihr Gesicht, das in dem fahlen Wintersonnenlicht, das durch die Fenster hereindringt, noch blasser aussieht. Aber als Harper vor der Tür stehen bleibt, schlägt sie mit flatternden Lidern die Augen auf. Sie setzt sich halb auf und lächelt ihn strahlend an, als hätte sie ihn erwartet und würde ihn willkommen heißen, damit er sich ein Weilchen zu ihr setzt und mit ihr redet.
Aber davon will Schwester Kappel nichts wissen. Sie packt ihn am Ellbogen und zieht ihn weiter. «Kein Herumgegaffe. Das Letzte, was dieses Flittchen braucht, ist noch ein Bewunderer mehr.»
«Wer ist sie?» Er wirft einen Blick über die Schulter.
«Niemand. Eine Nackttänzerin. Die kleine Idiotin hat sich selbst mit Radium vergiftet. Das ist ihre Show, sie malt sich damit an, damit sie im Dunkeln leuchtet. Keine Sorge, sie wird bald entlassen, dann können Sie so viel von ihr sehen, wie Sie nur wollen. Sogar alles, nach dem, was ich so gehört habe.»
Sie führt ihn in den strahlend weißen, nach scharfen Desinfektionsmitteln riechenden Behandlungsraum. «Jetzt setzen Sie sich hierhin, und wir sehen uns an, was Sie angestellt haben.»
Er steigt ungeschickt auf die Behandlungsliege. Konzentriert runzelt sie die Stirn, als sie die schmutzigen Lappen wegschneidet, die er so eng um Knöchel und Ferse gewickelt hat, wie er es ertragen konnte.
«Sie sind ein Dummkopf, wissen Sie das eigentlich?» Ihr ist klar, dass sie mit diesem Ton bei ihm durchkommt, das zeigt das kleine Lächeln um ihre Mundwinkel. «So lange mit dem Herkommen zu warten! Haben Sie geglaubt, das würde von allein besser werden?»
Sie hat recht. Dass er die letzten beiden Nächte unbequem geschlafen hat, macht es noch schlimmer. Er hat in einem Eingang kampiert, mit einem Karton als Unterlage und dem gestohlenen Jackett als Decke, weil er nicht zu seinem Zelt zurückgehen kann, denn dort warteten wahrscheinlich Klayton und seine Handlanger mit ihren Rohren und Hämmern auf ihn.
Die sauberen Scherenklingen arbeiten sich schnipp-schnipp durch den Lumpenverband, der weiße Rillen in Harpers geschwollenen Fuß gepresst hat, sodass er aussieht wie ein abgebundener Schinken. Und, wer ist jetzt das kleine Schweinchen? Echt dämlich, denkt er bitter, dass er ohne irgendeine dauerhafte Verletzung durch den ganzen Krieg gekommen ist und jetzt durch den Sturz in den Unterschlupf eines Landstreichers zum Krüppel wird.
Der Arzt rauscht ins Zimmer, ein älterer Mann mit gemütlich gepolstertem Bauch und dichtem grauem Haar, das hinter die Ohren gestrichen ist wie eine Löwenmähne.
«Und, wo fehlt’s uns heute, Sir?» Die Frage wirkt durch das begleitende Lächeln nicht weniger herablassend.
«Tja, ich bin jedenfalls nicht mit Leuchtfarbe angemalt im Dunkeln herumgetanzt.»
«Und dazu werden Sie so bald auch kaum Gelegenheit haben, wie es aussieht», sagt der Arzt, immer noch lächelnd, als er den geschwollenen Fuß zwischen die Hände nimmt, um ihn hin und her zu drehen. Er duckt sich hastig, beinahe profimäßig, als Harper vor Schmerz brüllt und in seine Richtung ausholt.
«Das lassen Sie lieber, Sportsfreund, wenn Sie nicht hochkant rausfliegen wollen», der Arzt grinst, «ob Sie bezahlen oder nicht.» Als er den Fuß dieses Mal auf und ab bewegt, auf und ab, beißt Harper die Zähne zusammen und ballt die Hände zu Fäusten, damit er nicht um sich schlägt.
«Können Sie die Zehen selbst Richtung Körper ziehen?», fragt der Arzt und schaut genau hin. «Oh, gut. Das ist ein gutes Zeichen. Besser, als ich erwartet habe. Großartig. Sehen Sie das hier?», sagt er zu der Krankenschwester und nimmt die Kuhle oberhalb der Ferse zwischen die Finger. Harper stöhnt. «Hier sollte die Sehnenverbindung sein.»
«Ja», die Krankenschwester nimmt die Haut zwischen die Finger. «Ich spüre es.»
«Was bedeutet das?», sagt Harper.
«Es bedeutet, dass Sie die nächsten paar Monate flach auf dem Rücken im Krankenhaus verbringen sollten, Sportsfreund, aber ich vermute, das kommt für Sie nicht in Betracht.»
«Wenn es nicht gratis ist.»
«Oder Sie besorgte Kunden haben, die bereit sind, Ihre Erholungszeit zu finanzieren, wie unser Radium-Girl.» Der Arzt zwinkert ihm zu. «Wir können Sie eingipsen und Sie mit einer Krücke gehen lassen. Aber ein Sehnenriss heilt nicht von selbst. Sie sollten mindestens sechs Wochen lang nicht laufen. Ich kann Ihnen einen Schuhmacher empfehlen, der auf medizinisches Schuhwerk spezialisiert ist, um den Absatz erhöhen zu lassen, das hilft ein bisschen.»
«Und wie soll ich das machen? Ich muss arbeiten.» Harper ist genervt von dem Jammerton, der sich in seine Stimme geschlichen hat.
«Wir alle haben mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Da müssen Sie bloß mal die Krankenhausverwaltung fragen. Ich schätze, Sie tun, was Sie können.» Wehmütig fügt er hinzu: «Ich vermute, Sie haben keine Syphilis, oder?»
«Nein.»
«Ein Jammer. In Alabama wird eine Studie angefangen, und man hätte für Ihre gesamte medizinische Versorgung bezahlt, wenn Sie teilgenommen hätten. Allerdings hätten Sie dafür ein Schwarzer sein müssen.»
«Damit kann ich ebenfalls nicht dienen.»
«Zu dumm.» Der Arzt zuckt mit den Schultern.
«Werde ich noch laufen können?»
«Oh ja», sagt der Arzt. «Aber ich würde nicht darauf hoffen, noch bei Mr. Gershwin vorzutanzen.»
Harper hinkt aus dem Krankenhaus, die Rippenbrüche verbunden, den Fuß in Gips, das Blut voller Morphium. Er greift in die Tasche, um festzustellen, wie viel Geld er noch hat. Zwei Dollar und ein paar Münzen. Doch dann streifen seine Finger den gezackten Bart des Schlüssels, und in seinem Kopf öffnet sich etwas wie ein Funkempfänger. Vielleicht ist es das Schmerzmittel. Oder vielleicht hat es schon immer auf ihn gewartet.
Ihm ist noch nie zuvor aufgefallen, dass die Straßenlampen summen, auf einer niedrigen Frequenz, die sich hinter seine Augen bohrt. Und obwohl es Nachmittag ist und die Lampen ausgeschaltet sind, scheinen sie zu flackern, wenn er unter ihnen hindurchgeht. Und das Summen springt zur nächsten Lampe über, als wolle es ihn weiterlocken. Hier entlang. Und er könnte schwören, eine knisternde Musik zu hören, eine ferne Stimme, die nach ihm ruft, als käme sie aus einem schlecht eingestellten Radio. Er folgt dem Pfad der summenden Straßenlampen, geht, so schnell er kann, aber die Krücke behindert ihn.
Er geht die State Street runter, und das Summen führt ihn durch den West Loop in die Schluchten der Madison Street mit ihren Wolkenkratzern, die auf jeder Seite vierzig Stockwerke hoch emporragen. Er kommt durch die Skid Row, wo er mit zwei Dollar eine Zeitlang ein Bett bezahlen könnte, aber das Summen und die Lampen führen ihn immer weiter, in den Black Belt, wo die schäbigen Jazzkneipen und Cafés billigen Mietshäusern weichen, vor denen zerlumpte Kinder auf der Straße spielen und alte Männer mit selbstgedrehten Zigaretten auf den Eingangstreppen sitzen und ihn mit unheilvollen Blicken beobachten.
Die Straße wird schmaler, und die Gebäude rücken enger zusammen, werfen kühle Schatten auf den Bürgersteig. Eine Frau lacht in einer der Wohnungen weiter oben, ein unvermitteltes, hässliches Geräusch. Wohin er auch blickt, sieht er Zeichen. Kaputte Fenster in den Häusern, handgeschriebene Schilder in den leeren Schaufenstern der Erdgeschosse. «Geschäftsaufgabe», «Bis auf Weiteres geschlossen», und einmal einfach bloß «Sorry».
Kühle Feuchtigkeit wird vom See herangeweht, der Wind fährt schneidend durch den trostlosen Nachmittag und unter sein Jackett. Während er tiefer in das Viertel mit den Lagerhäusern geht, werden die Passanten spärlicher, bis überhaupt keine mehr zu sehen sind, und in ihrer Abwesenheit schwillt die Musik an, süß und schwermütig. Und jetzt erkennt er auch die Melodie. Somebody from somewhere. Und die Stimme flüstert drängend: Geh weiter, geh weiter, Harper Curtis.
Die Musik trägt ihn über die Eisenbahngleise, tief in die West Side und auf die Stufen eines Arbeiterhauses, ununterscheidbar von den anderen Holzhäusern in der Reihe, Schulter an Schulter mit ihnen, mit abblätternder Farbe und vernagelten Erkerfenstern und einem Schild mit der Aufschrift «Abbruchhaus – City of Chicago», das auf den Brettern klebt, mit denen der Eingang X-förmig zugenagelt worden ist. Macht euer Kreuz für Präsident Hoover genau hier, ihr hoffnungsvollen Männer. Die Musik kommt hinter der Tür von Nummer 1818 heraus. Eine Einladung.
Er greift unter den gekreuzten Brettern hindurch und drückt den Türgriff herunter, aber es ist abgeschlossen. Die Straße ist vollkommen verlassen. Die anderen Häuser sind vernagelt oder ihre Vorhänge fest zugezogen. Er hört den Verkehr einen Block weiter, einen Straßenhändler, der geröstete Erdnüsse anpreist. «Warm kaufen, essen beim Laufen», aber es klingt dumpf, als käme es durch Tücher, die um seinen Kopf gewickelt sind. Dagegen ist die Musik ein scharfer Splitter, der sich direkt durch seinen Schädel bohrt: Der Schlüssel.
Er steckt die Hand in die Jacketttasche, weil er plötzlich fürchtet, ihn verloren zu haben. Erleichtert stellt er fest, dass der Schlüssel noch da ist. Er ist aus Bronze, und der Markenname Yale & Towne ist darauf eingeprägt. Das Schloss an der Tür ist von derselben Firma. Zitternd schiebt Harper den Schlüssel hinein. Er passt.
Die Tür schwingt in die Dunkelheit auf, und einen langen, schrecklichen Moment bleibt er wie gelähmt stehen angesichts der neuen Möglichkeiten. Und dann duckt er sich unter den Brettern hindurch, hantiert ungeschickt mit seiner Krücke und schiebt sich durch die Lücke zwischen den Brettern und in das Haus.
Kirby
9. September 1980
Es ist einer von diesen kühlen, klaren Tagen zu Beginn des Herbstes. Die Bäume können sich nicht recht entscheiden, ihre Blätter sind gleichzeitig grün und gelb und braun. Kirby kann schon aus einem Block Entfernung erkennen, dass Rachel stoned ist. Nicht nur, weil dieser süßliche Geruch im Haus hängt (total verräterisch), sondern weil Rachel so fahrig im Vorgarten herumläuft und ein Tamtam über etwas veranstaltet, das auf dem verwilderten Rasen ausgelegt ist. Tokyo springt und bellt aufgeregt um sie herum. Sie sollte nicht zu Hause sein. Sie sollte bei einem ihrer sogenannten Sojourns sein, beziehungsweise «So-Johns», wie Kirby es genannt hat, als sie noch klein war. Okay, bis vor einem Jahr.
Wochenlang hatte sie sich damals gefragt, ob dieser So-John ihr Dad sei und ob Rachel plane, sie einander vorzustellen. Dann erklärte ihr Grace Tucker in der Schule, ein John wäre ein Ausdruck für einen Mann, der sich eine Prostituierte nimmt, und genau das wäre ihre Mutter. Kirby wusste nicht, was eine Prostituierte war, aber sie schlug Gracie die Nase blutig, und Gracie riss ihr eine Haarsträhne aus.
Rachel fand das urkomisch, obwohl Kirbys Kopf an der Stelle, an der ihr Gracie die Haare ausgerissen hatte, blutverkrustet war und schmerzte. Rachel wollte angeblich nicht lachen, ehrlich, «aber es ist wirklich unheimlich lustig». Dann erklärte sie es Kirby auf dieselbe Art, auf die sie alles erklärte, nämlich auf die Art, die überhaupt nichts erklärte. «Eine Prostituierte ist eine Frau, die ihren Körper benutzt, um sich die Eitelkeit der Männer zunutze zu machen», hatte sie gesagt. «Und ein Sojourn ist eine Belebung des Geistes.» Aber es stellte sich heraus, dass diese Erklärung nicht mal annähernd stimmte. Denn eine Prostituierte bekam Geld für Sex, und ein Sojourn war ein Urlaub vom echten Leben, und das ist das Letzte, was Rachel braucht. Weniger Urlaub, mehr echtes Leben, Mom.
Kirby pfeift nach Tokyo. Fünf kurze, scharfe Töne, markant genug, um sie aus den ganzen anderen Pfiffen herauszuhören, mit denen die Leute ihre Hunde im Park zu sich rufen. Er springt auf sie zu, so glücklich, wie es nur ein Hund sein kann. «Reinrassige Promenadenmischung», nennt ihn Rachel gern. Rauflustig, mit einer langen Schnauze und braun-weiß geflecktem Fell und hellen Ringen um die Augen. Kirby hat ihn «Tokyo» genannt, weil sie nach Japan zieht, wenn sie groß ist und eine berühmte Übersetzerin von Haiku-Gedichten wird und grünen Tee trinkt und Samurai-Schwerter sammelt. («Na ja, immerhin besser als Hiroshima», meint ihre Mutter.) Sie hat schon angefangen, eigene Haikus zu schreiben. Zum Beispiel:
Raumschiff heb ab
Bring mich weit weg von hier
Die Sterne warten
Oder:
Sie verschwindet
Gefaltet wie Origami
In ihren eigenen Träumen
Rachel applaudiert immer begeistert, wenn sie ihr einen neuen Haiku vorliest. Aber Kirby denkt inzwischen, dass sie auch den Text auf der Seite der Cocoa-Krispies-Schachtel abschreiben könnte, und ihre Mutter würde genauso laut jubeln, besonders, wenn sie stoned ist, was dieser Tage immer häufiger vorkommt.
Sie gibt So-John die Schuld. Oder wie er sonst heißt. Rachel wird es ihr nicht erzählen. Als ob Kirby nicht morgens um drei das Auto vorm Haus hören würde, oder die gezischelten Unterhaltungen, unverständlich, aber voller Anspannung, bevor die Tür zuknallt und ihre Mutter versucht hereinzuschleichen, ohne sie zu wecken. Als ob sie sich nicht fragen würde, woher das Geld für ihre Miete kommt. Als ob das nicht schon jahrelang so ginge.
Rachel hat ihre sämtlichen Bilder auf dem Rasen ausgelegt – sogar das große von Lady Shalott in ihrem Turm (das ist Kirbys Lieblingsbild, obwohl sie es nie zugeben würde), das normalerweise zusammen mit den anderen Gemälden, die ihre Mutter anfängt, aber irgendwie nie fertigbekommt, hinten in der Besenkammer verstaut ist.
«Veranstalten wir einen Flohmarkt?», fragt Kirby, obwohl sie weiß, dass Rachel diese Frage ärgern wird.
«Oh, Honey», ihre Mutter wirft ihr ein unaufmerksames Halblächeln zu, so wie sie es macht, wenn sie von Kirby enttäuscht ist, was zur Zeit ständig der Fall zu sein scheint. Und zwar gewöhnlich, wenn Kirby etwas sagt, das nach Rachels Meinung zu erwachsen für sie ist. «Du verlierst dein kindliches Staunen», hat sie ihr vor zwei Wochen mit solcher Schärfe in der Stimme erklärt, als wäre es das Schlimmste auf der Welt.
Merkwürdigerweise scheint es Rachel nichts auszumachen, wenn Kirby in echte Schwierigkeiten gerät. Nicht, wenn sie sich in der Schule mit anderen prügelt, und nicht einmal, als sie aus Rache Mr. Partridges Briefkasten in Brand gesetzt hat, weil er sich ständig darüber beschwert, dass Tokyo immer seine Erbsenpflanzen ausgräbt. Ihre Mutter hat sogar ein großes Pseudodrama aufgeführt, sie hatten sich laut genug angebrüllt, dass dieser selbstgerechte Schwätzer von nebenan es durch die Wände hören konnte, und ihre Mutter hatte geschrien: «Weißt du denn nicht, dass es ein Kapitalverbrechen ist, den US-Postdienst zu behindern?», bevor sie kichernd zusammengebrochen waren und sich mit der Hand den Mund zugehalten hatten.
Rachel deutet auf ein Miniaturbild, das genau zwischen ihren bloßen Füßen liegt. Ihre Fußnägel sind in einem hellen Orange lackiert, das ihr nicht steht. «Findest du das hier nicht zu brutal?», fragt sie. «Zu viel grausame Natur, rot an Zahn und Klaue?»
Kirby weiß nicht, was das bedeutet. Sie hat Mühe, die Bilder ihrer Mutter auseinanderzuhalten. Alle zeigen bleiche Frauen mit langem, fließendem Haar und traurigen, für ihre Köpfe viel zu großen Insektenaugen in feuchten Landschaften aus Grün- und Blau- und Grautönen. Rot kommt überhaupt nicht vor. Rachels Kunst erinnert sie an das, was die Lehrerin im Sportunterricht gesagt hat, als sie immer wieder den Absprung aufs Pferd verfehlt hatte. «Mein Gott, jetzt versuch’s mal ein bisschen weniger angestrengt!»
Kirby zögert, weiß nicht, was sie sagen soll, ohne ihre Mutter aufzuregen. «Ich finde es eigentlich ganz gut.»
«Oh, aber ganz gut ist gar nichts!», ruft Rachel, packt sie an den Händen und zieht sie in einem wirbelnden Foxtrott über die Bilder. «Gut ist die exakte Definition von Mittelmäßigkeit. Das ist höflich. Das ist gesellschaftlich akzeptiert. Wir müssen besser und intensiver leben als nur gut, Darling!»
Kirby windet sich aus ihrem Griff und schaut auf all die schönen, traurigen Mädchen hinunter, die ihre dürren Arme emporrecken wie Gottesanbeterinnen. «Mm», sagt sie. «Soll ich dir helfen, die Bilder wieder reinzubringen?»
«Oh, Honey», sagt ihre Mutter so mitleidig und verächtlich, dass Kirby es nicht aushält. Sie rennt zum Haus, poltert die Verandatreppe hinauf und vergisst, ihrer Mutter von dem Mann mit dem dünner werdenden Haar und den zu hoch gezogenen Jeans und der Boxernase zu erzählen, der im Schatten der Platane neben Mason’s Tankstelle gestanden und mit einem Strohhalm aus einer Flasche getrunken hat, während er sie beobachtete. Die Art, auf die er sie ansah, hatte Kirbys Magen hochsteigen lassen, wie wenn man bei der Kirmes auf der Berg-und-Tal-Bahn fährt und das Gefühl hat, jemand hätte einem die Eingeweide umgestülpt.
Als sie ihm heftig und übertrieben fröhlich zuwinkte, nach dem Motto: Hey, Mister, ich sehe, dass du mich anstarrst, du Wichser, hob er als Antwort eine Hand. Und hielt sie oben (supergruselig), bis sie um die Ecke Ridgeland Street verschwand, weil sie ihre übliche Abkürzung durch die Gasse vermieden hatte, um so schnell wie möglich aus seinem Blickfeld zu kommen.
Harper
22. November 1931
Es ist, als wäre er wieder ein kleiner Junge, der sich in die Bauernhäuser der Nachbarschaft schleicht. Sich in den stillen Häusern an den Küchentisch setzt, sich zwischen die kühlen Laken eines fremden Bettes legt, die Schubladen inspiziert. Die Sachen der Leute verraten ihre Geheimnisse.
Er hatte immer gespürt, ob jemand im Haus war; damals und auch seither jedes Mal, wenn er in ein verlassenes Haus eingebrochen war, um etwas zu essen abzustauben oder ein vergessenes, billiges Schmuckstück, das er versetzen konnte. Ein leerstehendes Haus verströmt ein bestimmtes Gefühl. Es ist reif vor Abwesenheit.
Dieses Haus ist voll von einer Erwartung, die Harpers Arme mit Gänsehaut überzieht. Es ist jemand mit ihm hier. Und das ist nicht der Tote, der im Flur liegt.
Der Kronleuchter über der Treppe wirft sanftes Licht auf den dunklen Holzboden, der von frischem Bohnerwachs schimmert. Die Tapete ist neu, ein dunkelgrün-cremefarbenes Rautenmuster, das sogar Harper als geschmackvoll einordnen kann. Links ist eine helle, moderne Küche, die direkt aus dem Sears-Katalog zu stammen scheint, mit Resopalschränken und einem nagelneuen Tischbackofen und einem Kühlschrank und einem silberfarbenen Wasserkessel auf dem Herd, alles ist bereit. Wartet auf ihn.
Er schwingt seine Krücke in einem weiten Kreis über das Blut, das sich wie ein Teppich über die Dielen ausbreitet, und hinkt auf die andere Seite, um einen besseren Blick auf den toten Mann zu haben. Der Mann hält mit starrem Griff einen Truthahn, dessen graurosa, pickelig gerupfte Haut mit geronnenem Blut verschmiert ist. Der Typ ist stämmig, trägt ein Frackhemd, graue Hosen, Hosenträger und elegante Schuhe. Kein Jackett. Sein Kopf ist zermalmt worden wie eine Melone, man kann gerade noch Hängebacken mit Bartstoppeln erkennen und blutunterlaufene Augen, die weit aufgerissen vor Schreck aus seinem entsetzten Gesicht starren.
Kein Jackett.
Harper hinkt an der Leiche vorbei, folgt der Musik in den Salon, erwartet halb, hier den Besitzer in einem Sessel vor dem Kamin sitzend vorzufinden, den Schürhaken, mit dem er den Kopf des Mannes eingeschlagen hat, quer über die Beine gelegt.
Das Zimmer ist leer. Allerdings brennt das Feuer. Und dort steht wirklich ein Schürhaken neben dem Gestell für die Holzscheite, das gut gefüllt ist, als würde er erwartet. Das Lied kommt aus einem gold-burgunderfarbenen Grammophon. Auf dem runden Etikett der Schallplatte steht «Gershwin». Natürlich. Durch einen Vorhangspalt sieht er das billige Sperrholz, mit dem die Fenster vernagelt sind und die das Tageslicht aussperren. Aber warum soll all das hier hinter vernagelten Fenstern und einem Abbruchhinweis versteckt werden? Um zu verhindern, dass es von anderen Leuten entdeckt wird.
Eine Kristallkaraffe, die mit honigfarbener Flüssigkeit gefüllt ist, steht neben einem einzelnen Whiskeyglas mit Eiswürfeln auf dem Beistelltisch. Auf einem Spitzendeckchen. Das muss verschwinden, denkt Harper. Und er muss etwas wegen der Leiche unternehmen. Bartek, denkt er, ruft sich den Namen ins Gedächtnis, den die blinde Frau gesagt hat, bevor er sie erwürgte.
Bartek hat nie hierhergehört, sagt die Stimme in seinem Kopf. Aber Harper gehört hierher. Das Haus hat auf ihn gewartet. Es hat ihn aus einem bestimmten Grund hierhergerufen. Die Stimme in seinem Kopf flüstert: Zu Hause. Und genauso fühlt es sich an, viel mehr als die jämmerliche Bleibe, in der er aufgewachsen ist, oder die Abfolge von schäbigen Pensionen und Bruchbuden, zwischen denen er sein gesamtes Erwachsenenleben herumgezogen ist.
Er lehnt die Krücke an den Sessel und schenkt sich ein Glas aus der Karaffe ein. Das Eis klirrt, als er die Flüssigkeit kreisen lässt. Erst halb geschmolzen. Er nimmt langsam einen Schluck, bewegt ihn im Mund, lässt ihn feurig die Kehle hinunterrinnen. Canadian Club. Beste Schmuggel-Importware, er prostet der Luft zu. Es ist lange her, seit er etwas zu trinken hatte, dem nicht der bittere Formaldehyd-Nachgeschmack von Selbstgebranntem folgte. Es ist lange her, seit er auf einer gepolsterten Sitzgelegenheit gesessen hat.
Er widersteht dem verlockenden Sessel, obwohl sein Bein vom Laufen schmerzt. Ganz gleich, welches Fieber ihn vorangetrieben hat, es brennt noch immer. Da ist noch mehr, hier entlang, Sir, wie ein Jahrmarktschreier. Hereinspaziert, lassen Sie sich nichts entgehen. Geh weiter, geh weiter, Harper Curtis.
Harper zieht sich die Treppe hinauf, hängt sich ans Geländer, das so glänzend poliert ist, dass er Fingerabdrücke auf dem Holz hinterlässt. Fettige Geisterschatten – die schon wieder verblassen. Er muss bei jedem Schritt den Fuß im Halbkreis hochschwingen, die Krücke schleppt er hinter sich her. Vor Anstrengung zieht er keuchend den Atem zwischen den Zähnen ein.
Er hinkt durch den Flur, vorbei an einem Badezimmer mit einem Waschbecken, das mit Blutrinnsalen befleckt ist, die zu dem triefend nassen Handtuchknäuel auf dem Boden passen, von dem es rosa über die glänzenden schwarz-weißen Bodenfliesen läuft. Harper achtet nicht weiter darauf, ebenso wenig wie auf die Treppe, die vom Flur aus zum Speicher hinaufführt, oder auf das Gästezimmer mit dem säuberlich gemachten Bett, dessen Kopfkissen aber eingedrückt ist.
Die Tür zum Schlafzimmer ist zu. Ein wandernder Lichtstreifen fällt durch den Spalt zwischen Boden und Tür auf die Flurdielen. Er greift nach dem Türknauf, rechnet damit, dass abgeschlossen ist. Doch der Knauf dreht sich mit einem Klicken, und er drückt die Tür vorsichtig mit der Spitze seiner Krücke auf. Sie öffnet sich in einen Raum, der unerklärlicherweise in das blendende Licht eines Sommernachmittags getaucht ist. Die Einrichtung ist spärlich. Ein Schrank aus Walnussholz, ein schmiedeeisernes Bett.
Er kneift gegen die plötzliche Helligkeit von draußen die Augen zu und beobachtet, wie sie sich in dicke, wirbelnde Wolken und silbrige Regenschwaden verwandelt, dann in einen rot gestreiften Sonnenuntergang, wie bei einem billigen Zoetrop, der kreisenden Bildertrommel. Doch statt eines galoppierenden Pferdes oder eines Mädchens, das lasziv die Strümpfe auszieht, wirbeln ganze Jahreszeiten an ihm vorbei. Er geht zum Fenster, um die Vorhänge zuzuziehen, doch vorher späht er noch kurz auf den Ausblick.
Die Häuser gegenüber verändern