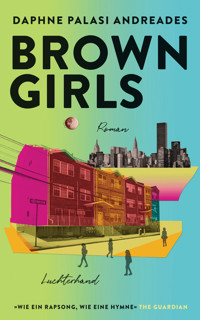
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Als würde sie über jedes Brown Girl sprechen, das im letzten Jahrhundert gelebt hat… Furchtlos!« The New York Times
»Wenn ihr es genau wissen wollt, hat unsere Haut die Farbe von 7-Eleven-Root-Beer. Die Farbe vom Sand am Rockaway Beach, von dem wir Blasen an den Fußsohlen bekommen. Die Farbe der Kajalstifte, mit denen unsere Schwestern ihre Augen umranden. Die Farbe von Erdnussbutter.«
Queens, New York. Hier kämpft eine Gruppe von Mädchen darum, die Migrationsgeschichten ihrer Familie mit der amerikanischen Kultur in Einklang zu bringen. Rastlos durchstreifen sie die Stadt, die niemals schläft, singen aus voller Kehle Mariah Carey, sehnen sich nach Jungs, die unerreichbar sind, und brechen den erreichbaren die Herzen. Eins ist für sie klar: Sie wollen für immer Freundinnen bleiben. Doch das Älterwerden macht auch vor ihnen keinen Halt und all die neuen Wünsche und Träume stellen die Freundschaft vor ungeahnte Herausforderungen.
In entwaffnend lyrischer Sprache zeichnet »Brown Girls« ein kollektives Porträt vom Erwachsenwerden und weiblicher Freundschaft vor dem Hintergrund von Rassismus, Klassenzugehörigkeit und Ausgrenzung im gegenwärtigen Amerika.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt:
Queens, New York. Hier kämpft eine Gruppe von Mädchen darum, die Migrationsgeschichte ihrer Familie mit der amerikanischen Kultur in Einklang zu bringen. Rastlos durchstreifen sie die Stadt, die niemals schläft, singen aus voller Kehle Mariah Carey, sehnen sich nach Jungs, die unerreichbar sind, und brechen den erreichbaren die Herzen. Eins ist für sie klar: Sie wollen für immer Freundinnen bleiben. Doch das Älterwerden macht auch vor ihnen keinen Halt, und all die neuen Wünsche und Träume stellen die Freundschaft vor ungeahnte Herausforderungen.
In entwaffnend lyrischer Sprache zeichnet »Brown Girls« ein kollektives Porträt vom Erwachsenwerden und weiblicher Freundschaft vor dem Hintergrund von Rassismus, Klassenzugehörigkeit und Ausgrenzung im gegenwärtigen Amerika.
Autorin:
Daphne Palasi Andreades, geboren in Queens, New York, studierte Kreatives Schreiben an der renommierten Columbia University. Für ihre Texte wurde sie mit dem O.Henry Prize und dem Voices of Color Prize ausgezeichnet, ihr Debütroman »Brown Girls« erhielt hymnische Besprechungen in der Presse. Palasi Andreades lebt in New York und arbeitet zur Zeit an ihrem zweiten Roman.
Übersetzer:
Cornelius Reiber, geboren 1973, studierte Germanistik, Geschichte und Kulturwissenschaften in Köln und Berlin. Er lebt als Übersetzer in Berlin, daneben lehrt er an der Universität Basel.
DAPHNE PALASI ANDREADES
BROWN GIRLS
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Cornelius Reiber
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Brown Girls« bei Random House, New York.Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2022 Daphne Palasi Andreades
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign | München nach einem Entwurf und unter Verwendung einer Coverillustration von June Park; Covermotive der Coverillustration: Ehren Joseph Studio/Getty Images (globe), Busà Photography/Getty Images (row houses), horstgerlach/Getty Images (New York skyline)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27949-3V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Für brown Girls überall&für Thad
Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren
– Emma Lazarus, »The New Colossus«
TEIL EINS
BROWN GIRLS
Wir leben im miesen Teil von Queens, New York, wo die Flugzeuge so tief fliegen, dass wir sicher sind, irgendwann zerschreddern sie uns. In unserem Viertel wächst ein einsamer Baum. Seine Äste verheddern sich in Stromleitungen. Seine Wurzeln brechen die Gehwege auf, über die wir mit unseren Rädern fahren, bis sie geklaut werden. Wurzeln, die die Betonplatten anheben und so uneben machen wie eine Reihe schiefer Zähne. In Vorgärten, nicht zu verwechseln mit richtigen Rasenflächen, spannen Großmütter Wäscheleinen, hängen Bettlaken auf, die Shorts unserer Brüder und unsere Sneaker, die so sauber geschrubbt sind, dass sie wie neu aussehen. Nehmt die ab!, zischen unsere Mütter. Das ist hier nicht wie zu Hause. In Vorgärten wachsen Tomatenpflanzen, die sich durch die harte Erde gekämpft haben.
Unsere Großmütter weigern sich, Gehstöcke zu benutzen. Unsere Brüder laufen in weißen Feinrippunterhemden rum. Wir sitzen draußen auf Backsteinveranden. Die italienischen Jungs mit ihren rasierten Köpfen rasen auf ihren Fahrrädern vorbei und starren rüber zu uns, ihr Lachen ist so schrill wie ihre Goldketten. Unsere Großeltern jäten Unkraut in ihren Gärten, und unsere Brüder rauchen ihre Zigaretten und mit der Zeit dann auch stärkeres Zeug, das wir nicht kennen. Der Geruch lässt uns das Blut in den Köpfen pulsieren. Unsere Brüder, auf Fahrrädern, deren Vorderräder sie hoch in die Luft reißen.
»BROWN«
Unsere Haut hat, wenn ihr es genau wissen wollt, die Farbe von 7-Eleven-Root-Beer. Die Farbe vom Sand am Rockaway Beach, von dem wir Blasen an den Fußsohlen bekommen. Die Farbe von Erde. Die Farbe der Kajalstifte, mit denen unsere Schwestern ihre Augen umranden. Die Farbe von gegrillten Hamburger-Patties. Die Farbe des dunkelsten Garns im Nähset unserer Mutter, das sie durchs Nadelöhr fädelt. Die Farbe von Erdnussbutter. Durch das seltsame Gen, das uns hell und weiß wie Schnee macht, so wie – Dings – Schneewittchen? Aber nicht falsch verstehen – wir sind schon noch brown. Dunkel wie die Dämmerung abends um sieben, wenn unsere Mütter das Licht in leeren Zimmern einschalten. Um dann zu rufen: Ach, hier bist du!
IM MIESEN TEIL VON QUEENS
Die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt: die Hauptverkehrsstraße – von der New York Post »Boulevard des Todes« getauft –, die sich wie eine lange graue Zunge durch unser Viertel schlängelt. Mimi’s Salon mit der Werbung: MANI & PEDI, $15.99! MITGRATISNACKENMASSAGE. Ein Stück den Boulevard runter, gegenüber von der Autowerkstatt: eine Zweigstelle der New York Public Library. Buchseiten verschmiert mit Fingerabdrücken, einem Popel, Überresten eines Niesers. In der Ecke schläft friedlich ein Obdachloser, in seiner Festung aus Plastiktüten. Wir wissen, dass er anders ist als der Typ, der gegen die Autoscheiben klopft und fragt: »Mädchen, hast du’n paar Cent?«, woraufhin unsere Eltern Gas geben. Willkommen ganz unten in Queens: das White-Castle-Schild, das auftaucht, wenn unsere U-Bahn in die Station einfährt, rumpelnde Gleise oberhalb eines Honda-Minivans, einem Halal-Food-Wagen mit dem Namen RAFISMILES, bei dem es nach Frittieröl und Rauch riecht, der zu einem vergessenen Elektronik-Discounter abzieht, wo jetzt Matratzen verkauft werden. Der Zug rattert über einem Mann dahin, der in einen Boston Cream Donut beißt, die Puddingfüllung explodiert auf seine Fingerspitzen. Er leckt sie ab und wartet weiter auf den Q11-Bus. Die Pizzeria Ray’s Not Your Mama’s mit teigigen Stücken sizilianischer Pizza, deren Öl, orangerot wie Cheetos, uns am Kinn herunterläuft, wenn wir abbeißen. Soap’n Suds Waschsalon, voller stählerner, rumpelnd rotierender Maschinen. Ein chinesisch-mexikanischer Imbiss neben O’Malley’s mit einem grünen Kunstrasenteppich vor der Tür, übersät von Kippenstummeln. Unsere eigenen Häuser: ordentliche Ziegelrechtecke. Versteckt, am Rand. Manchmal scheint hier die Sonne.
PFLICHTEN
Aber wir brown Girls sind schon zehn und wissen längst, was brav sein heißt. Wie man den Boulevard des Todes überquert, auf dem Weg zu Schulhöfen öffentlicher Schulen, an der Hand die kleinen Geschwister, wie man sie austrickst und besticht und überredet, ihre Hausaufgaben zu machen (1 4 9 2, leiern sie, Kolumbus schipperte herbei). Wie man tonlos Psst! macht, wenn unsere Väter nach langen Schichten auf der Couch eingeschlafen sind, und wie man die Wohnungen saugt, wo in den Teppichen Haare und Kekskrümel hängen. Wir wissen, wie man diese Dudelsacksauger die schummrigen Treppen hoch und runter wuchtet, auch wenn sie schwerer sind als wir selbst. Wir wissen, dass man nie widerspricht. Wir wissen, wie man sich in die Betten unserer Eltern quetscht, wenn Verwandte aus fernen Ländern und warmen Klimazonen mit ihren Koffern, Träumen und leeren Geldbörsen in die USA einwandern. Monate bleiben, Jahre.
Eine Tante manikürt uns jeden Sonntag die Hände. Eine andere spritzt uns kackfarbenes Henna auf die Handflächen, malt damit Lotusblumen. Eine Cousine lässt uns ihre Sammlung von Country-CDs hören, Dolly, Shania, die Dixie Chicks – ihr wertvollster Besitz. Wide open spaces!, singen wir mit. Eine andere Cousine leiht uns nach einigem Gebettel ihren Liebesschmöker, das Taschenbuch, das einsam auf ihrer Kommode steht. Das Cover war uns aufgefallen, eine Frau, die sich an die entblößte, muskulöse Brust eines Mannes schmiegt. Das Bild erregt uns. Wir stellen es nach, indem wir unsere Ventilatoren voll aufdrehen, um den Effekt im Wind wehender Haare zu erzeugen. Als Krönung des Ganzen legen wir unsere besten Herzschmerz-Gesichtsausdrücke auf. Bis es uns langweilig wird, so zu tun, als wären wir diese Frauen. Stattdessen streuen wir Salz auf Nacktschnecken.
Eines Abends nehmen uns unsere Eltern zur Seite. Wenn euch jemand fragt: Wir sind die Einzigen, die hier wohnen, okay?
Auch wenn wir es nicht ganz verstehen, wissen wir, wie man Familiengeheimnisse bewahrt.
Wenn unsere Cousinen und Cousins, Tanten und Onkel zu neuen Jobs in neuen Städten aufbrechen – als Kindermädchen und Bauarbeiter, Köchinnen und Krankenpfleger –, macht es uns traurig. Es spielt keine Rolle, dass wir keinen Tropfen Blut mit diesen Menschen gemeinsam haben; wir haben gelernt, sie zur Familie zu zählen. Wenn sie gehen, weinen wir nicht. Wir klammern uns nicht an sie. Wir sind brave Mädchen. Stattdessen bereiten wir uns auf Abschiedspartys vor, die die ganze Nacht dauern und damit enden, dass wir auf Sofas einschlafen und am nächsten Tag in Betten neben unseren jüngeren Geschwistern aufwachen. Wir wachen auf mit dem Geruch von Knoblauch und Lagerfeuerrauch, der noch in den Haaren hängt, mit Kuchenresten und Sabber an den Wangen. Egal.
Bevor diese Partys beginnen, müssen wir uns aber schön machen. Wir haben genau sieben Minuten Zeit im Badezimmer. Wir denken daran, unsere Haare mit kaltem Wasser zu waschen – Beeildich, ich muss los! –, damit es voll und glänzend wird.
BHS
In Küchen, in denen es intensiv nach Knoblauch und Zwiebeln duftet, stehen brown Girls an Pfannen, schlagen braune Eier auf, verrühren und braten sie. Wir liegen wie Seesterne und völlig regungslos auf dem sonnenwarmen Beton in Hinterhöfen. Wir singen Mariah, Whitney, Destiny’s Child, und geben uns Mühe, die Töne so zu treffen wie diese Sängerinnen mit brauner Haut. Say my name, say my name, trällern wir mit Beyoncé, Kelly, Michelle. In Schlafzimmern probieren wir BHs an, zur Übung. Hier unter dem Brustkorb machst du ihn zu. Jetzt drehst du ihn wieder rum. Einige von uns sind Expertinnen für BHs, weil wir unsere Mütter mit ihren schlaffen Brüsten und Areolen beobachtet haben, ein Wort, das wir gelernt haben, als wir gebannt die ausrangierten Pubertätsbücher unserer Schwestern lasen (Celebrate Your Body!). Als wir zum ersten Mal die Brüste unserer Mütter sehen, empfinden wir Abscheu und Faszination. Wir legen unsere Arme um unsere eigenen flachen Brüste, um sie zu verbergen. Wenn du vier Kinder hast, erklären uns unsere Mütter, werden die so. Wirst du schon noch sehen. Manche von uns sind Expertinnen, weil wir unsere Schwestern beobachtet haben. Das hier ist ein T-Shirt-BH. Das hier ein Push-up. Der hier hat Träger, die sich am Rücken kreuzen. Der hier hat Spitze und ist nur für Partys. Warum?, fragen wir. Weil die Leute dich sonst für eine Schlampe halten – glaub mir. Wir sind Expertinnen, weil wir durch den Türspalt gelinst haben, bis unsere Schwestern ihre Zimmertüren schlossen, Boyfriends im Schlepptau. Unsere Eltern sind weg und arbeiten ihre Zwölf- oder Vierzehn-Stunden-Schichten. Psst!, flüsterten uns unsere Schwestern zu, Finger an den Lippen.
Singende brown Girls, springende, sich drehende. Brown Girls, die aus voller Kehle Mariah mitgrölen, auf dem Schulhof kichern, Handball spielen, lästern.
SCHULKANTINE
Warum hältst du nicht einfach die Fresse, sagt Joseph Justin O’Brien zu unserer Freundin Trish, und gehst zurück in die Sozialsiedlung, aus der du gekrochen bist? Wir überlegen, ob wir die Sache selbst in die Hand nehmen und Joseph Justin O’Brien verprügeln sollen, denn ob die Kantinenfrauen es wirklich verstehen, wenn wir ihnen erklären, was er zu uns gesagt hat? Ob es sie überhaupt interessiert? Letztendlich entscheiden wir uns gegen den Plan, weil A) sowieso alle wissen, dass Joseph Justin O’Brien und all seine Freunde Rassisten sind, dass sie auf jeden Fall Mitglieder im KKK gewesen wären (aber mal im Ernst: Gibt es den KKK noch?), und B) wir Angst davor haben, wie unsere Eltern reagieren, wenn wir in der Schule Ärger bekommen. Wir stellen uns unsere Bestrafungen vor: Gummipantoffeln auf Hintern, Besenstiele auf Hintern, Gürtel auf Hintern, Hände, die unsere Arme festhalten, gefolgt von gnadenlosen Schlägen auf unsere Hintern – und schon beim Gedanken daran tut uns alles weh. Obwohl dieses Arschloch, dieser Schließmuskel (noch so ein Wort, das wir aus den Büchern unserer älteren Schwestern haben) es wirklich verdient hätte, sagen wir zu Trish, die gar nicht in der Sozialsiedlung lebt. Stattdessen essen wir unsere Sandwiches mit Hähnchenfrikadellen, die bei 180 Grad in Industrieöfen gebraten und dann mit Ketchup serviert werden. Mittagessen, die die U.S.-Regierung der Stadt New York City zur Verfügung stellt, die gleichen Mahlzeiten, die es auch im Gefängnis gibt – hat uns unser Sozialkundelehrer Mr. DiMarco erklärt. Wir versprechen Trish, dass wir uns wann anders rächen werden. Aber zumindest nehmen wir noch den schlaffen Brokkoli von unseren Tabletts und werfen die Stücke Joseph Justin an seinen Schwabbelkopf. Volltreffer! Als wir das befriedigende Aufklatschgeräusch hören, gefolgt von Joseph Justins wütendem Geschrei, klatschen wir uns ab. Wir legen unsere Arme um Trish und jubeln.
Brown Girls, elf Jahre alt. Die weiße Milch trinken und am weißen Mittagstisch sitzen. Brown Girls, die einfach nur ihr Brown-Girl-Ding machen.
REISE NACH JERUSALEM
Unsere Lehrer rufen Nadira auf, gucken dabei aber Anjali an. Unsere Lehrerinnen sagen Michaela, komm bittenach vorne an die Tafel für Aufgabe drei und leg dein Heft vor, und geben dann Naz den Whiteboardmarker. Wir stehen auf, wenn unsere Namen aufgerufen werden, und unsere Lehrer halten verwirrt inne. Oh, entschuldige, ich … Nicht du, ich meinte nicht dich, ich … Durchs Klassenzimmer werfen wir uns Blicke zu. Nadira ist Pakistanerin und trägt ein Kopftuch, das ihr elegant auf die Schultern fällt, außer wenn sie Handball spielt und den Stoff fest unterm Kinn zusammenknotet. Anjali ist Guyanerin, und ihr Zopf sieht aus wie ein dickes Seil, das schwer auf ihrem Rücken liegt, lockige Babyhaare, mit Kokosnussöl gebändigt. Michaela ist Haitianerin und ahmt im Schulbus gerne den französischen Akzent ihrer Eltern nach (Ba’ring den Müell rause!, sagt sie, während wir uns vor Lachen krümmen), und Naz’ Familie stammt aus Côte d’Ivoire – wir sind also praktisch Cousinen, sagt sie zu Michaela. Unsere Lehrerinnen schnauzen Sophie an, sie soll ENDLICHSTILLSEIN, nennen sie dabei aber Mae. Sophie, Filipina, hält sich ihre große Klappe zu – sie lästert gern und flirtet dauernd mit den Jungs, die wir »Spanier« nennen –, während Mae, Chinesin und immer höflich zu den Lehrern, zumindest im direkten Umgang, am Bücherregal aufschreckt, wo sie gerade heimlich die Romane umsortiert, um für Chaos im Englischunterricht zwei Stunden später zu sorgen. Wir lachen über unsere Lehrer, obwohl wir zugleich aus zusammengekniffenen Augen zu ihnen schauen. Die anderen in der Klasse brüllen vor Freude über diese Fehler und nennen uns den Rest der Woche absichtlich bei den falschen Namen. Sie nennen uns Khadija, Akanksha, Maribeth, Ximena, Breonna, Cherelle, Thanh, Yoon, Ellen. Sie nennen uns Josie, Rukhsana, Sonia, Odalis, Annabel, Kyra, Jenny, Cindy, Esther. In der Mittagspause geben wir unseren Lehrerinnen und Lehrern auch andere Namen: Vollpfosten, Arschloch, alte Bitch. Wir klauen einen Permanentmarker und kritzeln DOOF an ihre Klassenzimmertüren, gleich über die Poster mit der Aufschrift Wissen. Weisheit. Disziplin. Aus den Augenwinkeln beobachten wir uns gegenseitig, während wir mittags in der Kantine unsere Tabletts aus Styropor in der Hand halten, an Bushaltestellen warten und im Sportunterricht Dehnübungen machen, bei denen unsere Turnschuhe über den verschlissenen Boden rutschen. Denken: Ihr Körper ist nicht wie meiner nicht wie meiner nicht wie meiner. Und trotzdem.
AUFGABE: WAS WILLST DU WERDEN, WENN DU GROSS BIST?
Als Aufwärmübung fürs Schreiben notieren wir heute unsere Antworten in marmorierte Notizbücher:
Der Chef von meiner Mutter, ein Banker, der bei Morgan Stanley arbeitet und dem sie zweimal pro Woche das Haus putzt. (Sie hat mich gestern heimlich mit reingenommen.)Vanessa Kleinberg, die sich morgens beim Treueschwur die Haare bürstet. Zwanzigmal auf der rechten Kopfseite und zwanzigmal auf der linken, während wir und der Rest der Klasse gebannt zusehen.Rihanna – ihre Moves sind cool as fuck, und sie hat denselben Hautton wie ich.Kinderärztin (MEINE Mutter sagt, ich kann alles werden. Eigentlich will sie aber einfach, dass ich Ärztin werde.) (Ana, HALTDIEKLAPPE, dafür kriegen wir Ärger!)Miss America (Oh. Mein. Gott. Zainab, dein Ernst? Mrs. Lester bringt dich um.)Miss Universe (Die letzten beiden waren Filipinas. Meine Onkel sagen, das ist der Beweis dafür, dass wir die A-LLER-SCHÖNSTEN Frauen der Welt sind!) (Tssss, als ob, Rosaria!)Scheiß auf Miss America UND Miss Universe! Ich will nicht irgendeine blöde Schönheitskönigin sein. Ich will richtig $$$CASH$$$ machen. Also in der Bill-Gates-Liga. Ka-ching! (Schon klar, aber du bist nicht halb so schlau, Natalie.)Ich will dasselbe machen wie mein Bruder. Was auch immer das ist. Neulich war er stinksauer auf mich, weil ich seinen Kapuzenpulli geklaut hatte – von hinten hat meine Mutter mich mit ihm verwechselt.Ich möchte Künstlerin werden. (Mein Vater sagt aber, Kunst ist nur ein Hobby. Er hat gesagt, ich soll was Praktisches machen. Buchhalterin werden, wie meine Cousine Bernice. Also werde ich wohl Buchhalterin.)BuchhalterinBROWN BOYS
Wir starren die brown Boys an, mit ihrem tiefschwarzen Haar und ihren Wangenknochen, und denken: Der sieht aus wie mein Bruder. Er sieht aus wie der Junge aus dem Restaurant, in dem wir Kabobs, Lechón, Jerk Chicken, Kochbanane bestellt haben. Er sieht aus wie der Junge in der Bodega, der unsere Barbecue-Chips und unsere Eisteedosen für neunzig Cent abkassiert hat. Er ist schön, denken wir, aber wir würden uns nicht mit ihm treffen. Wir würden ihn nicht daten. Und warum? Weil er nicht aussieht wie – ihr wisst schon. Weil er aussieht wie … Außerdem mag er nur solche Mädchen, die Vanessa-Kleinberg-Typen, haben wir selbst gehört, wie er es gesagt hat. Wir starren brown Boys an, hören, wie sie Bibi-othek aussprechen. Sie faszinieren uns, aber wir ignorieren sie. Bis auf das eine Mal, als unsere Klasse einen Ausflug in die Bibliothek macht – Bib-li-o-thek, sprechen wir ihnen Silbe für Silbe vor, allein mit brown Boys hinter einem Bücherregal. Bibliothek. Guck auf meine Lippen. Und jetzt du.
ANDERE JUNGS
Wir schwören, dass wir uns verlieb– Psst!, sag es nicht, er hört dich, bist du doof, oder was? Hast du sie nicht mehr alle? Mein Gott! Goldenes Haar, Augen so blau wie der Himmel an einem wolkenlosen Tag, und vor allem die Haut so hell wie die Aufhellungscremes unserer Mütter. Wir himmeln sie an, die Jungs, die, wenn wir die Augen ein bisschen zusammenkneifen, den süßen Typen auf den Postern ähneln, die wir aus den Zeitschriften unserer Schwestern gerissen und in unseren Zimmern aufgehängt haben. Boyband-Jungs, Jungs mit Namen wie Aaron und Zack und Jake und Brad, Jungs mit Gesichtern wie auf den Werbeplakaten überall in der Queens Center Mall, bei Target und Kmart, Gesichter, bei denen wir stehen bleiben und von einem Bein aufs andere treten, wegen der Klebrigkeit, die wir plötzlich in unserer Unterwäsche spüren. Echte amerikanische Jungs. Der Typ ist TOLL, sagen wir zueinander. Weil er diese Haare und diese Augen hat! Seufz. Ich könnte ihn den ganzenTag lang anstarren. Wir sehen aus der Ferne zu, wie diese white Boys Händchen halten mit den Jessicas und Katelyns und Claires aus unserer Klasse. Und träumen währenddessen davon, dass wir es sind, mit denen sie auf Papas Boot um Mitternacht zum Schwimmen rausfahren. Nur dass wir nicht schwimmen können. Brown Girls brown Girls brown Girls mit ihrer tiefen, unerschütterlichen Liebe für diese Jungs, die uns manchmal auch bemerken, meist aber nicht.
MÄDCHEN WIE IHR
Wir nehmen Busse, den 53er, den 22er, den 11er, die mit einem Ächzen an den Ampeln zum Stehen kommen. Lass uns in der Mall treffen! Wir sind dreizehn. Wir schlendern durch alle vier Etagen, kaufen aber kaum was. Einen korallenfarbenen Lipgloss, ein T-Shirt von dem Sale-Wühltisch, mit einem Adler drauf und einer amerikanischen Flagge, weil Gabbys Lieblingsfeiertag der Vierte Juli ist. Wir verprassen neun Dollar für Nagellack in zierlichen, glänzenden Fläschchen und mit Pigmenten, die unsere Nägel schimmern lassen. Im Food Court klauen wir uns gegenseitig die mit Ketchup in Zickzackspur gekrönten Pommes, kauen an schlaffen Quesadillas rum und schlürfen extragroße Orangenlimos. Wir gehen in eine Boutique mit Deckenstrahlern, die jeden Artikel des Ladens – die High Heels, in denen wir kaum laufen können, die Zirkonia-Halsketten, die Perlenpullis und Tüllkleider – glamourös erscheinen lassen. Wir drücken Kleidungsstücke, noch auf den Bügeln, an unsere Körper. Stylish, selbstbewusst – vielleicht könnten wir solche Mädchen sein. Wir lachen und stürzen in die Umkleidekabine. Leila probiert ein meerschaumgrünes Poloshirt an, stellt den steifen Kragen hoch, und wir taufen sie Miss Preppy. Wir stecken Aisha in ein fuchsiafarbenes Kleid, kreischen: Uuhhh, Hollywood-Glam!, und nennen sie eine Diva. Wir probieren ein schwarzes Kleid mit U-Ausschnitt und einer Fliege über dem Steißbein an, legen es aber gleich wieder weg – zu ernst, zu langweilig.
Wir werden durch ein Klopfen an der Tür unserer Umkleidekabine unterbrochen. Eine wütende Stimme, die behauptet, sie sei die Filialleiterin. Was macht ihr Mädchen da drin? Sie rüttelt am Türknauf. Wehe, ihr klaut was!, schreit sie. Ich weiß, was Mädchen wie ihr anstellt! (Mädchen wie wir?) Kommt raus! Jetzt sofort! Erschrocken versuchen wir, unsere Jeans wieder über die Beine zu streifen, die dringend mal Feuchtigkeitscreme bräuchten. Unsere Handtaschen hängen neben Spiegeln und sind lächerlich klein. In ihnen befindet sich nichts außer ein paar Münzen für die Busfahrten nach Hause, Handys, die wir von unseren Schwestern geerbt haben, und ein sorgfältig gefalteter Zwanzig-Dollar-Schein – unser hart verdientes Babysitting-Geld – fürs »Shopping«. Welche Klamotten hätten darin überhaupt Platz? Die Filialleiterin klopft wieder. Aufmachen!, schreit sie. Wir hören, wie ein Schlüssel ins Schloss gleitet. Die Tür schwingt auf.
Guckt sie euch an, diese brown Girls, dreizehnjährige Exemplare: feine dunkle Haare, die aus unrasierten und ungewachsten Achselhöhlen und Bikinizonen hervorsprießen, gezackte Dehnungsstreifen wie Blitze auf Bauch und Hüften, Arme, die in halb über den Kopf gezogenen T-Shirts stecken. So stehen sie da, in ihrer weißen Baumwollunterwäsche.
FAMILIENFEIERN
An Küchentischen voller Tischsets mit Fotos vom lang ersehnten Sommerurlaub in ORLANDO! servieren wir Tanten, Onkeln und Großeltern Kaffee, Tee und Nachschlag, während kleine Cousins und Cousinen zwischen unseren Beinen herumtollen. Den Kuchen schneiden, Getränke nachschenken. Meine Güte, du bist ja eine richtige Frau geworden!, sagen unsere Tanten. Bleib so schlank, werd nicht so wie ich. Hast du zugenommen? Isst du genug? Deine Haare gefallen uns nicht, sagen sie mit missbilligendem Blick, warumhast du sie blond gefärbt? Nein, es steht dir schon, aber geh das nächste Mal zu dem anderen Friseur, der ist billiger. Uns wird ganz schwindelig von ihren Ratschlägen, von ihrer – wie sagt man dazu? – Liebe.
Das Fest wird immer ausgelassener und unsere Familien immer berauschter vom Wein und dem Schwelgen in Erinnerungen. Mein Bruder, du weißt schon, der Draufgänger? Als er siebzehn war, brachte er dieses Mädchen mit nach Hause, während unsere Eltern auf dem Feld waren. Drei Monate später war das Mädchen – da muss sie fünfzehn gewesen sein – schwanger, und die beiden planten ihre Hochzeit! Eine andere Geschichte: Ich hab die Erntezeit gehasst. Mir taten die Schultern weh, weil ich mich bücken musste, um diese winzigen Reiskörner zu pflücken. Am Ende des Tages hab ich geweint und geweint und zu meiner Großmutter gesagt: »Ich will das NIE wieder machen!« Und sobald ich alt genug war, bin ich weg aus der Provinz und in die Hauptstadt gezogen. Im Jahr darauf habe ich meine Großmutter beerdigt.
Wir schleichen uns aus Häusern, die sich zu warm und beengend anfühlen. Draußen atmen wir aus. Wir sitzen auf Fahrradlenkern und Bordsteinkanten, während die Sonne satt-orange untergeht. Im Radio singt Mariah: Gimme your love. Zehn-, fünfzehnmal singt sie die Zeile. Weil wir nicht zurück ins Haus wollen, laufen wir in der Gegend rum, an der Tankstelle vorbei, am Park, sehen uns die Häuser an, die immer pompöser werden, mit Vorgärten voll dickstämmiger Bäume, die lange Schatten werfen. Wo keine Wäscheleinen gespannt sind. Diese Häuser mit ihrer perfekten Symmetrie und Stille machen uns Angst. Wir müssen an das Gelächter und Geschrei unserer Familien in überfüllten Küchen und Hinterhöfen denken. Die Erde wird dunkler. Wir rennen nach Hause – vorbei am God Bless Deli 2, vorbei an dem schrottreifen Mustang mit dem darunter rumschraubenden Mann, vorbei an den italienischen Jungs auf ihren Veranden. Die uns zurufen: Ey, Schoooooene!, als wir an ihnen vorbeirennen.
Schöne?, denken wir erschrocken. Seit wann sind wir schön?
OPTISCHE TÄUSCHUNGEN
Gib ihn mir – gib ihn mir! Doch nicht so, du Idiotin! So. Hier. Wir malen uns perfekte Augenbrauen, geschwungen und voll, aber nicht zu dunkel, wie die von Tante Luccia, deren tätowierte Brauen wie tintige, strenge Kaulquappen aussehen. Wir leihen uns die Tuben mit dem Abdeckstift unserer Schwestern und malen uns mit der dicken Paste schmalere, spitzere Nasen ins Gesicht. Wir tupfen uns golden schimmerndes Puder auf unsere Wangenknochen, wie wir es in YouTube-Videos, der Werbung im Fernsehen und in Zeitschriften gesehen haben. Hier, gib her. Ich hab gesagt: GIBJETZTHER





























