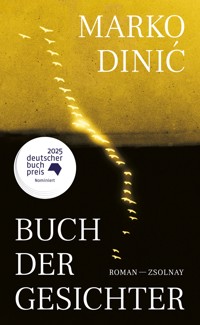
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2025. »Die Menschen, über die Marko Dinić schreibt, verlieren sich in den Schrecken der Historie eben nicht. Ihre Hoffnungen, ihre Kämpfe werden sichtbar durch die Kraft der Literatur.« Clemens Meyer Belgrad 1942: Der Tag, an dem das okkupierte Serbien für »judenfrei« erklärt wird, ist der Tag, an dem Isak Ras seinen vielleicht letzten Streifzug durch die Stadt wagt. Er ist auf der Suche nach den Überresten seiner verschütteten Vergangenheit: Was ist vor 21 Jahren geschehen, als Isaks Mutter spurlos verschwand? Hatten die Anarchisten Rosa und Milan damit zu tun? Oder die mysteriösen Doppelgänger, die in der Stadt herumliefen? Acht Kapitel, acht unterschiedliche Perspektiven ergeben am Ende dieses großen Romans die Lösung eines gewieften Rätsels. Marko Dinić ist ein beeindruckender Text gelungen, eine Geschichte Serbiens und Europas im zwanzigsten Jahrhundert. Sein »Buch der Gesichter« ist Erinnerungsliteratur in moderner Form.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2025. »Die Menschen, über die Marko Dinić schreibt, verlieren sich in den Schrecken der Historie eben nicht. Ihre Hoffnungen, ihre Kämpfe werden sichtbar durch die Kraft der Literatur.« Clemens MeyerBelgrad 1942: Der Tag, an dem das okkupierte Serbien für »judenfrei« erklärt wird, ist der Tag, an dem Isak Ras seinen vielleicht letzten Streifzug durch die Stadt wagt. Er ist auf der Suche nach den Überresten seiner verschütteten Vergangenheit: Was ist vor 21 Jahren geschehen, als Isaks Mutter spurlos verschwand? Hatten die Anarchisten Rosa und Milan damit zu tun? Oder die mysteriösen Doppelgänger, die in der Stadt herumliefen? Acht Kapitel, acht unterschiedliche Perspektiven ergeben am Ende dieses großen Romans die Lösung eines gewieften Rätsels. Marko Dinić ist ein beeindruckender Text gelungen, eine Geschichte Serbiens und Europas im zwanzigsten Jahrhundert. Sein »Buch der Gesichter« ist Erinnerungsliteratur in moderner Form.
Marko Dinić
Buch der Gesichter
Roman
Paul Zsolnay Verlag
Es ist, wie Sie sehen werden, ein Roman mit einem etwas eigenwilligen Aufbau. Die einzelnen Kapitel sehen aus und lesen sich wie selbstständige Erzählungen, und es dauert einige Zeit, ehe man darauf kommt, dass man Kapitel einer eigentlich ziemlich straffen Romanhandlung vor sich hat, die aber nicht chronologisch erzählt wird. So ist der Beginn der Handlung erst im letzten … Kapitel zu finden, während das erste seinen Stoff aus der Mitte der Handlung sich holt. Und doch erscheint mir diese Anordnung nicht willkürlich, sondern als die einzig denkbare und mögliche.
Leo Perutz an seinen Verleger Paul Zsolnay
ANFANG
Ich träumte, mein Kind sei in den Fluß gefallen und treibe rasend vorwärts. Ich watete hinein, aber es war schon vorüber, und ich ließ die Arme sinken und dachte: Es ist tot, es ist gerettet vor dem Leben.
Friederike Manner, Die dunklen Jahre
Der Winter zwischen 1915 und 1916 war ein äußerst kalter gewesen. In Zimony fuhren Ende November Lastkarren durch die Gassen und lasen auf ihrem Weg erfrorene Landstreicher und Tierkadaver auf. Der Postbote, ein gewisser Szabó Kálmán, verfolgte mit Unbehagen das Schreien der Krähen, die zu Tausenden in den kahlen Baumkronen am Kai hockten. Die Donau lag von Ufer zu Ufer unter einer dicken Eisfläche. Darauf standen mehrere Frauen in Wintermänteln und stierten auf ein Loch, das sie vorher in das Eis geschlagen hatten. In Händen hielten sie selbstgeschnitzte Angelruten und flehten eine Mahlzeit für ihre Kinder herbei. Soldaten schlenderten gemütlich die Promenade entlang, als sei diesseits des Flusses die Welt in bester Ordnung.
Im Oktober war Beograd gefallen. Die fortdauernden Straßenkämpfe hatten Feuer angefacht, die bis in den Dezember hinein brannten. Ein Rußnebel verhängte den Himmel wie ein Leichentuch, hinter dem sich blass die Sonne abzeichnete. Die Menschen in den Straßen husteten fürchterlich. Oder sie bekreuzigten sich an jedem gottverlassenen Kirchenvorplatz, in der Hoffnung, den Tod betend zu überlisten. Ihre Gemüter waren grau wie das Federkleid junger Tauben. Tauben wurden gejagt, um gegessen zu werden.
Der folgende Jänner war ein Hungermonat gewesen.
Im Februar meldeten Zeitungen, dass sich die serbische Armee auf Korfu zurückgezogen habe. Daraufhin ließen die pravoslavischen Kirchen ihre Glocken läuten — dem Verbot der königlich-kaiserlichen Behörden zuwiderhandelnd. Die Schenken waren allabendlich gefüllt mit Ungarn, die auf einen raschen Sieg der Deutschen in Verdun anstießen. Gegenüber saßen Serben, die fahlen Antlitzes die Bläschen in ihrem Bierschaum zählten. Im Keller der Avra — in vier Reihen zusammengedrängt — zeichneten Kinder die Lippenlage des Vorbeters nach, der langsam und deutlich das Šma vorsang. Zur selben Zeit war am Hauptplatz das Pferd eines Schwaben vor Kälte eingeknickt und verendet. Bis zum Abend war das Fleisch des Tieres unter den Schaulustigen verteilt worden, was Olga Ras, die das Geschehen von weitem beobachtet hatte, allenfalls ein Schmunzeln abrang.
Olga war zu stolz für Almosen. Vielmehr vertraute sie auf die Kniffe, die der Krieg ihr beigebracht hatte: Dem Erdstreifen vor ihrem Haus rang sie mageres Gemüse ab. Mit sachte aus ihren Röcken gerupften Fäden stopfte sie Socken und sonstigen Mottenfraß. Ihre Schuhe polierte sie mit Zwiebelhälften, bevor die Knollen in der Suppe landeten, und weil im Krieg alle Suppen dünn waren, rührte Olga etwas Mehl unter, das sie neben dem Herd in einer Blechdose aufbewahrte. Wenn die Nachbarn schliefen, molk sie heimlich die Ziege von Hermann Stadler; den Hühnern in seinem Hof stahl sie das ein oder andere Ei. Gelegentlich sang sie — dem Elend etwas Tröstendes entgegenhaltend — ein aus dem Stegreif ersonnenes Lied, das nach Heimweh klingen sollte.
Olga war zäh, aber zerrüttet. Die Einsamkeit, die sie bisweilen verspürte, schmeckte bitter wie der Schimmel auf dem Brot, das sie fraß. Überhaupt war sie mit ihrem einzigen Sohn Isak auf Verderb alleingelassen worden. Aber das war nur eine Geschichte, die sie in den ersten Kriegsjahren der Tapete an ihrer Wand erzählt hatte. Das stille, bald heitere Gemüt des Kindes schaffte es nicht, Olga das Warten auf die Rückkehr ihres Ehemannes von der Front zu erleichtern. An diese glaubte sie inzwischen genauso wenig wie an das Versprechen von Geza Ras, im Schützengraben nicht zum Dünger eines französischen Bauern zermahlen zu werden.
Damals war Isak gerade sechs Jahre alt geworden. Zarte dunkle Augenbrauen schmückten seine Stirnpartie, mit der er das Antlitz seiner Mutter stets bei sich trug. Seine Nase suchte noch nach einem Schnitt, und mit den kleinen dichten schwarzen Locken war er ganz des Vaters Vater. Nur im unbeholfenen Gang des Kindes glaubte Olga ihr Erbe mit dem von Geza Ras vereint. Doch sie hatte keinen Nerv, sich mit derartigen Gleichnissen aufzuhalten. Früher hätte sie in den Bewegungen ihres Sohnes oder in den Halbwörtern, die er brabbelte, Hinweise auf seine keimende Persönlichkeit gesucht. Nun aber zwang sie der Hunger, wie eingegraben vor dem Herd zu stehen und Bohnen zu zählen. Außer der Arbeit gab es wenig, was den Krieg hätte vergessen machen können. Ihre Ehe mit dem Schuhmacher Geza Ras verfluchte Olga mittlerweile in aller Öffentlichkeit!
Die Vermählung mit dem zwei Jahre älteren Sohn eines Fleischers war aus einer Not geboren worden, in der sich Olga nach dem frühen Tod ihres Vaters, Jozef Kon, unverschuldet wiederfand. Weil die Bank den seit vier Generationen geführten Eisenwarenladen der Familie Kon gepfändet hatte, sah Mutter Melanija, deren Geschäftssinn über den eigenen Teller nicht hinausreichte, keinen anderen Ausweg aus ihrer prekären wirtschaftlichen Lage als den Ausverkauf der gesamten Besitztümer, von denen ihr eine Mansarde und wenige Kronen Erspartes übrigblieben. Ihre drei Töchter hatte sie zur Heirat feilgeboten, als seien sie Tücher auf einem Markt.
Anfangs hegte Olga Sympathien für Geza Ras; kurz nach der Hochzeit jedoch sollten diese in Argwohn umschlagen: Der Sonderling aus einer streng religiösen Familie war weit entfernt von jenem Idealbild eines Gatten, das Olga sich aufgrund ihrer bürgerlichen Herkunft zurechtgezimmert hatte. Geza trug eine böse Ironie auf der Zunge, die unablässig Olgas Schwächen suchte. Er schmatzte laut zu Tisch, wenn er gerade nicht in der Nase herumbohrte, und seine Popel aß er in der falschen Hoffnung, von Olga nicht gesehen worden zu sein. Oft bedachte er seine Ehefrau mit einem Kompliment, das schief war wie ein von ungeschickter Hand gehängtes Bild. Seltener wusste Geza ohne Vorwarnung einen hasidischen Gassenhauer anzustimmen, über dem Olga ihre Geduld vergaß. Und einmal verleitete sie seine dürftige Körperpflege dazu, sich bei ihrer Mutter nachdrücklich zu beschweren. Aber Mutter Melanija tat ihre Beschwerden als Nebensächlichkeiten ab. Für sie war Geza ein Jude aus traditionellem Hause, der Olga durchfüttern konnte; mehr brauchte sie nicht zu wissen. Was die Leute aus der Gemeinde sagten, erschien ihr wichtiger als das Wohlbefinden ihrer Tochter, die ausgerechnet das Gebot der Ehe anzweifelte! Olga wiederum hatte niemanden, an den sie ihre Klagen richten konnte. Sie glaubte nicht an Gott, aber an die Tradition. Ihre beiden Schwestern waren zu diesem Zeitpunkt bereits zwischen Rhein und Alpen verheiratet worden. Ihr blieb nichts anderes übrig, als anstelle der Liebe Vernunft walten zu lassen, und die Ehe der beiden, von der es in der Gemeinde hieß, sie sei die Vereinigung zwischen Jestira und einer Vogelscheuche, pendelte sich in den ersten Jahren zwischen Absprache und Zugeständnis ein.
Das Haus der Familie Ras war ein umgebauter Schuppen gewesen. Es lag in der Nähe des Friedhofs von Zimony — einige Straßen abseits des jüdischen Viertels in der Dubrovačka-Straße, in der Olgas Mutter lebte. Isak Ras war laut Geburtenregister der ehemaligen Kreisverwaltung in diesem Haus am 6. Jänner 1910 zur Welt gekommen. Geza Ras, der seiner schwangeren Frau zuliebe die Pejse abgelegt hatte, war nach einer Meinungsverschiedenheit bei seinen Eltern in Ungnade gefallen. Das hatte den sofortigen Auszug aus dem gemeinsamen Haushalt zur Folge. Der Entschluss, den Beruf des Schuhmachers zu erlernen, fiel mit dem Kauf des Schuppens, der bis dahin dem angrenzenden Hof der Familie Stadler als Viehstall gedient hatte. Hermann Stadler hatte Geza den Verschlag weniger aus Anteilnahme denn aus Geldnot verkauft. Kurz darauf zog er einen Zaun zwischen den beiden Grundstücken hoch, um, wie er lauthals zu verstehen gab, seine Familie vor dem Einfluss der Judenbrut zu schützen.
Nicht sonderlich geräumig, aber auch nicht dürftig, bot der Schuppen genug Platz für den Herd, die Werkbank des Vaters, das gemeinsame Bett und einen in der Mitte der Wohnstube aufgestellten Tisch. Durch das einzige, ostwärts ausgerichtete Fenster ergoss sich in den späten Morgenstunden ein Licht von der Klarheit stehender Gewässer. Mittags, wenn die Sonne ihren Zenit überschritt, war aus dem Fenster ein Okular geworden. Dann schälten sich die Farben aus ihrem weichen morgendlichen Kokon, und die Umgebung bekam Kontur: Rechts verlief ein mit Kopfsteinen ausgelegtes Gässchen, das hinauf zum Friedhof und weiter zum Turm von Gardoš führte. Linker Hand wucherte Gestrüpp bis hinunter zur Donau, an deren sandigen Ufern Viehbauern ihre Schweine hinter Holzverzäunungen hielten. Darüber hing ein heller, von Möwenschwärmen beheimateter Himmel, mit Wolken, die dünn waren wie Brautschleier. Das alles und noch vieles mehr zeigte das Fenster, unter dem — aus schwerer dunkler Eiche gefertigt — eine Kommode stand. Auf ihr hatte Olga neben einer Fotografie des von ihr verehrten Rabin Jehuda Alkalaj ein Buch aufgestellt, das kaum größer war als ihre Hand. Diese arabesk ornamentierte Hagada war ein Erbstück ihres Urgroßvaters, der das Buch in Sarajevo einst für gutes Geld erstanden hatte. Egal, wo sich jemand in der Wohnstube gerade aufhielt: Die Hagada war der Blickfänger! Ihr Dasein bildete den Kern einer Übereinkunft zwischen Olga und Geza, die keines Lautes bedurfte: Solange sich dieses Buch im Haus befand, lebten Juden darin, und an Freitagabenden, wenn das Werkzeug ruhte und ein Zündholz neben den Kerzenständern verglomm, da kam es Olga manchmal vor, als seien Mutter, Vater und Sohn tatsächlich zu einem Ganzen geworden: einer Familie. Der Seufzer, der diesen Gedanken begleitete, ließ Erev Šabat in ihr Haus eintreten, was Olga zufrieden, ja beinahe glücklich stimmte.
Im Herbst 1914 hingegen war Geza Ras von einer durch die Straßen Zimonys stampfenden, pickelbehaubten Horde zunächst angesteckt und schließlich mitgenommen worden. Er hatte den Worten seiner Ehefrau keine Beachtung geschenkt, als diese ihn anflehte, nicht die Kriege jener zu führen, die die Juden schlechter behandelten als ihre Hunde. Doch Geza hatte nicht vergessen, wie seine Familie behandelt worden war. Stolz hatte er niemals empfunden, und auch die Scham blieb für ihn ein Fremdwort, das seine Lippen nicht berührte. Wenn er etwas war, dann stur in seinem Glauben, durch gewissenhaftes Arbeiten und Diskretion dermaßen herkömmlich leben zu können, dass seine Religion letztlich einerlei würde. Darin unterschied er sich von vielen anderen aus der Gemeinde, die sich taufen und serbische Namen geben ließen. Seine Familie jedoch — die Tanten und deren Kinder, Vater Béla und Mutter Amatja, seine Schwester Sana —, sie alle hatten bei Ausbruch des Krieges die Karren beladen und waren geflüchtet. Geza für seinen Teil schwor den Eid auf Franz Joseph. Solange der Kaiser lebte, war er Garant für die Rechte der Juden im gesamten Reich; von klein auf war ihm diese Losung von den Älteren in der Gemeinde eingebläut worden. Dieser Verantwortung konnte er sich genauso wenig entziehen, wie Hilel sich einem Streit mit Šamaj entziehen konnte. So gesehen war der Krieg die Gelegenheit gewesen, eine Abkürzung aus dem Morast an Erniedrigungen und Hetze zu nehmen: Geza Ras war in den Krieg gezogen, um den Deutschen seinen Patriotismus zu beweisen!
Zuvor waren aus einer FN-Browning Modell 1910 zwei Kugeln abgefeuert worden.
Das Zeitungsbild des in Sarajevo aufgebahrten Thronfolgerpaares hatte sich Olgas Stirn von innen eingebrannt: Sophies zu Wachs erstarrte Miene neben Franz Ferdinands über Kreuz gelegten Händen, die sich ausgerechnet an ein Kreuz klammerten! Olga fragte sich, was diese Doppelung zu bedeuten hatte. Wer schrie und schrie vor ihrem Fenster so lauthals von Krieg?! Hüte flogen in die Luft, ohne zu ihren Besitzern zurückzufallen: ganze Straßenzüge gepflastert mit herrenlosen Hüten, die entzückt den Krieg begrüßt hatten. Aber der Freudentaumel war vorher schon in Wahn gegossen worden. Der Krieg, bisher nur als Wunsch nach Erneuerung in den Köpfen der Menschen mäandernd, war eine Totgeburt. Hässlich geworden ob der Flut an Extrablättern, verbreitete manch einer die Verschwörung mit der krummen Nase. Hinter den Schlagzeilen sah Olga den Hass auf Juden deutlicher hervorblitzen als sonst. Dagegen wog ihre persönliche Wahrheit gerade einmal 45 Kilo samt Kleidung. Dass ihr sechsjähriger Sohn im Körper eines Vierjährigen steckte, führte Olga täglich die eigene Hilflosigkeit vor. In Zimony verkaufte sie Gemüse am Markt. Oder sie wusch die Schmutzwäsche betuchter Damen, deren wohlgenährtes Äußeres sie an Raub und Mord denken ließ. Einmal stellte sie sich in ihrer Not unter eine Laterne — und floh beim ersten Angebot eines Mannes, dessen Goldzahn sie finster anblitzte. Daneben pflegte sie ihre kranke Mutter. Das Wenige, das sie besaß, tauschte sie bei Vida Popović gegen etwas Weizen. Den Weizen reichte sie weiter an Rafael Levi, der ihn in seiner Mühle zu Mehl verarbeitete. Aus dem Mehl backte sie Brot, von dem sie die Hälfte Sonja Beherano überließ, die Isak in Hebräisch Nachhilfe gab. Sie kochte Bohnensuppen, feilschte um Fisch, schrubbte das Haus, hackte das Holz, und auch das undichte Dach gehörte repariert. Der Große Krieg, so schien es, hatte ihr altes Leben hinweggefegt, und im neuen fanden Wünsche keinen Platz. Der Thronfolger war seit zwei Jahren tot — Geza Ras seit zwei Jahren fort. Die Zeitungen priesen die Tapferkeit Tausender. Aber diese waren nur die Opfer der Bonzen gewesen, die ihre Söhne nicht in den Krieg geschickt hatten. Die Elenden starben zuhauf. Sie starben in ihrer eigenen Scheiße!
Im Sommer 1916 war in der Vojvodina die Ernte ausgefallen. Zimony hatte zwielichtige Gestalten angezogen. Die Stadt war voller Bettler, Ganoven, Krüppel und Kriegszitterer. Olga, die für das Wohl ihres Sohnes die Kriegstage festzuzurren suchte, fühlte sich unwohl auf den Straßen. Ihre täglichen Besorgungen waren begleitet von Pfiffen und Zurufen fremder Männer, die ihre zerschlagenen Fratzen zur Schau stellten: Gestern etwa hatte Olga einen Mann ohne Unterkiefer gesehen, dem Eiter aus dem Zahnfleisch rann. Übermorgen würden zwei Männer vor ihren Augen eine Frau in einen dunklen Hauseingang gezerrt haben. Und nächste Woche schon wird Mutter Melanija gelb angelaufen sein: Ein Fieber wird sie ans Bett geschlagen haben. Olga im Wahn ankeifend wird sie keine Gebete gehört haben wollen. Den Kadiš, wird sie sagen, spare sich der Rabin für die Lebenden auf! Der Typhus wird sie dahingerafft haben, und außer Schulden wird sie ihrer Tochter die Mansarde in der Dubrovačka hinterlassen haben, mit deren Pfändung die Schulden beglichen würden … Jegliche Zukunft, ob als Wunsch geäußert oder als Schicksal hingenommen, versank im Schlamm dieser auf Tod und Stumpfsinn gebauten Gegenwart. Was anderes war der Krieg als ein Karren im Dreck, fragte sich Olga, während es einerlei geworden war, ob Herbst, Winter oder ein Jahr verstrichen. Denn 1917 zählte niemand die Toten mehr; im Osten, hieß es, bereiteten die Russen sogar die Revolution vor.
Olga hatte stark abgenommen. Zwar fühlte sich ihre Haut immer noch zart an, und Reste ihrer Jugend hatten sich in ihren Augen aufbewahrt, die tief waren wie Ziehbrunnen. Aber im Spiegel grüßten täglich ihre faulen Zähne. Ein Silberstreif durchpflügte das rostlockige Haar. Ihre Regel war seit Beginn des Jahres ausgeblieben. Sie war glücklich, dass Isak und sie am Leben geblieben waren. Doch was wog ihr Glück im allgemeinen Tenor der Welt? Sie sah das Leid der anderen mit unbestechlicher Klarheit, wogegen ihr eigenes Leid abstrakt blieb wie eine Metapher. Die Juden im Viertel wechselten die Straßenseite, wenn sie Olga sahen. Es bereitete ihnen Sorge, jemanden aus der Gemeinde derart zerlumpt in der Avra anzutreffen. Olga erinnerte sie an die Möglichkeit ihres eigenen Verfalls, was ihr wiederum recht war. Der Šabat war ihr heilig, Heines Lyrik oder die hohen Feiertage. Jene Menschen aber, die den Klatsch der Eintracht vorzogen, waren ihr egal geworden. Sie hatte sich entfremdet. Ihre Nerven waren dünn wie Geigensaiten, und Isak, der mittlerweile Aramäisch lernte, sah krank und ausgemergelt aus.
Olga wusch sich gerade, als ihr zum ersten Mal der Gedanke kam, sich mit den Zähnen die Adern auszureißen. Die Schuldgefühle, die auf diese Eingebung folgten, wichen sogleich der Erschöpfung, die ihr seit Tagen den Schlaf raubte. Sie stand mit nacktem Oberkörper über dem Waschbecken. An ihrer Haut hinabgleitende Tropfen trafen auf das Wasser, das graue Schlieren auf der weißen Emaille hinterließ. In den Mustern, die die Schlieren machten, glaubte Olga, einen Wink des Barmherzigen zu erkennen, der ihr zusprach, alles kaputtzuschlagen! Doch das Wasser verbarg auch einen Nelkenstrauß, der mit roter und grüner Farbe am Grund des Beckens aufgemalt worden war. Diese Ansicht sprach ihr Mut für den heutigen Tag zu, von dem sie ahnte, dass er wie der gestrige werden würde — da lösten sich einzelne Tropfen vom Geläut des Plätscherns: plitsch platsch plotsch plätsch plütsch! Olga, deren Finger und Zehen taub geworden waren, lachte. Sie lachte so laut, dass es an ihrem Trommelfell schepperte te te tt tt t t t te! Gewiss redete der Türstock zu schnell, als dass sie jedes seiner Wörter verstand. Aber das, was er sagte, hielt sie für wahr. Indes fügten sich die im Zimmer umherschießenden Geraden, Ritzen, Risse, Kerben, Spalten, Linien zu einem richtigen Bild zusammen, so dass Olga vor Staunen in die Hände klatsch latsch atsch tsch tsch tetete! Obgleich sie alles auf einmal hörte, ergab auf einmal alles einen Sinn n nnn nn n nnn nn n, und statt Hunger verspürte sie ein angenehmes Gääähneeen in ihrer Magengrube. Olga fand Gefallen an diesen wabernden Bildern. Oder die Bilder waberten nach ihrem Gefallen. Sie schaute aus dem Fenster in einen kalten und sonnigen Herbsttag. Draußen stand der jüngste Stadler und blies zum Angriff gegen eine Ziege. In seiner rechten Hand hielt er einen Stock, den er auf das Fell des Tieres preschte. Die Ziege — zunächst teilnahmslos auf einem Bündel Stroh kauend — riss die Augen auf und lachte.
Olga wandte sich fassungslos ab. Erst jetzt begriff sie, dass Ziegen nicht lachten! Was sie nicht begriff, waren ihre Hände, die sich warm, aber fremd anfühlten. Während sie versuchte, nicht in Ohnmacht zu fallen, fragte sie sich, was mit ihr geschah. Einige Stunden zuvor hatte sie eine Handvoll Roggenkörner zu sich genommen. Jetzt fiel ihr ein, dass sie die Körner nicht auf Pilze untersucht hatte. Sie erschrak, und der Schreck machte ihr Herz rasen. Die zerzausten roten Locken in der Luft wie Korkenzieher zwirbelnd vor Zorn entsann sich Olga eines Alten, der ihr einmal geraten hatte, sich beim ungewollten Verzehr von Stielpilzen ruhig zu verhalten, eine Kleinigkeit zu essen, gleichmäßig zu atmen — sich dem warmen vertrauten Gefühl hinzugeben. Sie kramte einen Apfel hervor, den sie für das Abendessen zurückgelegt hatte, und biss in sein Fleisch wie in eine Wunde. Sie dachte nicht ans Sterben! Das Blut, das in ihren Adern hämmerte, schoss hinauf zu den Schläfen, und mit Blick auf den Spiegel begannen die Sommersprossen auf ihrer blassen, von Schweißperlen gesäumten Stirn Schatzkarten zu Orten zu zeichnen, die es nur in der Fantasie von Kindern oder Irren gab.
Olga flüchtete nach draußen, wo die frische Luft sie ohrfeigte. Doch der Anblick eines jungen Kürbisses in ihrem Garten erwärmte ihr Herz. Anderswo drückten Lauchstängel gegen die Erde, in der noch Karotten und Erdäpfel wucherten. Über einem verrotteten Kohlkopf schwirrte ein Fliegenschwarm. Am anderen Ende der Gasse heischte ein im Ostwind raschelnder Wacholderbusch nach Olgas Aufmerksamkeit: Spatzen, die im Wacholder nisteten, flogen zwitschernd ein und aus, als stünde ein Unwetter bevor. Olga vernahm ein Gemurmel, das sich wie Grünspan über die frühabendliche kupferne Ruhe gelegt hatte. Die Deutlichkeit, mit der sie die vielen Stimmen voneinander schied, weckte in ihr das Bedürfnis, ihre Hände der Sonne entgegenzustrecken, was sie auch tat.
»Aaaahhhh!«
Olga erhaschte den jüngsten Stadler, wie er brüllend davonlief. Von dessen Getöse angelockt, traten mehrere Nachbarn aus den umliegenden Häusern auf die Gasse. Hermann Stadler, groß wie ein Weinfass und ebenso breit, erschien am Zaun; sein Sohn kugelte hinter ihm her. In der Gasse entstand ein Gedränge. Allmählich zogen die Leute einen Kreis um Olga, die nicht verstand, was die wilden, erwartungsvoll auf sie gerichteten Blicke zu beanstanden hatten: Kocsis Agota verdeckte ihrer Tochter die Augen. Die Gebrüder Kurt — Slavko und István — schüttelten einmütig die Köpfe. Zdenka Radić bekreuzigte sich viermal, bevor Schimpfwörter fielen, von denen eines Olga als Hure bezeichnete. Aus der hinteren Reihe wurden Rufe laut, die der Gottlosen den Tod herbeiwünschten. István Kurt, nun der Menge zugewandt, bescheinigte der gesamten Judenschaft Verdorbenheit und Arglist, aufgrund derer der Heiland am Kreuze endigte.
Das Raunen der Gaffer pochte gegen Olgas Ohren, die sie mit beiden Händen zu verdecken suchte. Die Leute um sie herum hatten alles Menschliche verloren: Ihre Gesichter waren zu Grimassen angeschwollen, in denen Blicke wie Scheiterhaufen loderten. Zwischen ihrem Hass, den sie in Halbsätze kleideten, und einer Gewalttat war weniger als ein Funke — ein letzter Fetzen Verstand.
Unterdessen spielte sich vor Hermann Stadler Ungeheuerliches ab: Die halbe Nachbarschaft war in Aufruhr wegen Olga Ras, der Lumpenjüdin, wie er sie nannte, die gemeinsam mit ihrem Sohn in seiner alten Stallung lebte. Sie schritt mit nacktem Oberkörper vor dem wütenden Mob auf und ab und wirkte äußerst verwirrt. Zugegeben: Hermann Stadler sah seinen eigenen Widerwillen gegen Juden herausgefordert. Er hörte die Worte von István Kurt, die ihm einfach und christlich vorkamen. Aber ein Gedanke an seine eigene Tochter gebot ihm, den jüngsten Sohn wie einen Hund abzukommandieren, damit er eine Decke aus dem Haus hole! Überhaupt, rätselte Stadler, stand die Welt seit Tagen Kopf. Er dachte an seinen ältesten Sohn, der gerade auf Fronturlaub gewesen war und ein düsteres Bild von der Situation in den Gräben gezeichnet hatte. Zwar reichte Hermann Stadlers Denke für die Vorstellung eines verlorenen Krieges nicht aus — von einem gemeinsamen Staat mit dem Serbenpack, von dem in den hintersten Ecken des Reiches die Rede war, ganz zu schweigen. Dennoch verstand er Olga Ras: Auch er war verwirrt.
Der jüngste Stadler kehrte mit einem Pferdeüberwurf zurück. Hermann Stadler nahm die Decke und eilte um den Zaun. Er zwängte seinen Wanst durch den aufgestachelten Haufen, während das Brüllen langsam verebbte. Die Leute erkannten seine Absicht, weshalb sie ihn nicht davon abhielten, die Decke über Olga Ras zu werfen und dem Treiben ein Ende zu setzen. Erleichterung machte sich breit. Jetzt wollten einige von ihrer Feindseligkeit nichts gewusst haben. Andere wiederum glaubten, wenn Hermann Stadler, ein strammer Schwabe, das könne, konnten sie das auch: diese Barmherzigkeit. Doch die Vergebung, die manch einer in den Baumkronen suchte, fand diesen einen nicht. Stattdessen huschte eine Katze über die Straße. Auf ihrem Rücken trug sie die Abenddämmerung, mit deren jähem Einbruch sich die Menge zerstreute. Der Vorfall war bereits Gerücht geworden. Morgen würde darüber beim Wirten geredet werden.
Hermann Stadler hatte sich mit seinem Sohn vor Olga postiert, bis die letzte Tür in ihr Schloss gefallen war — der letzte Vorhang zugezogen. Dann fragte der jüngste Stadler seinen Vater: »Was jetzt …«, und bekam als Antwort einen Schlag auf den Hinterkopf, woraufhin beide — Olga hätte schwören können — in Rauch aufgingen.
Die Glocke der Jungfrauenkirche läutete zur Vesper.
Das Licht des aufgehenden Mondes hatte alle Farben in Kälte gehüllt. Ein Gestank von frischen Eingeweiden durchwehte die Luft. Olga bemerkte erste, auf die Nachtplane einstechende Sterne. Sie richtete sich auf und legte die Decke um ihre Hüfte. Auf ihrer nackten Brust, die zu einer Leinwand geworden war, tänzelten allerlei Schattenspiele, denen sie aufmerksam mit den Fingern folgte. Mit der Schuhspitze hackte sie in der Erde herum, wie sie es immer tat, wenn sie angestrengt nachdachte. Am Nachthimmel schoben sich Wolken vor den Mond: Einzelne Strahlen brachen durch die Wolkendecke und erweckten den Eindruck, einem unsichtbaren Schlund zu entgleiten. Olga glaubte, ein Licht gesehen zu haben, das heller war als die Mondscheinbündel, die nur schwer ihren Weg zwischen die Wolken fanden: ein die Nacht zerreißender Kegel reinen weißen Lichts, auf den eine Detonation folgte — eine Bombe oder Artillerie —, und schon war es still geworden — wie im Inneren eines Steins. Der Krieg zog ungestraft durchs Land, dachte Olga: dieser mit einem Stück Kadaver fickende Bastard! Sie war froh, dass Isak der Hass des Mobs erspart geblieben war, ja. Aber der Unterricht war seit geraumer Zeit beendet. Das Kind hätte längst zu Hause sein müssen. Der Kürbis gehörte gepflückt, das Feuer angefacht, das Wasser gesotten, der Pilz vom Roggen getrennt, das Wenige verkocht, damit es eine karge Mahlzeit ergab … Es war Freitagabend, und Olga hatte einfach keine Kraft.
Wieder läutete die Glocke.
Olga ging zurück zum Haus, wo sie durch das Fenster in die Wohnstube hineinblickte. Bald gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit, und Umrisse tauchten auf wie sacht ins Schwarze gekerbte Schnitte: Da war der Esstisch, auf dem ein Durcheinander jeglicher Ordnung harrte. Isak hatte den Knäufen der Bettstecken Socken übergezogen, was Olga kurz zum Lachen brachte. Neben dem Herd lagen Holzscheite, die sie mit einem karierten Tuch bedeckt hielt, auf dem Geschirr trocknete; die Glasur der Tellerränder funkelte im Dunkeln. Auf der anderen Seite der Wohnstube stand die Werkbank von Geza Ras, auf der Staub — Schicht um Schicht — die Kriegsjahre zählte. Die Hagada lag nichtssagend auf der Kommode; zwei Kerzen warteten auf den heillos sich verspätenden Šabat.
Olga wollte sich in die Einsamkeit des Stilllebens flüchten, zu dem die Wohnstube geworden war: Sie wollte selbst zur Kerze werden, zum Docht, zum Feuer. Aber der Rausch, der ihr am frühen Abend in die Glieder gefahren war und ihr Fühlen um einen Blickwinkel erweitert hatte, um sie schließlich in den Abgrund zu stürzen — der Rausch war zu einem Rauschen verebbt. Olga spürte ein Kribbeln in ihrer Schädeldecke. Es knisterte kurz, und als sie das Haus betrat und sich auf den Hocker setzte, begann für sie eine tiefere, eine geheimnisvollere, eine innere Reise. Sie saß da, beinahe trotzig, und dachte nach: Mutter Melanija war tot, und letzten Jom Kipur hatte sich Olga ihre Freude darüber vergeben. Gezas Heimkehr war zu einem leisen unausgesprochenen Wunsch verwittert, dessen Erfüllung keine Zuversicht barg. Isak und sie waren der alleinige Rest einer Familie, die es ohne diese Geschichte nicht gäbe. Olga spürte die Anwesenheit dieses arglosen Gottes, der seit den Tagen der Tora ein und dasselbe Lied geigte: Niemand konnte die Juden vor dem Bösen beschützen, das mit dem Ende des Krieges herangeritten kam. Vor dem Krieg hatte es junge Männer in der Gemeinde gegeben, die den alle halben Zeiten auftauchenden Judenhassern entgegengetreten wären. Allein jedoch sah sich Olga außerstande, das Band zwischen sich und ihrer Religion zu halten.
Minuten verstrichen. Oder aber es waren Stunden, die Olga mit dem Aussitzen ihrer Scham zugebracht hatte. Die Wut, die sie verspürte — obgleich in der Gegenwart geboren —, war jahrtausendealt; sie war der Hilflosigkeit geschuldet, die innerhalb weniger Augenblicke aus einer vermeintlichen Heimat einen Kerker machte. Diese Vorstellung versetzte sie in Angst und Schrecken. Brechreiz und Fieber begannen, ihren Körper zu schütteln. Sie stand auf und lief einmal um das Haus und zum Abort. Dort kotzte sie sich die Erinnerung an das, was geschehen war, aus dem Leib. Erstaunt, wie viel sie im Magen hatte, übergab sie sich so lange, bis sich das erniedrigende hasserfüllte beklemmende Gefühl, von Magensäure zersetzt, in Wohlgefallen, ja Entzücken auflöste. Dann stand sie auf und schob ihre Brust nach vorne. Stadlers Decke warf sie in den Abort.
Isak wartete vor der Haustür. Er war unschlüssig, mit welcher Miene er das Haus betreten wollte. Wegen einer Rauferei mit Šimon Pardo war er viel zu spät von der Avra losgekommen. Der Bürgersohn hatte ihn wieder einmal einen stinkenden Ganev genannt, und seine Sorge war groß, dass Mutter ihm die Schuld für den vermasselten Šabat geben würde. Die Ohrfeigen, die als Strafe auf sein Zuspätkommen anstanden, waren Isak egal. Sie zwickten vielleicht. Aber der Schmerz war etwas, worin seine Wangen geübt waren. Er bedauerte nur, dass die Mutter unter den Prügeln, die er bekam, am meisten zu leiden hatte: »Glaube mir, Kind …«, sagte sie immer, »mir tut das mehr weh als dir …«, und Isak glaubte ihr.
Auf dem Nachhauseweg hatte er die Abkürzung über den Friedhof genommen: Die Soldaten, die den Gardoš-Turm bewachten, waren nicht auf ihren Posten gestanden. Isak lauschte dem Knacken frisch aufplatzender Kiefernzapfen, wobei es auch das Knattern ferner Gewehrsalven hätte sein können; ein Geruch von Schießpulver begleitete seinen Weg durch die Nacht. Die Lichter in den Laternen waren gelöscht worden. Er erkannte nur die Umrisse von Grabsteinen, wie sie den Pfad, den er zu gehen hatte, absteckten. Ansonsten war alles finster. Mutter hatte ihm verboten, diesen Weg zu gehen. Er war verwinkelt, unheimlich, und vielerorts lungerten Sandler. Und tatsächlich nötigte ihn ein im Dickicht bedrohlich summendes Fliegen- oder Hornissen- oder Wespennest, die Beine in die Hand zu nehmen und nach Hause zu laufen, wo er immer noch vor der Haustür verharrte: Die Ausrede, die er sich für sein Zuspätkommen zurechtgelegt hatte, zündete nicht. Er würde den Schmerz von Mutters Ohrfeigen für beide aushalten müssen, dachte er — und lachte.
Ein lautes Rumpeln drang aus dem Inneren des Hauses nach draußen. Der Lärm scheuchte die Hühner in Hermann Stadlers Hof auf. Isak trat näher an die Haustür heran. Seine Vorsicht überschlug sich mit der Neugier vor dem Unbehagen, das sich seiner bemächtigt hatte. Finsternis trübte seinen Blick: Durch den Türspalt beobachtete er den vom Kerzenschein hervorgehobenen Schatten einer Frau … Oder war es ein Ungeheuer, das dort vor dem Herd kniete und sich am Dielenboden zu schaffen machte? Es schnaubte und grub und zitterte am ganzen Leib. Isak meinte, ein Fell erkennen zu können, das im Licht der Kerze rötlich schimmerte. Neben dem Ungeheuer — er konnte nicht genau erkennen, ob es tatsächlich einem Marder ähnelte — lag das Buch, aus dem Mutter ihm bisweilen die Bilder erklärte; mit seinen langen, knochigen Klauen wickelte es die Hagada in ein Tuch und legte sie in das Versteck, das es zuvor gegraben hatte. Die Dielen schob es wieder an ihren Platz zurück.
Isak verließ der Mut. Er haderte mit dem Trugbild, das vor seinen Augen die Stube auseinandergenommen hatte. Zwar pinselte das Kerzenlicht die Silhouette eines Ungeheuers an die Wand. Doch es war eine Frau, die wie verwandelt dastand und sich streckte. Sie wirkte zufrieden, aber erschöpft. Ihr Oberkörper war nackt, was Isak seltsam vorkam. Ihre Hände waren gebadet im Dreck der Erde, den sie mit einer nachdrücklichen Geste über Stirn und Wangen verteilte. Sie taumelte hinüber zum Tisch, auf dem das Waschbecken stand, und Isak hörte Wasser plätschern. Er war nicht wie sonst, wenn er Mutter heimlich beim Baden zusah, aufgeregt — er war angeekelt! Während die Fremde eines von Mutters Kleidern überwarf, fluchte und spuckte und zischte sie, dass Isak nicht mehr wusste, ob sich das Gesehene mit der Wirklichkeit, die er gewohnt war, deckte: Die Frau am anderen Ende des Zimmers benahm sich wie eine Mimin, die Mutters Bewegungen nachzuäffen versuchte — die Mutters Haut als Mantel trug! Diese Vorstellung allein weckte in ihm die Angst, gefressen zu werden. Er schaute sich panisch nach einem Versteck um, das er nach kurzem Suchen im Wacholder gegenüber vom Haus fand. Als er unter den Busch kroch, flatterten die darin schlafenden Spatzen auf und verschwanden als zwitscherndes Wölkchen auf der Suche nach einem neuen Nistplatz. Dann wurde es still. Von seinem Versteck aus verfolgte Isak jeden Schritt des Ungeheuers, das aus dem Haus getreten war und Ausschau zu halten schien — nur wonach? Hatte es seine Fährte aufgenommen? Und wenn ja, konnte Gott ihn davor bewahren, gefressen zu werden? Trank das Ungeheuer nur das Blut, oder nagte es auch das Fleisch von den Knochen? Würde von ihm, Isak Ras, etwas übrigbleiben? Er ging im Kopf alle Ungeheuer durch, die er kannte: Der Ziz, so viel konnte er sagen, war mit den Spatzen davongeflogen. Für einen Levijatan war die Erscheinung zu klein. Aber den Behemot hielt Isak für eine echte Gefahr! Schließlich lag dessen Zuhause im Schatten, und was war schattiger als die Nacht?!
Auf der anderen Seite suchte Olga gramgebeugt die Gegend ab. Nach einer Nacht des Nachdenkens, des Abwägens und des Auslotens, des Kotzens, Grabens und Versteckens — nach einer Nacht voller Entscheidungen hatte sie endlich Zeit gefunden, bleich zu werden vor Sorge: Isak war nicht nach Hause gekommen. Sie würde dem Jungen die Wangen scheuern, wenn er keine glaubwürdige Ausrede bei der Hand hätte! Seit Stunden war die Sonne untergegangen, und in ihrem Kopf führten Vernunft und Regung einen aussichtlosen Kampf um die Frage, was geschehen war: Was war geschehen, Olga? Sie schämte sich bereits, die Hagada vergraben zu haben. Ihre aus dem Frust geborene Annahme, dass mit dem Verstecken des Offensichtlichen auf lange Sicht der Hass ihrer Peiniger verschwände, war falsch; sie wusste das. Aber das Warten auf bessere Zeiten kam ihr brotlos und feige vor. Sie entschied, die Avra aufzusuchen und Rabin Urbah zu fragen, wo Isak abgeblieben sei. Vielleicht war etwas vorgefallen. Vielleicht war alles nur ein Missverständnis.
Olga ab.
Nachdem er das Ungeheuer hatte davonrauschen sehen, kroch Isak aus seinem Versteck hervor. Er war müde von den vielen Schrecken, denen sein Blick ausgesetzt gewesen war. Die Füße, auf die er hinabschaute, gehörten nicht ihm; sie bewegten sich ohne sein Zutun. Die dreiundvierzig Schritte, die er vom Wacholder bis zur Haustür brauchte, zählte er nicht. Dafür bot sich Isak der Anblick einer leeren, von Dunkelheit beschlagenen Wohnstube dar, in der alles Vertraute äußerst befremdlich erschien. Der Geruch einer kurz zuvor gelöschten Kerze stieg in seine Nase. Er ging zur Kommode und zündete die Kerze wieder an. Seine Schultasche warf er auf das Bett, auf dem die Abdrücke zweier Körper die mit Stroh gestopfte Matratze schattierten. Weil er nicht verstand, was vorhin geschehen war, versuchte er, die vielen Bilder, die seinen Gedanken zuflatterten, zu ordnen. Auch traute er sich nicht, die Dielen, die lose unter seinem Fußtritt knarzten, hochzuheben und nachzusehen, wo das Ungeheuer gewühlt hatte. Die Hagada lag unter den Dielen vergraben; so viel Erinnerung gestand sich Isak zu. Aber die Kerze, die er angezündet hatte, klebte am Grund einer alten zerbrochenen Tasse. Dieses Rätsel ließ er unberührt für sich allein stehen.
Isak betrachtete die Fotografie von Rabin Alkalaj, die auf der Kommode liegen geblieben war: Der lange weiße Bart, der auf der Brust des alten Mannes ruhte, wirkte weniger ermahnend als sonst. Die ewige Sorge auf seiner Stirn war plötzlich einer Güte gewichen, die Isak ein Lächeln abrang. Er fühlte sich dem Greis verwandt, ohne genau benennen zu können, weshalb. Mutter hatte ihm unzählige Geschichten über Rabin Alkalaj erzählt, der sein halbes Leben in Zimony gewirkt hatte, bevor er seine letzte Ruhestätte am Ölberg fand. Beim Erzählen dieser Geschichten geriet Mutter oft ins Schwärmen über die wegweisenden Taten des Rabins, und wäre Palästina zur Sprache gekommen, hätten ihre Augen gefunkelt wie Scherben eines Kirchenfensters. Doch Isak, dem das lange lockige schwarze Haar schüchtern auf die Schultern fiel, konnte mit dieser Begeisterung für ein fremdes Land wenig anfangen. Für ihn war Diaspora ein Fremdwort geblieben, während sich die ewig glatten Felder der Vojvodina genauso gut als biblische Wüste imaginieren ließen. In seiner Vorstellung war Israel, dieser von Mutter beschworene Flecken Erde, bereits hier — hier in Zimony! Ein gerechteres Zuhause erwies sich als Tagtraum, der Gott und Gott allein vorbehalten blieb.
Isak gähnte.
Die Bilder in seinem Kopf führten ihn durch einen schmalen Gang, dessen Wände denen in seinem Haus zum Verwechseln ähnlich sahen. Am Ende des Ganges befand sich eine Tür, hinter der ein Ungeheuer hauste, das er durch den Türspalt beobachten konnte: Mit seiner fahlen Haut und den schlechten Zähnen erinnerte es Isak an die vielen Soldaten, die seit Beginn des Herbstes auf den Gehsteigen der Stadt hausten. Sie schliefen auf Strohsäcken und Zeitungen unter freiem Himmel oder in Haustoren. Manche von ihnen streiften durch die Gassen wie Ungetüme auf der Suche nach ihren Beinen, Armen, Mündern, Augen, Zähnen, Ohren, Nasen, die sie allesamt im Krieg verloren hatten. Andere wiederum bettelten um ein wenig Milch, indem sie mit Blechdosen gegen ihre Prothesen klimperten. Und wiederum andere warteten vor den Krankenhäusern auf freie Betten, die einem das Sterben in der Kälte ersparten. Dann bekamen sie von den Krankenschwestern Bandagen um ihre zerbeulten Köpfe gewickelt. Oder sie stürzten sich aus den Fenstern, in der Hoffnung, dem Leben fallend entkommen zu können. Einmal hatte Isak einem Soldaten, der ausgestreckt am Gehsteig lag, die Stiefel ausgezogen, ohne sich dabei etwas zu denken. Mutter hatte ihm beigebracht, dass im Krieg ein Toter sein Schuhwerk nicht brauchte. Ein solides Paar Schuhe war einen ganzen Laib Brotes wert, und galt das siebte Gebot für einen, dessen Blut den Bordstein färbte?
Manek Lebović, sein einziger Freund, war ebenfalls gestorben: letzten Winter am Fleckfieber. Seitdem war Isak viel allein. Wenn er Mutter nicht helfen musste, war er im Unterricht, und wenn gerade kein Unterricht war, verbrachte er seine Zeit am Markt. Dort spielte er das Spiel der vielen Zungen, das er selbst ersonnen hatte. Darin unterschied er sein eigenes Deutsch vom Jiddischen der Händler in der Dubrovačka, deren Serbisch rauer klang als das Ijekavische der Kroaten, dem das Bosnische glich. Er beneidete die osmanischen Gewürzhändler um deren türkischen Singsang, wogegen die Ruthenen spuckten, wenn sie einen Juden sahen!
Überhaupt waren die Menschen um Isak herum verrückt nach Juden.
Jeden Dienstag, hager und flau im Gesicht, hetzte ein Priester vor der Jungfrauenkirche gegen Juden und Türken. Er verbreitete Schauergeschichten über angesehene jüdische Familien, deren Leibgetränk das Blut von Christenkindern war. Auch verrieten Juden das Vaterland, indem sie die Judenseuche mit der Judenimpfung von der Front nach Zimony brachten. Die Eisenbahnen fielen von den Brücken, weil Juden die Brunnen vergifteten, und wenn ein Messer in jemandes Rücken steckte, gehörte es dem Juden soundso. Der Schnupfen des Nachbarn ging in gleichem Maße auf Juden zurück wie das schlechte Wetter. Juden ernährten sich von Ratten. Oder sie versteckten Rattenschwänze in ihren Unterhosen. Daneben machten sie gemeinsames Geschäft mit den Türken, aber auch mit den Serben, die die Türken hassten und umgekehrt. Und wer all diesen Geschichten keinen Glauben schenkte, bekam ein Heftchen in die Hand gedrückt. Denn in diesen Protokollen stand alles geschrieben, was man über die Niederträchtigkeit der Judenschaft zu wissen brauchte!
Isak musste schmunzeln. Er war sich nicht sicher, ob er bloß schlief oder bereits im Stehen träumte. Seine Augen waren geschlossen und geöffnet zugleich. In seinem Innern herrschten Stillstand und Unrast in einem. Alles, was er kannte, war diese eine, im Ausnahmezustand geborene Welt, in der die Bilder keiner bestimmten Chronologie folgten. Sein Bewusstsein klammerte sich an belanglose Episoden, die ihm gut und ehrlich erschienen: etwa an Rabin Urbah, der einmal meinte, dass er dumm sei wie eine Stute. Aber Isak kümmerten die Worte anderer nicht, obgleich diese anderen vorgaben, seine Lehrer zu sein. Mutter hatte ihm eingebläut, dass im Unglück ein Rabin an Würde verlor, ja bis zur Unkenntlichkeit hässlich zu werden drohte; andere dagegen, an die niemand einen Gedanken verschwendete, an Würde gewannen.
Mutter hatte Muskeln wie ein Soldat. Ihre Hände waren hornig und rau. Unter ihren Fingernägeln sammelte sich Dreck, den sie heimlich mit der Messerspitze abschabte und aß; Isak hatte es mehrere Male beobachtet. Mutter war eine gute Gärtnerin. Sie verkaufte Gemüse am Markt, während andere Frauen, die keine guten Gärtnerinnen waren, das Gemüse von Mutters Stand zu klauen versuchten. Ihr breiter Rücken und ihre Locken waren Isak lieb. Für ihn war sie eine jener Frauen, deren Taten im Tanah besungen wurden: keine Judita, sondern eine Hagar. Er verstand nicht, weshalb ausgerechnet ihre Ohrfeigen Gerechtigkeit bedeuteten, aber er wollte Muskeln haben wie Mutter! Sie war es, die ihm beigebracht hatte, was es bedeutete, Jude zu sein: den Šabat zu ehren, Pasha, Jom Kipur, und sein allerliebstes Hanuka. Gelegentlich saßen sie vor dem Haus und lachten über die winzigen Bilder in der Hagada: über den splitternackten Noa etwa, oder über manch unsinnige Micva. Aber Mutter lachte selten. Sie war gütig und verbittert, tobsüchtig und sanft, gutherzig und nachtragend. Er wusste, dass ihr Name Olga war, und obwohl sie öfter am Tag den Satz »Ich habe keine Kraft mehr …« aufsagte, nahm sie im nächsten Augenblick den Hammer und reparierte das undichte Dach.
Isak hörte den Hunger in seinem Magen grummeln. Um die Unruhe zu zerstreuen, die ihn heimgesucht hatte, setzte er an, jene Stelle aus der Tora wiederzugeben, die er heute Nachmittag gelernt hatte. Die zum Abschnitt gehörige Melodie kroch aus seinem Mund, und eine helle Stimme erfüllte den Raum mit Zuversicht und Freude. Kurz umspülte Isak eine Heiligkeit, die imstande gewesen wäre, ein Kind vor einem Ball innehalten zu lassen. Doch kein einziger hebräischer Satz wollte ihm gelingen. Es schien, als wäre ihm die Sprache abhandengekommen. Das Knurren in seinem Magen übertönte die Melodie, die von einem Ton zum nächsten in sich zusammenfiel. Der Hunger blieb ein Köter, der sich nicht so einfach zähmen ließ. Unterdessen pfiff der Wind durch die Bretter des Verschlags, den Isak Zuhause nannte: Er fror. Seine Zähne schmerzten. Eine Kerze erlosch. Rabin Alkalajs Stirn verdüsterte sich.
Die Frauen, die ihm nun entgegenkamen, trugen schwarze Tücher um ihre Köpfe. Ihr gemeinsamer Mund verfluchte im Chor einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite marschierenden Soldaten ohne Beine. Am Firmament flogen Krähenschwärme in geordnetem Durcheinander. Halbwesen bevölkerten die Gehsteige der Stadt: kriegsgeplagte Geister, verkrüppelte Propheten, Vorboten eines größeren Unheils. Kinder — Mädchen und Jungen mit den Gesichtern von Isak — schliefen in den Haustoren unter Schnee, und die Serben, gerüchtete es von überallher, rückten immer weiter vor und zurück. Ein erste welke Blätter vor sich hertreibender Wind kündigte die fünfte Jahreszeit an: Sommer, Herbst, Winter, Frühling, Krieg — der Krieg war verloren; der Krieg war gewonnen. Die Donau war ein Grab. Und galt das elfte Gebot für den Träumenden, wenn er im Traum den Tod mit Handschlag begrüßte? Was würde mit der Hagada geschehen sein? Und war das Isak, oder wer hatte an einem besonders heißen Tag entlang des Kais viele Leichen an Galgen hängen sehen?
Die Haustür sprang auf. Das Grau der Morgendämmerung floss träge in das Zimmer hinein. Blass einfallende Lichtbündel verliehen jeder scharfen Linie — jedem Riss, jedem Winkel, jeder Ecke und Kante — ein weiches Antlitz. Andacht schwebte über allem. Es roch nach kalter Asche und nach Schlaf. Draußen hatte es angefangen zu regnen. Die Spatzen, inzwischen wieder Herren über den Wacholder, tschilpten trunken aus ihrem Unterschlupf. Stadlers Hahn krächzte zum Appell.
Olga stand an der Türschwelle. Sie betrachtete ihren Sohn, dessen langsam im Dämmer sich aufblähende Gestalt am anderen Ende der Wohnstube erschien. Isak stand vor der Kommode. Olga rief nach ihm. Aber er rührte sich nicht. Im gleichmäßigen Schaukeln seines viel zu kleinen Körpers erkannte sie, dass er schlief — dass er im Stehen eingeschlafen war: Seine Arme baumelten von seinen Schultern; sein Kopf war in den Nacken gelehnt. Er schlief genau über jener Stelle, unter der die Hagada vergraben lag, was Olga zum Weinen brachte. Sie weinte so stark, dass sie sich an ihren eigenen Tränen verschluckte. Im Bild des Schlafenden sah sie kurz jenes Göttliche aufblitzen, das Stunden zuvor von ihrer Angst erstickt worden war: Ihm wohnte ein Geheimnis inne, das in keinen Rahmen passte — in keine Sprache, keine Religion. Nur dieses Bild schien wahrhaftig zu sein. Den bitteren Rest hatte sie ausgekotzt.
Olga näherte sich ihrem Sohn. Sie ging in die Hocke und nahm ihn vorsichtig in die Arme. Um sich zu vergewissern, dass er schlief, pustete sie eine Locke von seiner Stirn. Die Müdigkeit hatte sich wie eine Maske über ihr Gesicht gelegt. Sie dachte, dass sie nicht mehr denken könne. Ihr Kreuz schmerzte. Sie rang nach Luft — oder es war das Leben selbst, das sie atmend festzuhalten suchte. Am Abend, als sie nach langem Wägen beschlossen hatte, die Hagada zu vergraben, hatte sie ein Ziehen in ihrer Brust verspürt: Sie wusste, sie hatte Milch. Darum entblößte sie ihre linke Brust, die Isak instinktiv annahm. Er saugte, und Olga kam nicht einmal dazu, sich darüber zu freuen, dass ihr Sohn endlich zu essen bekam. Denn sie war vorher im Sitzen eingeschlafen.
Ob Zimony während der Donaumonarchie oder Zemun im neugegründeten Königreich der Serben, Kroaten und Slovenen: Im Frühjahr 1919 verschwand die Familie Stadler. Erste Knospen sprießten aus den Ästen der Bäume entlang der Hauptallee, die von jungen Gesichtern bevölkert war. Paare wagten sich hinaus auf die Promenade in ihren besten Kleidern. Bei Dina Kovačić gab es eine Handvoll gebratener Sardinen für drei Blechmünzen, und in den Gassen stritten Kroaten mit Kroaten über Segen und Fluch eines Staates, den sie mit dem Serbenvolk zu teilen hatten. Pamphlete der neugegründeten Sozialistischen Arbeiterpartei machten die Runde: »Für den unversöhnlichen Klassenkampf des Proletariats mit dem Ziel einer Vernichtung des Kapitalismus und der Einrichtung eines kommunistischen Staates!« Und wieder ging ein mieser Schnupfen um.
Hermann Stadlers Ochse — ein altes und fleischiges Tier — zog schweren Schrittes einen mit Möbeln, Kleidung, Gerät und Krempel beladenen Karren. Der Koloss schnaufte mitleiderregend, als spürte er, dass dies seine letzte Reise werden würde. Dem Wagen folgten der Patriarch, Hermann Stadler, seine Ehefrau Minna, Tochter Erika und die beiden jüngeren Söhne Otto und Nikolaus; der älteste Sohn, ebenfalls Hermann, war wenige Tage vor Compiègne an der Siegfriedlinie gefallen. Der gesamten Familie war der Kummer über die Ungewissheit eines solchen, endgültigen Aufbruchs anzumerken: Sie alle waren in Zimony zur Welt gekommen und hier aufgewachsen. Ulmer Schachteln hatten einst ihre Vorfahren an diesen Abschnitt der Donau gebracht, und das letzte Bild, das ihnen von dieser Heimat übrigbleiben würde, war der Hintern eines Ochsen, der ihr gesamtes Hab und Gut in Richtung unbekannt bugsierte. Dass sich andere Schwaben dem Trauermarsch durch die ehemaligen Kronländer angeschlossen hatten, bot den Stadlers keinen Trost. Das Einzige, woran sie sich klammerten, war die Gewissheit dieser Geschichte, die sie samt Ochsen auffressen wird.
Dann verging ein Jahr.
Im Frühjahr 1920 erklärten Zeitungen das amerikanische Fieber, das in Europa zwei volle Jahre gewütet hatte, für bezwungen. Im Königreich war die Krankheit neben Cholera, Typhus und Malaria nicht weiter aufgefallen. Nur Olga schien bemerkt zu haben, wie ihre Nachbarn eines Tages in corpore zu husten begannen — wie sie in den Wochen, die kamen, hinweggerafft wurden wie Steinchen auf einem Abakus. Seit dem Vorfall vor zwei Jahren hatte es niemand gewagt, sich Olgas Haus auf zehn Schritte zu nähern. Die Abscheu gegenüber der einzigen jüdischen Familie im Viertel hatte insgeheim jene Entfernung abgesteckt, die es dem Fieber verunmöglichte, Olga oder Isak zu erreichen: Slavko Kurt glaubte eine jüdische Verschwörung am Werk, nachdem er Rotz und Gedärme spie. István Kurt krepierte drei Wochen nach seinem Bruder vor der eigenen Haustür. Zdenka Radić war bereits im Februar gestorben, und auch der leblose Körper von Kocsis Agota war letzte Woche von Männern einer Strafkompanie davongetragen worden: Olga, die bei der Gartenarbeit innegehalten hatte, verfolgte aufmerksam das Geschehen, während Agotas Tochter Zsófia — den Leichnam ihrer Mutter fest umschlungen — Olga stumm aus der Ferne erzählte, was vorgefallen war: Die Mutter hatte offenbar gedacht, dass ein Schnupfen sie überrascht habe. Anschließend war sie vom Fieber zermalmt worden. Obgleich ihr heiß war, zitterte sie vor Kälte. Schweiß perlte auf ihrer Haut wie Tau. Ihre Pupillen waren stecknadeldünn. Die Last auf ihren Beinen hinderte sie am Gehen. Das Essen fiel ihr genauso schwer wie das Trinken. Mehrmals pisste sie das Bett voll. Das ganze Haus stank nach Erbrochenem und nach Scheiße. Ein tiefer und trockener Husten hallte neun ganze Tage in der Gasse, bevor die Mutter verstummte. Dafür pfiff ihre Lunge, als sei sie von Abertausenden Pfeilchen durchlöchert worden. Die Lippen blass, grünlich, blau, schließlich schwarz und trocken wie Dörrobst, atmete sie endlich aus. Ihre Haut war übersät von blauen Flecken … Olga lächelte mit einer biblischen Genugtuung. Die Kleine auf der Trage tat ihr leid — nur kurz. Dann waren die Träger in die nächste Straße eingebogen.
Olga fiel es zunehmend schwer, ihren Platz in einer Gesellschaft zu finden, die sich so sehr verändert hatte — die so sehr festsaß in ihrem neugefundenen Glanz. Die serbischen Behörden hatten den Deutsch sprechenden Aškenazim zu verstehen gegeben, dass ihre Männer im Krieg auf der falschen Seite gekämpft hatten. Mehr als die Hälfte der Gemeinde war nach Wien gegangen; ein Dutzend war deportiert worden. Die wenigen orthodoxen jüdischen Familien hatten Zemun bereits vor dem Krieg verlassen, und diejenigen, die sich für einen Verbleib entschieden hatten, waren zu arglos, als dass Olga sich in ihre Reihen hätte aufnehmen lassen: Was hatte sie mit den Polgars oder den Binders zu tun, die sich mit Almosen die Liebe der Pravoslaven erkauften? War der Buchhändler Levi früher auch so freundlich zu den Gojim gewesen? Und Eugen Fogel, der Bäckermeister, bemerkte er nicht die Häme, die ihm hinterrücks entgegenschlug? Waren sie alle zu angepasst? Oder sah Olga überall Antisemiten?
Jene, die sie von früher kannten, witterten Selbsthass. Aber jene, die bei ihr Selbsthass witterten, sollten ihre Klatschmäuler zugenäht bekommen! Olga hatte die Hagada nicht aus Selbsthass vergraben. Sie nährte lediglich die Hoffnung auf eine Welt, in der sie sich vor niemandem für ihr Jüdischsein zu erklären brauchte. So gesehen war das unter den Dielen vergrabene Buch eine Versicherung: Es erinnerte Olga daran, eine Übereinkunft mit sich selbst geschlossen zu haben, obgleich sie den genauen Wortlaut dieser Übereinkunft vergessen hatte. Insgeheim hoffte sie vielleicht, dass Geza Ras von den Toten auferstand. Oder ein Schiff nach Palästina fand seinen Weg an die Ufer Zemuns. Dann stünden Isak und sie mit anderen Juden an Deck, ohne zurückzublicken auf diesen Notbehelf von Heimat — ohne zu winken.
Allerdings barg Olgas Eigensinn auch neuen Mut: Mit dem Auszug der Stadlers und dem Krepieren der halben Nachbarschaft hatte sie im Verborgenen ihr Grundstück um einen Ar erweitert. In ihrem Garten wuchsen Tomatenstauden, Kohlköpfe, Melanzani, Kürbisse, Karotten, Erdäpfel, und der Steckling eines Pflaumenbaums warf einen ersten dünnen Schatten gegen den Grund. Hinter einem Gatter meckerten zwei Ziegen und ein Junges. Olga hatte zugenommen. Manche Sorge in ihrem Gesicht war von einer kräftigen Farbe weggewischt worden. Der Krieg war vorbei. Sie würde sich zurechtfinden, hatte sie gedacht: auch ohne das Bildnis von Rabin Alkalaj, das mittlerweile die Schublade hütete.
Indes tönte Milivoj Krezić, ein aus der südserbischen Provinz bestellter Lehrer, vor der gesamten Klasse, dass Juden und anderes Gewürm bereits am Thron von König Petar sägten. Während seiner wöchentlichen Ansprachen starrte Lehrer Krezić Isak, der mittlerweile auf die allgemeine Schule ging, voller Abscheu an: Sein Blick war der eines tollwütigen Hundes, wenn dieser Hund winzige tote Augen gehabt hätte. Die giftigen Worte, die er spuckte, brachten seine Mundwinkel zum Schäumen und seine Ohren zum Flattern. Lehrer Krezić, das wusste Isak, gab sich einer Lächerlichkeit preis, die den Menschen zur Karikatur verhunzte. Mutter hatte ihn gewarnt, dass sein Name dieselbe Wirkung haben könnte wie ein Pilz, der die Leute verrückt mache. Umso dringlicher erschien es ihm deshalb, sich einen neuen, serbischeren Namen auszudenken, der ihn vor dem Unheil schützen würde. Aber Isak wollte keinen anderen Namen. Er dachte viel über seinen eigenen Namen nach — über dessen grässliche Eigenschaft, Flüche und Prügel auf sich zu ziehen. Dabei erkannte er, dass sein Name außerhalb der Sprache selbst ein Eigenleben führen musste. Immerhin vereinte er im Serbischen genauso viel Hass auf sich wie seinerzeit im Deutschen.
Nur Divna Jovanović gab auf Namen einen Dreck! Sie war zwei Jahre älter als Isak und, wie sie meinte, um mindestens achteinhalb Köpfe größer. Ihr dickes dunkles Haar, das den eigenen Spitzen in Wellen zufloss, verbarg ein von niedriger Stirn und Pausbacken geprägtes Mondgesicht, dessen brauner Teint manchmal, wenn Divna wütend war, einem Rot die Blöße gab, das ihre Absichten, mochten diese lauter oder böse gewesen sein, zu enttarnen drohte, was Divna, die sehr früh sehr alt Gewordene, öfters dazu veranlasste, all jene, die sie wegen ihrer Hautfarbe mit Schimpfwörtern bedachten, unverzüglich abzufrühstücken wie einen Mückenschiss! Kurz: Divna hatte gelernt, sich zu behaupten.
Für Isak, mit dem sie die hinterste Ecke des Schulhofs teilte, hatte Divna nur Bedauern übrig: Sein Serbisch war genauso faul wie seine Zähne. Die Kleidung, in der er steckte, roch erbärmlich. Er stotterte, und sein Stottern, das merkte Divna, lockte Peiniger an wie Scheiße Fliegen. Aus diesem Grund nahm sie Isak nach der Schule bei der Hand, und Isak ließ sich von Divna in ihr Versteck am Fuße der Donauhänge führen, wo er Serbisch beigebracht bekam: Das Hebräische achtlos ins Deutsche und das Deutsche mühsam ins Serbische übertragend erzählte Isak Divna jene Geschichten aus der Tora, die im Schweigen der Jahre nicht verschüttgegangen waren. Divna korrigierte jeden Fehler, den sie bei Isak heraushörte, und jeder Fehler, den Divna beging, wurde sorgfältig in Isaks Sprechen hineinverwoben. In diesem Geben und Nehmen erkannten beide ein Spiel, bei dem sie erneut Kinder sein durften. Sie verbrachten viele Nachmittage zusammen, bis erste Anzeichen von Mut Isaks Haltung geraderückten. Auch kam es vor, dass Divna Isaks Mund suchte und Isak — zunächst mit den Lippen und dann mit der Zunge — in Divnas Küssen ertrank. Dennoch verstanden beide nicht, was dieses Zittern rund um die Magengegend bedeutete. An warmen Tagen zeigten sie einander ihr Geschlecht. Die Sonne badete ihre welken Gesichter in Freundschaft und Liebe.
Dann kam der Herbst, und von einem Tag auf den nächsten war Divna verschwunden. Isak war wieder allein. Er streifte durch die Gassen wie ein Soldat auf der Suche nach seinem verlorenen Arm. Über Wochen kehrte er täglich an die Schwelle des Waisenheims zurück, in dem Divna bis zu ihrem Verschwinden gelebt hatte. Die Ordensschwester — eine farblose Person, deren Antlitz nie von Freude berührt worden schien — verhedderte sich in Ausreden, in denen Divna auf lange Reise zu ihren Verwandten in den Süden des Landes gegangen sei, ganz bestimmt! Aber zwischen Schwester Martas Worten loderte die Lüge, und als sie eines Abends in Isaks flehendem Blick den Widerschein ebendieser Lüge erkannte, erschrak sie vor sich selbst. Von da an blieb die Tür zum Waisenheim verschlossen.
Isak weinte zwei ganze Monate lang.
Olga, der das neugefundene Selbstvertrauen ihres Sohnes nicht entgangen war, wusste dessen plötzliche Trauer nicht zu deuten. Jeder Zuspruch, jede noch so kleine Geste der Beschwichtigung mündete in einer tieferen Entfremdung zwischen Mutter und Sohn. Isak hatte ihr von Divna nie erzählt. Olga hatte ihn auch nie gefragt, wo er seine Tage verbrachte. Überhaupt war sie der Meinung, dass Männer nicht weinen sollten. Was hatte sie für einen Schwächling erzogen, dachte sie, behielt jedoch den Gedanken für sich.
Isak sprach Serbisch fortan mit Divnas Einschlag.
An einem Wintermorgen im Jahr 1921 ging es auf den Straßen Zemuns geschäftiger zu als sonst. Seltsamerweise hatte in der Früh kein einziger Hahn in der Stadt gekräht, woraus in kürzester Zeit ein Gerücht gefertigt worden war. Viele meinten, aus solch einem Verhalten Böses herauslesen zu können. Immerhin war letzte Woche an der Weggabelung zu den Zemunfeldern ein Vampir gesichtet worden. Manche glaubten, dass sich im Schweigen der Hähne ein Sturm ankündigte, und andere fragten sich, ob so etwas überhaupt bewiesen werden konnte. Tatsächlich trieb der Wind einige Quellwolken vor sich her, vor denen jene, die nach oben blickten, erschauderten. Ein Nebel hatte sich über die Donau gelegt, die trotz einer leichten Brise glatt war wie ein Spiegel. Zwischen den Rohren eines Schilfwäldchens schwammen Dutzende toter Fische.
An jenem Morgen war Olga früh zum Markt aufgebrochen, von dem sie erst zu Mittag heimkehren würde. Isak schlief noch — da zwang ein saurer Gestank seine Nase in die Armbeuge. Durch die müden halbgeöffneten Lider bemerkte er die Umrisse einer Gestalt, die er für einen Spuk seines bereits zu Bildschnipseln zerfallenen Traumes hielt. Aber der Mann, der vor seinem Bett stand, hatte die Haustür offen gelassen, und die Kälte ließ sich kein zweites Mal bitten: Isak schnellte hoch! Dabei stieß er einen Schrei aus, den der andere sofort nachahmte, indem er seine Hände hob und theatralisch kreischte. Der Fremde wirkte vergnügt, aber wahnsinnig. Er schien in der Stube nach etwas Bestimmtem zu suchen, und als er das, wonach er suchte, nicht fand, äffte er noch einmal Isak nach, der ihn mit großen Augen anstierte. Der Mann ging hinüber zum Tisch, auf dem zwei Gläser standen. Er nahm eines davon in die Hand und hielt es gegen das durchs Fenster einfallende Sonnenlicht. Bevor er das Glas jedoch auf die Dielen fallen ließ, gab er nickend Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hatte. Er schüttelte sich und lachte, ohne zu lächeln — wie einer, der einfach keine Ruhe fand. Auf der Soldatenuniform, die er an seinem rachitisch verformten Körper trug, prangten, von den Knien bis zu den Schultern, Fettflecken wie ehrlose Abzeichen. In seinem Gesicht wütete ein schwarzer Vollbart, hinter dem sich drei, möglicherweise auch vier Zähne versteckten.
Ein Geräusch drang von draußen herein. Der Mann horchte auf, was Isak ebenfalls dazu anhielt, aufzuhorchen: Das Klacken eines Wagens im Wechsel mit dem Klacken der Hufe, die selbigen zogen, war zu hören. Isak bemerkte, dass das Ohr, das der Fremde den Klängen entgegenhielt, ein Stumpen war; eine breite und fleischige Narbe zog sich von der Stelle, wo das Ohr hätte sein sollen, bis zu seinem Hinterkopf. Der Gestank, den er verströmte, war so heftig, dass Isak würgen musste. Nachdem sich das Klacken entfernt hatte, ging der Mann einmal um den Tisch und setzte sich auf den Stuhl neben der Werkbank. Isak, der sich die Nase zuhielt, staunte, mit welcher Selbstverständlichkeit der Fremde durch das Zimmer schritt. Unentschlossen, ob er etwas sagen sollte, blieb er stumm im Bett sitzen. Er spürte, dass von dem Mann keine Gefahr ausging. Sogar ein grauenvolles Lächeln zeigte sich hinter seinem Bart.
Ein Windzug knallte die Haustür zu. Die Wände schattierten sich grau. Die Wohnstube füllte sich langsam und gleichmäßig mit Stille, und an jenem Punkt, an dem sie peinlich zu werden drohte, begann der Mann zu lamentieren: »… zwei volle Säcke Kartoffeln, ja, du weißt, wie es sich anfühlt … da brüllt jemand, ›Ist eure letzte Dusche in Wochen, ihr Hundesöhne‹ … ich schrubbe, bis mir die Haut rot wird … Feldstiefel, ein Hemd, Koppel, zwei Paar Socken … die Serben und die Mohammedaner behandeln sie wie die Hunde, da siehst du, wie die Hunde … die Juden auch … auch die Juden haben sie wie Hunde behandelt, aber können zumindest Deutsch, die Juden … einer hat zu mir gesagt, in der Uniform sind wir alle gleich … Jude, na und? Sobald wir die Uniform anhaben, sind wir … zwei Gatkes, Pantalone, Verbandszeug, Brotsack, ein letztes Foto und Abmarsch, durch eine Tür … diese Scheiß… Scheißtür … durch die Tür, Hunde … die Tür … durch ein Gittertor, hinter uns die Kaserne! Ich weiß nicht, Miloš





























