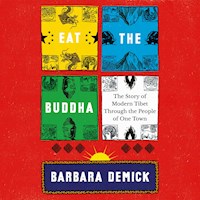16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die preisgekrönte Journalistin und China-Kennerin Barbara Demick erzählt von Tibets Schicksal unter der chinesischen Herrschaft. Sie gibt ergreifende wie verstörende Einblicke in das Alltagsleben von acht Menschen, deren Leben die Geschichte eines ganzen Volkes und dessen Wunsch nach Freiheit widerspiegeln. Sich selbst verbrennen oder nicht? Der Junge hadert. Sein bester Freund hat es bereits getan – aus Protest gegen die chinesische Regierung, die Tibetern jeglichen gesellschaftlichen Aufstieg verwehrt, ihre Freiheit beschneidet und ihre Kultur zerstört. Barbara Demick schildert in ihrer bewegenden Reportage das Schicksal von acht Menschen, die in der ost-tibetischen Stadt Ngaba leben – einer Stadt, die als Zelle des Widerstands gilt und nicht zuletzt wegen der vielen Selbstverbrennungen besonders unter chinesischen Repressalien leidet. Die berührenden Lebensgeschichten geben tiefe Einblicke in den tibetischen Alltag abseits der touristischen Sehnsuchtsorte. Es ist ein Alltag, der geprägt ist vom Kampf zweier Kulturen, vom Ringen Tibets um politische Selbstbestimmung und kulturelle Identität, von Unterdrückung und Gewalt, von verborgenem Leid und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Eine eindrückliche Hommage an die Menschen in Tibet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Ähnliche
Barbara Demick
Buddhas vergessene Kinder
Geschichten aus einer tibetischen Stadt
Aus dem amerikanischen Englisch von Barbara Steckhan und Karola Bartsch
Knaur e-books
Über dieses Buch
»Eigentlich aber konnte Dongtuk es immer noch nicht fassen. Nach allem, was Tapey geschehen war - der Mönch, der seine Selbstanzündung zwei Jahre zuvor überlebt hatte, und nun als verstümmelter Invalide in einem chinesischen Gefängniskrankenhaus dahinvegetierte und gelegentlich zu Propagandazwecken im chinesischen Staatsfernsehen vorgezeigt wurde -, hatte er eine solche Tat nicht mehr erwartet. Wer war so dumm, es noch einmal zu versuchen? Oder - wer hatte solchen Mut?«
Aus Protest gegen die chinesische Regierung wird Tibet Ende der 1990er-Jahre von einer Welle der Selbstverbrennungen erschüttert. Doch die Unterdrückung Tibets durch die chinesische Regierung hat eine lange Geschichte …
Barbara Demick schildert sie anhand der Schicksale von Menschen, die in Ngaba, einer osttibetischen Stadt in der chinesischen Provinz Sichuan, leben. Sie erzählt von Dongtuk, dem zögerlichen Jungen, der letztlich vor den chinesischen Repressalien ins Exil flieht; von Dhukar, einem jungen Mädchen, das Zeugin davon wird, wie chinesische Soldaten auf tibetische Demonstranten schießen; oder von Prinzessin Gonpo, die als Vierzehnjährige zur Arbeiterin umerzogen wurde, nachdem ihr Vater im chinesischen Exil Selbstmord begangen hatte. Acht berührende Lebensgeschichten, die programmatisch für das Leiden eines ganzen Volkes stehen und tiefe Einblicke in den kaum bekannten tibetischen Alltag gewähren.
Inhaltsübersicht
Im Gedenken an
Lobsang Chokta Trotsik
(1981–2015)
Einleitung
Das Stadtzentrum von Ngaba, 2014.
Über Jahrhunderte hinweg wurde Tibet als ein Einsiedlerkönigreich bezeichnet, als ein Land, dessen Wunder von den gewaltigen Bergketten des Himalaja verborgen wurden, das aber zugleich auch abgeschirmt war durch eine theokratische Regierung, die sich auf eine Erbfolge von reinkarnierten Dalai Lamas gründete. In der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts findet man zahlreiche Beispiele, wie Fremde, getarnt als Mönch oder Eremit, heimlich nach Tibet vorzudringen versuchten.
Gegenwärtig wird uns der Zugang nicht durch die Tibeter versperrt, sondern durch die Kommunistische Partei Chinas. Die Volksrepublik China beherrscht Tibet seit 1950 und zeigt sich als unerbitterlicher Torwächter, wenn ausländische Besucher um Einlass bitten. In Lhasa gibt es einen modernen Flughafen mit Filialen von Burger King und Geldautomaten, und aus dem einstmals religiösen Zentrum ist eine auf Vergnügungen ausgerichtete Touristenfalle für fast ausschließlich chinesische Reisende geworden. Ausländer brauchen eine spezielle Erlaubnis, um in die Region zu gelangen, die China »Autonomes Gebiet Tibet« nennt. Und diese Genehmigung erhalten Akademiker, Diplomaten, Journalisten und alle anderen, die vielleicht unangenehme Fragen stellen könnten, nur höchst selten. Die östlichen Ausläufer des Tibetischen Hochlands, und damit die Provinzen Sichuan, Qinghai, Gansu und Yunnan, stehen theoretisch hingegen allen Reisenden mit einem gültigen Visum für die Volksrepublik China offen, doch Ausländer erleben es immer wieder, dass sie an Kontrollpunkten abgewiesen werden und ihnen die Buchung eines Hotelzimmers verweigert wird.
Als Korrespondentin der Los Angeles Times kam ich 2007, also ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen, nach Peking. Während ihrer letztlich erfolgreichen Bewerbung um die Austragung der Spiele machte die chinesische Regierung eine Fülle von Versprechungen, die Menschenrechtslage zu verbessern und China für Journalisten zu öffnen. Vor Ort sah es allerdings so aus, dass Reportern große Landesteile versperrt blieben. Mit am schwierigsten zu erreichen war Ngaba.
Um Ngaba ranken sich viele Mythen. Wenn es überhaupt auf englischsprachigen Landkarten verzeichnet ist, dann mit dem chinesischen Namen »Aba« (was ausgesprochen wird wie die schwedische Popgruppe). Die tibetische Bezeichnung dieser Stadt stellt Nichttibeter meist vor Probleme, da sie für sie wie Nabba oder auch Nah-wa klingen kann, je nach verwendetem tibetischem Dialekt.
Seit den 1930er-Jahren ist Ngaba der Kommunistischen Partei ein Dorn im Auge. Etwa alle zehn Jahre entwickeln sich in der Stadt regierungsfeindliche Unruhen, die unweigerlich eine Spur von Tod und Zerstörung nach sich ziehen. Da sich die Tibeter den Lehren von Tenzin Gyatso, dem 14. Dalai Lama, verpflichtet fühlen, der für sein Eintreten für Gewaltlosigkeit mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, sind in jüngerer Zeit die meisten der Todesopfer auf tibetischer Seite zu beklagen. Während der Proteste des Jahres 2008 eröffneten chinesische Soldaten in Ngaba das Feuer auf Demonstranten. Mehrere Dutzend Menschen kamen ums Leben. 2009 übergoss sich in der Hauptstraße ein buddhistischer Mönch mit Benzin, und nachdem er lautstark die Rückkehr des Dalai Lama aus seinem indischen Exil gefordert hatte, setzte er sich in Flammen. Dies zog eine ganze Woge von Selbstverbrennungen nach sich. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben 156 Tibeter diese Form des politischen Protests gewählt, nahezu ein Drittel davon in Ngaba und Umgebung. Der jüngste Fall ereignete sich im November 2019. Diese Todesfälle bringen Peking in große Bedrängnis, denn sie widerlegen die Behauptung, dass die Tibeter unter chinesischer Herrschaft glücklich und zufrieden sind.
Nach den ersten Selbstverbrennungen verstärkten die Behörden ihre Bemühungen, Journalisten an der Reise nach Ngaba zu hindern. Auf den Ausfallstraßen der Stadt wurden neue Kontrollpunkte errichtet, mit Panzersperren und Barrikaden, bemannt von Mitgliedern paramilitärischer Truppen, die in jedes Auto spähen, um sicherzustellen, dass sich keine Ausländer einschleichen. Einige wagemutige Journalisten kauerten sich auf dem Rücksitz zusammen und hielten die Kamera in die Höhe, um durch das Fenster Aufnahmen zu schießen. Mit unterschiedlichem Erfolg.
Journalisten lassen sich nicht gern etwas vorschreiben. Und wenn man uns von einem bestimmten Ort fernhalten will, werden wir wohl alles daransetzen, um dorthin zu gelangen. In meinem letzten Buch beschäftigte ich mich mit Nordkorea, was mich als Thema auch deshalb so gereizt hatte, weil das Land nur ganz selten westliche Besucher empfängt. Nachdem ich beschlossen hatte, das Leben in einer tibetischen Stadt aufzuzeichnen, fasste ich Ngaba ins Auge. Ich wollte wissen, weshalb die chinesische Regierung diesen Ort so beharrlich vor Reisenden abschirmt. Und warum waren so viele seiner Bewohner bereit, ihre Körper auf eine der schrecklichsten Weisen zu zerstören, die man sich nur vorstellen kann?
Darüber hinaus aber interessierte mich an Tibet das Gleiche wie andere Menschen aus dem westlichen Kulturkreis auch. Ich bin zwar keine Buddhistin, die in fernöstlichen Religionen Trost sucht (und in westlichen letztlich auch nicht), doch in unserer zunehmend gleichförmigen Welt erschien mir Tibet als ein Land, das dank seiner Spiritualität mit einer überaus reichen Kultur, Philosophie und Literatur hervorsticht – ein Umstand, den ich schätzte. Da ich mich intensiv mit chinesischer Geschichte befasst hatte, kannte ich die wichtigsten Fakten der chinesischen Invasion und der Flucht des Dalai Lama. Doch über die realen Tibeter wusste ich wenig – von den Klischees hohlwangiger spiritueller Männer in Höhlen und fröhlicher Nomaden, die Gebetsperlen durch die Finger gleiten lassen, einmal abgesehen. Wie ist es, im 21. Jahrhundert als Tibeter an der Grenze zum modernen China zu leben?
Die neuen Technologien haben die Welt vieler ihrer Rätsel beraubt. Google Earth macht es mithilfe einiger weniger Klicks möglich, in die unzugänglichsten Winkel der Welt vorzudringen. Doch Satellitenbilder können nicht erklären, was dort geschieht. Ich musste Ngaba mit eigenen Augen sehen.
Hier noch ein paar Worte zur Geografie: Nur eine Hälfte des Tibetischen Hochlands gehört aus Gründen, die ich später im Text erläutern werde, zu der von der chinesischen Regierung als Autonomes Gebiet Tibet bezeichneten Region. Die Mehrheit der Tibeter lebt jedoch in Teilen der Provinzen Sichuan, Qinghai, Gansu und Yunnan, die zwar nicht zum »offiziellen Tibet« gehören, aber trotzdem tibetisch sind. Zudem haben sich diese östlichen Ausläufer der Hochebene in den letzten Jahrzehnten zum Kernland Tibets entwickelt und einen überproportional hohen Anteil an berühmten tibetischen Musikern, Filmregisseuren, Autoren, Aktivisten und Lamas – darunter den gegenwärtigen Dalai Lama – hervorgebracht.
Ngaba liegt in der Provinz Sichuan, in etwa an der Schnittstelle zwischen dem Tibetischen Hochland und China, wodurch es gewissermaßen zu einer Grenzstadt wird. Der Weg dorthin führt gewöhnlich durch Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, die eine weitere von Chinas Megacitys ist.
Lässt man die geschniegelten Einkaufszentren mit ihren Gucci- und Louis-Vuitton-Filialen und die Betonhochhäuser mit ihren Wohnwaben hinter sich, fährt man zunächst ein Stück auf der Ringstraße und biegt dann ab Richtung Norden, in die Berge. In Luftlinie liegt Ngaba lediglich 330 Kilometer entfernt, doch die Fahrt durch den gemäßigten Regenwald des Qionglai-Gebirges, dem natürlichen Lebensraum von Chinas geliebten Pandas, dauert einen ganzen Tag. Enge Serpentinen, die nass sind von den beständig von den Felsen tropfenden Rinnsalen, führen unentwegt bergauf. Hat man die Hochebene erreicht, treten die Bäume zurück, und die Landschaft öffnet sich. Dies ereignet sich so unvermittelt, dass man das Gefühl hat, ein Tor zu durchschreiten und in eine neue Dimension einzutreten.
In alle vier Himmelsrichtungen erstreckt sich ein knotiger grüner Teppich und markiert die Konturen der Hügel und Hänge. Auf den Hochglanzfotos der Tibet-Bildbände ist der Himmel stets strahlend blau, aber während meiner Besuche, die meist in den Frühling fielen, waren die Wolken dick wie Wattebäusche und hingen so tief, dass sie die Berggipfel umhüllten. Die Dörfer an der Straße sind Ansammlungen flacher Lehmhäuser, und zottelige Yaks und Schafe ignorieren die wenigen vorbeirollenden Autos. Ausgesuchte Stellen sind für Opfer an die Gottheiten vorgesehen, die, wie die Tibeter glauben, alle Anhöhen und Bergpässe ihres Landes bewohnen. Auf den Kämmen flattern zu blassen Pastellfarben ausgeblichene Gebetsfahnen.
Ngaba liegt rund 3300 Meter über dem Meeresspiegel, was einem wegen der flachen Landschaft nicht unbedingt ins Auge fällt. Das Zentrum besteht lediglich aus einer schmalen, städtisch angehauchten Schneise durch das endlose Grasland. Die Nationalstraße 302 führt geradewegs durch den Ort, und wenn man sie entlangfährt, hat man ihn innerhalb von einer Viertelstunde von einem Ende zum anderen durchquert. 2013 wurde die erste Verkehrsampel aufgestellt. In dieser ländlichen Gegend ist es nichts Ungewöhnliches, Pferde und Reiter zu sehen, obwohl man heutzutage meist per Motorrad reist oder die Motorradrikscha nimmt. Ein Großteil der Älteren und auch einige jüngere Leute tragen die Chuba, das an der Taille mit einer Schärpe gebundene tibetische Gewand, viele aber wählen den Kompromiss zwischen Tradition und Konfektionsware und ergänzen sie mit einem Cowboyhut und flauschigen Schaffell- oder Daunenjacken. Die Frauen tragen oft lange Röcke.
Wie Buchstützen stehen an Ngabas beiden Ortsausgängen zwei buddhistische Klöster mit ihren im Sonnenlicht funkelnden goldbeschlagenen Dächern. Ihre Wände sind in leuchtendem Karmesinrot und Dottergelb gestrichen, den allein Klöstern vorbehaltenen Farben, durch die sich diese Gebäude deutlich von der eintönigen Landschaft abheben. Das Kloster Se steht am ersten Kontrollpunkt der Stadt, wenn man von Osten kommt, und im Westen befindet sich das Kloster Kirti, das größere der beiden, das oft mit den Selbstverbrennungen in Zusammenhang gebracht wird.
In der Straße dazwischen zieht sich eine Reihe niedriger Gebäude mit gefliesten Außenwänden dahin, die aussehen, als hätte man Badezimmer auf links gedreht. Meist befindet sich im Erdgeschoss ein Laden, und durch die offen stehenden Metalltüren kann man die unansehnliche Sammlung seines Sortiments gut erkennen: Autoteile, Eimer, Schrubber, Plastikschemel, billige Turnschuhe, landwirtschaftliche Geräte.
Die Fortschrittshörigkeit Chinas hat Ngaba den gleichen Stempel aufgedrückt wie unzähligen anderen Städten des Landes auch. Die Schilder werben für die staatseigene Volksbank, den staatseigenen Benzinkonzern und das staatseigene Telekommunikationsunternehmen. Ngaba ist eine Kreisstadt (und hat rund 15000 Einwohner, während der Landkreis ungefähr 73000 zählt) mit dem üblichen Komplex fader Verwaltungsgebäude, einem Krankenhaus, einer großen Mittelschule, den Stützpunkten der Polizei und der Sicherheitskräfte – alle auffällig mit roten Fahnen geschmückt. Nichts unterscheidet Ngaba von sonstigen Kreisstädten, außer der höheren Zahl von Streifenwagen und Militärfahrzeugen. Vor dem einzigen Warenhaus der Stadt steht oft ein gepanzerter Mannschaftswagen. Überwachungskameras zeichnen die Nummernschilder der Autos auf, die in die Stadt hineinfahren und die sie wieder verlassen. Immer wieder rollen mit grünen Planen bespannte Lkws des Militärs die Hauptstraße entlang, auf dem Weg von oder zu ihrem Stützpunkt jenseits des Klosters Kirti. Bei einer Zählung stellte man fest, dass in Ngaba ungefähr 50000 Sicherheitskräfte stationiert sind, etwa das Fünffache dessen, was für einen Ort dieser Größe normal ist.
Aufgrund der schwer zugänglichen Lage haben die üblichen chinesischen Ladenketten und Schnellrestaurants noch nicht in die Stadt gefunden; allerdings gibt es zahllose kleine chinesische Garküchen mit Feuertopf und Teigtaschen im Angebot. Als sich vor einigen Jahren die Beschwerden häuften, der chinesische Einfluss würde in Ngaba zu deutlich zutage treten, verfügte die Lokalverwaltung, die Mauern der Gebäude an der Hauptstraße mit tibetischen Motiven zu bemalen. Nun verbreiten Wandbilder von Lotusblumen und Muschelhörnern, Goldfischen und Ehrenschirmen eine gewollte Fröhlichkeit. Hinzu kommen die roten, mit buddhistischen Symbolen verzierten Metallfensterläden. Chinesischen Ladeninhabern wurde empfohlen, ihre Werbung auch in tibetischen Schriftzeichen auf ihren Schildern anzubringen, was dann oft eine falsche Schreibweise zur Folge hatte, wie mir Tibeter sagten.
In Anbetracht der eigenwilligen Beispiele, die ich für die englische Sprache fand, konnte ich mir das gut vorstellen. Übersetzt stand dort etwa:
Ngabas Nächstenliebe und Reparaturwerkstatt
Glänzende Dekoration
Während meines siebenjährigen Aufenthalts in China entwickelte ich eine gewisse Kunstfertigkeit in meinem Projekt, die Tibetische Hochebene zu bereisen, ohne aufzufallen. Zwar griff ich nicht zu einer albernen Verkleidung wie die Entdecker des 19. Jahrhunderts, doch ich kaufte mir einen Hut mit schlaffer Krempe im Tupfenmuster und trug eine der in China zum Schutz vor Luftverschmutzung verbreiteten Gesichtsmasken. Das ergänzte ich mit einem weiten Staubmantel und Schnürschuhen. Und da es häufig regnete, konnte ich mich zusätzlich hinter meinem Regenschirm verstecken.
Insgesamt gelangen mir drei Besuche von unterschiedlicher Dauer ins Zentrum von Ngaba. Ich sprach aber auch mit aus Ngaba stammenden Menschen in anderen, weniger beaufsichtigten Regionen des Hochlands. Viele einstige Bewohner der Stadt, die inzwischen in den tibetischen Exilgemeinden in Nepal und Indien leben, teilten großzügig mit mir ihre Zeit und ihre Erinnerungen. Sogar in Kathmandu stieß ich auf eine Organisation von Bürgern aus Ngaba.
Bis zur Gründung der Kommunistischen Partei Chinas wurde Ngaba über Jahrhunderte hinweg von einem lokalen Geschlecht von Königinnen und Königen regiert, und ihre Nachfahren gaben mir Einblick in ihre ungeheuer reichen Kenntnisse aus der Vergangenheit der Region und ihrer Dynastie. Eine chinesische Wissenschaftlerin stellte mir freundlicherweise Übersetzungen offizieller Dokumente der chinesischen Regierung und von Erinnerungen an Ngaba zur Verfügung. Außerdem habe ich Verwandte, Freunde und Nachbarn der im Buch vorgestellten Personen interviewt, nicht nur, um deren Schilderungen zu untermauern, sondern um auch der Kritik von chinesischer Seite zuvorzukommen, meine Darstellung der Schicksale auf diesen Seiten sei übertrieben.
Alle Menschen, Ereignisse, Dialoge und Abläufe entsprechen der Realität. Es sind keine erfundenen Personen hinzugefügt worden. Allerdings wurden gelegentlich die Namen geändert, um jene, die sich hier ehrlich äußern, vor negativen Konsequenzen zu schützen.
Karten
Teil I
1958–1976
1
Die letzte Prinzessin
Die Königsfamilie von Ngaba, 1957. Gonpo steht vorn in der Mitte, direkt vor ihrem Vater, dem König.
Noch ehe Gonpo etwas sah, roch sie den Rauch. Mit ihren sieben Jahren kannte sie sich in der Tagespolitik nicht sonderlich aus, doch sie wurde stutzig, weil sie schon seit Wochen das Gefühl hatte, dass sich etwas zusammenbraute. Mit ihrer Mutter, Schwester und Tante sowie einem ganzen Konvoi von Bediensteten befand sie sich auf der Heimreise von den Bestattungsritualen für ihren Onkel. Als sie zu seinem Dorf aufbrachen, war es noch Sommer gewesen, aber nach den 49 Tagen – bei Buddhisten die traditionelle Trauerzeit zwischen Tod und Wiedergeburt – hatte der Herbst eingesetzt. In den kühlen Abendstunden hörte man bereits das Wispern des Schnees, der sich bald von den Berggipfeln herabsenken würde. Gonpo, die ein dickes, pelzgefüttertes Gewand aus Schaffell trug, bebte vor Kälte, weil ihr der Wind von unten in die Kleidung fuhr. Sie alle ritten ihr eigenes Pferd; wie die meisten Tibeter hatte auch Gonpo schon in früher Kindheit gut reiten gelernt. Sie folgten dem Verlauf einer erst kürzlich von chinesischen Militäringenieuren angelegten, aber noch ungepflasterten Straße, westwärts der untergehenden Sonne entgegen. An einem Wasserlauf, der in nördlicher Richtung zu Gonpos Zuhause führte, zweigte ihre Route ab, und als sie ein hohes Dickicht hinter sich gelassen hatten, konnte Gonpo auch sehen, wo der Rauch herkam. Hoch zu Ross hatte sie einen guten Blick auf ein halbes Dutzend Lagerfeuer und ebenso viele Zelte. Als sie näher kamen, erkannte sie, dass es sich nicht um die bei Tibetern üblichen Zelte aus schwarzem Yakhaar handelte, sondern um die kleinen weißen der Volksbefreiungsarmee.
Zu jener Zeit, 1958, neun Jahre nachdem Mao Tse-tung die Volksrepublik China ausgerufen hatte, war es keine Seltenheit, am Straßenrand auf ein Lager der Roten Armee zu stoßen. Dieses aber stand auf dem Anwesen ihrer Familie, und das verwunderte schon. Auf dem letzten Abschnitt des Zweitagesritts hatte Gonpo mit dem Schlaf zu kämpfen gehabt, doch nun war sie, neugierig und auch ein bisschen ängstlich, mit einem Schlag hellwach. Als eine der Ersten glitt sie vom Pferd, ohne auf die Hilfe der Bediensteten zu warten.
Während sie zum Eingang lief, fragte sie sich, warum niemand herauskam, um die Heimkehrenden zu begrüßen. Sie klopfte laut an das hölzerne Tor aus groben, von doppelter Mannshöhe großen Planken mit seinem massiven Sturz. Da niemand antwortete, rief sie aus voller Kehle:
»He! Wo seid ihr alle?«
Ihre Mutter war ihr gefolgt. Auch sie rief.
Schließlich kam Gonpos Kinderfrau herbei und entriegelte das Tor. Anstelle einer herzlichen Begrüßung beugte sie sich über das Mädchen hinweg, als wäre es nicht da, und flüsterte Gonpos Mutter etwas ins Ohr. Gonpo konnte zwar nichts verstehen, doch die Reaktion der Mutter ließ nichts Gutes vermuten. In letzter Zeit hatte sie ihre Mutter oft weinen sehen; der kürzlich verstorbene Onkel war ihr Lieblingsbruder gewesen, sie musste wohl immer noch traurig sein. Jedenfalls wollte Gonpo das glauben, obwohl alle Zeichen auf etwas anderes hindeuteten: der Rauch, die Zelte, das steinerne Gesicht ihrer Kinderfrau. Instinktiv wurde ihr klar, dass dies der Anfang vom Ende der Welt war, wie sie sie kannte.
Gonpo war Prinzessin von Geburt. Ihr Vater Palgon Rapten Tinley,[1] was in etwa »der ehrwürdige unerschütterliche Erleuchtete« bedeutet, war der 14. Regent einer Ahnenreihe im Königreich der Mei. Dessen Hauptstadt war das in der heutigen chinesischen Provinz Sichuan gelegene Ngaba. Zur Zeit von Gonpos Geburt im Jahr 1950 war Ngaba ein unauffälliger Marktflecken, in den Händler kamen, um Salz und Tee feilzubieten, und Viehhirten, um Butter, Häute und Wolle zu verkaufen. Die gesamte Region war wie ein Flickenteppich aufgeteilt in eine Vielzahl kleiner Lehenswesen, geführt von Fürsten und Königen, Prinzen, Khans und Warlords. Von den Chinesen wurden heimische Regenten wie Gonpos Vater als Tusi bezeichnet, was meist mit »Grundbesitzer« übersetzt wird, die Tibeter aber nannten ihn Gyalpo oder »König«. Englischsprachige Chronisten erwähnen ihn zu Beginn des 20. Jahrhunderts ebenfalls als Mitglied eines Königshauses. Dies war wohl auch der gesellschaftliche Rang, in dem Gonpo ihre Familie sah.
Als Kind trug Gonpo bodenlange, Chuba genannte Gewänder, die an der Taille gerafft waren. Da sich fast alle Tibeter so kleideten, ließ sich ihre gesellschaftliche Stellung nur anhand der Qualität erkennen. Gonpos Kleider waren mit Otterfell gefüttert, und ihren Hals schmückten Perlenketten mit Steinen groß wie Weintrauben – Koralle, Bernstein, und, am wichtigsten von allen, der gestreifte Dzi, ein tibetischer Achat, der sie vor dem bösen Blick schützen sollte. Ansonsten war Gonpo keine sonderlich mädchenhafte Prinzessin. Sie war eher pfiffig als hübsch; mit ihren Lücken zwischen den Zähnen und der aufwärtsstrebenden Nase sah sie aus wie ein kleiner frecher Junge. Wie viele Mädchen in Ngaba hatte auch sie die Haare kurz geschoren – ein Zeichen, dass sie noch nicht im heiratsfähigen Alter war. Ihre Mutter und die anderen erwachsenen Frauen der Königsfamilie trugen von Quasten und Korallenschnüren gehaltene Zöpfe, die so kunstvoll waren, dass die Bediensteten manchmal zwei Tage zum Flechten brauchten.
Die Familie bewohnte ein imposantes Herrenhaus an der Grenze zum Stadtzentrum am östlichen Rand Ngabas. Es war eigentlich ein Palast, glich aber mit seinen massiven und soliden Wänden mehr einer Festung. Wie in Tibet üblich war es aus Stampflehm gebaut und in seiner graubraunen Farbe kaum von der Landschaft zu unterscheiden, wenn in der Trockenzeit auf der Hochebene kein Gras mehr wuchs. In Bodenhöhe waren die Wände bis zu drei Meter dick und verjüngten sich im Innern zum Dach hin, damit sie im Fall eines Erdbebens besser standhielten. Die langen schmalen Fenster hatten ebenfalls Trapezform und waren von hölzernem Gitterwerk eingefasst. Die Wände zierte kein Schmuck, abgesehen von zwei herausstehenden offenen Vorbauten auf der West- und auf der Ostseite des Hauses. Sie sahen zwar elegant aus, beherbergten aber die Toiletten. Was der Mensch ausschied, fiel nach unten auf den Boden, wo es, mit Asche vermischt, auf den Feldern als Dünger ausgebracht wurde.
Was dem Haus an Modernität fehlte, glich es durch seine Größe aus. Es maß 7500 Quadratmeter und hatte mehr als 850 Räume: von Verliesen, Ställen und Lagern im Erdgeschoss bis hin zu immer feineren und für repräsentative Zwecke vorgesehenen Räumen weiter oben. Es gab Schlafzimmer für die Kinder und ihre Mutter; ferner für das Gefolge des Königs wie Sekretäre und Beamte. In den höheren Geschossen waren die Räume mit Holz vertäfelt, um die Außenwände aus Lehm zu verbergen.
Das oberste Stockwerk war den spirituellen Ritualen vorbehalten und entsprechend gestaltet. Fresken und die Thangka genannten, in satten Farben gehaltenen tibetischen Wandbehänge erweckten die Räume zum Leben. Da buddhistische Erleuchtungswesen immer wieder reinkarnieren, findet man sie in jeglicher Form, männlich oder weiblich, schlicht oder reich geschmückt. Es gab den Buddha der Vergangenheit und der Zukunft, dazu zahlreiche Bodhisattvas, erleuchtete Wesen, die auf den Eintritt ins Nirwana verzichten, um zum Nutzen anderer wiedergeboren zu werden. Am wertvollsten war die im Zentrum des Gebetsraums stehende Statue von Avalokiteshvara, auf Tibetisch Chenrezig, der Bodhisattva des Mitgefühls und Schutzpatron der Tibeter, die dem König vom 14. Dalai Lama geschenkt worden war.
Der König, ein begeisterter Bibliophiler, besaß eine riesige Sammlung von Büchern und Schriften. Einige waren mit Gold oder Silber gedruckt. Im Stockwerk unter der Bibliothek befand sich die Eingangshalle, groß genug, um Tausende Mönche aufzunehmen. An buddhistischen Feiertagen war der Palast vom Klang der Gebete, Zimbeln und Schneckenhörner erfüllt – und von dem unübersetzbaren Mantra der Tibeter, mit dem sie ihren Schutzpatron, den Bodhisattva des Mitgefühls, anrufen:
Om mani padme hum
Auch das Alltagsleben im Palast war an den rituellen Praktiken des Buddhismus ausgerichtet. Der König begann den Tag mit mehrfachen Niederwerfungen vor einem Schrein. Aufrecht stehend faltete er die Hände über dem Kopf zum Gebet und ließ sich dann in einer einzigen Bewegung nach unten gleiten, bis sein Körper lang ausgestreckt auf dem Boden lag, um sogleich wieder aufzustehen. Mit diesem Ritual bewahrte er sich eine schlanke Figur und einen klaren Geist.
Bei all dem ließ sich nicht sagen, was auf Kultur und Gepflogenheiten beruhte und was auf Religion. Wenn Gonpo bei einer Lüge ertappt wurde, trug man ihr wiederholte Umschreitungen eines nahe gelegenen Klosters auf, wo sie unzählige Gebetsmühlen drehen musste – große, aus Metall, Holz und Leder gefertigte Walzen in vertikaler Anordnung, die mit dem Text von Gebeten beschriftet waren. Sobald man sie an ihren Spindeln in Schwung setzte, war es, als würde man das Gebet laut aufsagen. Ein Kind musste dafür viel Kraft aufwenden, und die Strafe zwang Gonpo, sich mit ihrem Fehler auseinanderzusetzen.
Die Kinder – Gonpo und ihre sechs Jahre ältere Schwester – bewohnten mit ihrer Mutter einen separaten Flügel des Hauses. Nach dem Aufwachen brachte die Mutter die Mädchen zu den Gemächern des Vaters, damit sie ihm einen guten Morgen wünschten. Am Abend wiederholten sie den Besuch und sagten ihm Gute Nacht. Die Mahlzeiten nahm die Familie meist gemeinsam ein, wobei der Vater streng auf gute Manieren achtete. Vor dem Essen wurde gebetet. Die Kinder warteten, bis die Erwachsenen fertig waren. Der Vater ließ kein einziges Reiskorn auf seinem Teller übrig, denn er wollte seinen Töchtern vor Augen führen, dass die Bauern schwer arbeiten mussten, um für ihr Essen zu sorgen. Auf sein Beharren hin bekamen die Bediensteten die gleichen Portionen wie er, obwohl sie sie oft erst essen konnten, wenn sie schon kalt waren. Penibel, wie er war, achtete er darauf, dass seine Töchter trotz ihrer königlichen Geburt nicht verwöhnt wurden. Ungeachtet der vielen Dienstboten im Haus machte er sein Bett selbst.
Mit der festen Überzeugung, dass Mädchen die gleiche Bildung erhalten sollten wie Jungen, war er seiner Zeit voraus. Und da er keinen Sohn hatte, nahm er an, dass eine seiner Töchter ihm einmal als Regentin folgen würde. Gonpo hatte einen Lehrer, der jeden Morgen ins Haus kam und ihr das tibetische Alphabet beibrachte. Wie traditionell üblich, wurde Asche auf eine Schiefertafel gestreut, und Gonpo bekam einen Federkiel, um die Buchstaben zu ziehen. Die an nordindische Schriften angelehnte tibetische Schrift ist ausgesprochen schwierig und voller Konsonanten, die unter- oder übereinander gezeichnet werden. Gonpo verbrachte Stunden vor den verschlungenen Buchstaben, bis ihre Augen glasig wurden.
Sie war ein rastloses Mädchen, das sich mit den Einschränkungen des Palastlebens nicht abfinden konnte. Als sie klein war, band ihr die Kinderfrau eine Glocke um den Bauch, damit sie gewarnt war, wenn sie ausreißen wollte. Es dauerte lange, bis Gonpo die Abgeschiedenheit in dieser flüchtigen Phase ihrer frühen Kindheit zu würdigen wusste. Gleichaltrige Spielgefährten hatte sie nicht. Ihre ältere Schwester, eine eifrige Schülerin, die viel Zeit im Haus verbrachte, hatte kein Interesse, sich mit Gonpo zusammenzutun, wenn sie auf Streiche aus war. Am glücklichsten war Gonpo, wenn Mönche zu Besuch kamen, denn manche von ihnen waren genauso jung wie sie. Einer, den sie besonders gern mochte, galt als Tulku, als Wiedergeburt eines Lamas. Die Erwachsenen behandelten ihn mit großem Respekt, Gonpo aber zupfte ihn am Ärmel und forderte ihn auf, mit ihr in der Eingangshalle Fußball zu spielen. Außerdem stahl sich Gonpo oft aus dem Palast, um sich den Kindern in der Nachbarschaft anzuschließen. Einer der Jungen erinnerte sich später, dass Gonpo darauf bestand, ihnen bei der Hausarbeit zu helfen. Und weil es ihr unangenehm war, mehr zu besitzen als andere Kinder, versuchte sie, Kleidungsstücke zu verschenken. Einmal begleitete sie eine Gruppe aus der Nachbarschaft, die in die Palastgärten eindrang, um Bohnen zu stehlen. Dass die Bohnen ihr ohnehin schon gehörten, war ihr dabei nicht klar.
Als Gonpo älter wurde, stellte ihr Vater besorgt fest, dass es ihr am einer Prinzessin gemäßen Benehmen fehlte. So versuchte er, den Umgang mit Nachbarskindern, dem Nachwuchs seiner Untertanen, zu unterbinden. Sie musste sich damit begnügen, aus dem Fenster auf den Innenhof und über die Umgrenzungsmauern hinaus auf die Hügel zu blicken, deren endlose Wellen sich erst in den verschneiten Bergen im Norden verloren. So weit sie sehen konnte, war es das Reich ihres Vaters.
Das Gebiet der Mei erstreckte sich mindestens bis zu dem 135 Kilometer nordöstlich gelegenen Landkreis Dzorge (chinesisch: Zoige). Seine genaue Ausdehnung lässt sich nicht bestimmen, weil sich in dieser Gesellschaft Macht nicht nach Land, sondern nach Menschen bemaß. Grenzen zählten weniger als Treue, und es gab kaum stärkere Bande als die der weitläufigen Familie. Zeitzeugen berichten, dass der Mei-Regent mehr als zwölf Stämme und 1900 Hausgemeinschaften unter sich hatte, während in offiziellen chinesischen Dokumenten von 50000 Menschen unter seiner direkten Herrschaft die Rede ist. Da sich der Wohlstand einer Familie über die Anzahl der Tiere definierte, die sie besaß, war sorgfältig Buch geführt worden: Das Königreich verfügte über 450 Pferde und eine Herde von 800 Stück Vieh, darunter Yaks, die gelegentlich mit Rindern gekreuzt wurden.
Zwar lag der Palast inmitten von Weiden, aber die Tiere befanden sich meist in einem gut 20 Kilometer entfernten Dorf namens Meruma, das für die Herden des Königs gegründet worden war. Dort besaß Gonpos Vater auch einen Sommerpalast. Zudem gab es einen kleineren Palast einige Kilometer weiter westlich auf dem Grundstück des von seinen Vorfahren gegründeten Klosters Kirti, in dem man auf Pilgerfahrten und an buddhistischen Feiertagen wohnte.
So wie Gonpo es sah, war ihr Vater der uneingeschränkte Herrscher über sein Land. Er bestimmte die Öffnungszeiten des Marktes sowie das dortige Warenangebot und entschied, welche Tiere zur Jagd freigegeben wurden. Als frommer Buddhist untersagte er die Jagd auf Vögel, Fische, Murmeltiere und sonstige kleinere Tiere. Da man Geschöpfe grundsätzlich für wiedergeborene Seelen hielt, tötete man besser große Tiere wie Yaks oder Schafe, denn damit bekam man viele Münder auf einmal satt. Der Handel mit Opium blieb in seinem Reich strengstens untersagt.
Nach dem Frühstück empfing der König einen stetigen Strom von Besuchern, die ihm ihre Kümmernisse und Konflikte vortrugen. Wenn jemand mit seinem Nachbarn über ein Stück Land im Streit lag oder ein Geschäft eröffnen wollte, ging er zum König und bat ihn um sein Urteil. Es kamen oft so viele, dass sie auf der Wiese vor dem Palast ihr Lager aufschlugen, um auf ihre Audienz zu warten. Und nicht nur Tibeter suchten seinen weisen Rat. Die Region beheimatete ein Dutzend verschiedener Ethnien, darunter Mongolen, die sich ab dem 13. Jahrhundert im Hochland angesiedelt hatten, und Qiang, die vom Aussehen her Tibetern gleichen, aber eine eigene Sprache und Kultur besitzen. Die Hui, chinesische Muslime, zählen ethnisch zu den Chinesen, doch die Männer erkennt man an ihren dünnen Bärten und den weißen Kappen und die Frauen an den Kopftüchern.
Außerdem kamen auch immer mehr Han-Chinesen ins Land. Die Han bildeten die Mehrheit in der chinesischen Bevölkerung, und die meisten, denen Gonpo begegnete, hatten irgendeine Verbindung zur chinesischen Regierung. Doch da auch sie dem Vater Respekt zu erweisen schienen, hegte sie keinerlei Groll gegen sie. Begeistert hatte sie verfolgt, wie chinesische Ingenieure und Arbeiter parallel zum Fluss jene neue Straße bauten, die sie dann später auf dem Rückweg von der Bestattung zu ihrem Haus führte. Eine ihrer frühesten Erinnerungen bezog sich auf die Eröffnungszeremonie für diese Straße von Ngaba nach Chengdu, die in Sichtweite des Palasts verlief. In ihre besten tibetischen Gewänder gekleidet und mit Perlen geschmückt, hatten die Mädchen den chinesischen Regierungsvertretern vor dem symbolischen Durchschneiden des Bandes Blumensträuße überreicht. Damals hatten sie zum ersten Mal ein Automobil gesehen. Ihre Mutter hatte später lachend erzählt, die Mädchen hätten die Laster mit Gras füttern wollen, weil sie sie für Pferde hielten.
An jenem Abend im Jahr 1958, bei der Heimkehr von der Bestattung, konnte Gonpo nur rätseln, warum die Chinesen ihr Lager vor ihrem Haus aufgeschlagen hatten. Sie bahnte sich einen Weg ins Innere und lief in den zweiten Stock. Wie zuvor schon ihre Kinderfrau schenkten ihr auch die übrigen Bediensteten kein Lächeln. Schweigend waren sie damit beschäftigt, Kisten zu packen. Einigen standen Tränen in den Augen. Gonpo musste sich eingestehen, dass offenbar etwas Schreckliches geschehen war. Von ihrem Vater fehlte jede Spur – irgendjemand sagte, er sei zu einer Unterredung fortgefahren, was Gonpo jedoch nicht recht glauben wollte. Auf der Suche nach dem Vater oder jemandem, der ihr eine Erklärung geben konnte, lief sie von Raum zu Raum. Niemand hatte eine Antwort für sie. Bepackt mit Kleidungsstücken und Wäsche, eilten die Bediensteten zwischen den Zimmern hin und her. In Gonpo wuchs die Angst. Wie viele noch viel kleinere Kinder, die sehr laut werden können, machte sie Lärm; sie stampfte mit den Füßen auf die Holzdielen, bis ihre Kinderfrau kam und sie am Arm packte.
Gonpo solle leise sein, mahnte sie. Ob sie denn nicht verstanden habe, wie ernst es sei? Nein! Gonpo verstand gar nichts. Aber da alle anderen zusammenpackten, wäre es wohl das Beste, wenn sie das Gleiche tat. Sie ging in ihr Zimmer und suchte ihre Spielsachen heraus.
»Die wirst du nicht brauchen. Lass sie hier«, fuhr die Kinderfrau sie an. Sie hatte Gonpo von Geburt an betreut, aber noch nie so barsch mit ihr gesprochen.
Daraufhin verabschiedete sich Gonpo von ihrem kostbarsten Besitz – einem Plastikapfel aus Indien, der, wenn man ihn öffnete, eine Reihe immer kleinerer Äpfel enthielt, wie die russischen Matroschka-Puppen. Noch etliche Jahrzehnte später, als sie schon graue Haare und Arthritis hatte, suchte sie in den Spielzeugläden Asiens nach einem Plastikapfel, wie sie ihn als Kind hatte zurücklassen müssen.
Bei Tagesanbruch am nächsten Morgen wurde das Haus, wie Gonpo sah, mit Absperrband versiegelt. Die Soldaten nagelten handbeschriebene Plakate mit großen chinesischen Buchstaben ans Tor. Offenbar enthielten sie eine wichtige politische Botschaft, die Gonpo aber nicht lesen konnte, da sie die chinesische Schrift nicht beherrschte. Hinter den zur Absperrung aufgestellten Soldaten standen die Nachbarn, die Gesichter tränenüberströmt. Darunter auch die Kinder, mit denen Gonpo Bohnen gestohlen hatte.
Innerlich begehrte sie immer noch gegen den Ernst der Lage auf. Sie bemerkte ein abgestelltes Auto, das sie wohl fortbringen sollte. Es war zwar nur ein Geländefahrzeug russischer Bauart und damit auch für die 1950er-Jahre nichts Besonderes, aber Gonpo war bis dahin lediglich Bus gefahren und hatte noch nie in einem Personenwagen gesessen. Sie war so aufgeregt, dass sie die Tragödie, die ihren Lauf nahm, für einen Moment vergaß; voller Vorfreude auf der Stelle hüpfend, wollte sie zu dem Auto hinlaufen.
Ihre Mutter rief sie mit einem harten Hieb auf die Wange zurück auf den Boden der Tatsachen – es sollte das einzige Mal bleiben, dass Gonpo von ihren Eltern geschlagen wurde. Sie hatte gegen eine grundlegende Verhaltensregel der Tibeter verstoßen und sich nicht ehrerbietig von ihrem Zuhause verabschiedet. Also trat sie zurück und stellte sich neben ihre Schwester, ihre beiden Cousinen und die Tante. Sie hoben die Hände, als wollten sie beten, und ließen sich dann niederfallen, um dem Haus, das sie all die Jahre beherbergt und geschützt hatte, ihre Dankbarkeit zu erweisen. Dann stiegen sie in den Geländewagen, auf dessen Dach sich ihre Koffer türmten, und wurden fortgebracht.
2
Zur Mahlzeit Buddhas
Die chinesische Rote Armee auf dem Weg ins Hochland von Tibet, unterhalb des Berges Jiajin Shan, Juni 1935.
Das Hochland von Tibet ist mit keiner Region auf diesem Planeten zu vergleichen, eine einzigartige geologische Stätte im Herzen Asiens, die sich rund 5000 Meter über den Meeresspiegel erhebt. Man nennt dieses Hochland nicht umsonst das Dach der Welt. Die Chinesen rühmen sich gern damit, dass man vom All aus die Chinesische Mauer erkennen kann; tatsächlich aber ist es Tibet, das einem ins Auge fällt, wenn man Satellitenbilder dieser Region betrachtet. Es erscheint als riesiges landumschlossenes Plateau, gesäumt von weißen Pinselstrichen, den vergletscherten Gipfeln der höchsten Berge der Welt. Die Quellflüsse der größten Ströme Asiens fädeln sich durch die Landschaft, unter ihnen der Jangtse, der Mekong und der Gelbe Fluss, bei den Tibetern Drichu, Dzachu und Machu genannt. Sie versorgen die Hälfte der Weltbevölkerung mit Wasser.
Das Hochland wird im Süden und Westen durch den Himalaja, den Karakorum und den Pamir begrenzt, im Osten erstreckt es sich bis nach Zentralchina und nach Norden hin bis an den Rand der Wüste Gobi und der Taklamakan. Mit fast 2,6 Millionen Quadratkilometern entspricht es der Größe Indiens oder rund einem Viertel der Landmasse Chinas, aber wegen des unwirtlichen Geländes, der Höhe und der sauerstoffarmen Luft gehört es mit einer Bevölkerungsdichte von rund 2,5 Einwohnern pro Quadratkilometer zu einer der am dünnsten besiedelten Regionen der Erde.
Die genetische Abstammung der Tibeter stellt die Wissenschaft vor Rätsel. Zwar gibt es gemeinsame Vorfahren mit chinesischen, japanischen, mongolischen und sibirischen Bevölkerungsgruppen, und es bestehen auch starke Ähnlichkeiten zu einigen Stämmen amerikanischer Ureinwohner, doch sind Tibeter Träger einer einzigartigen Genmutation und körperlich dadurch dem Leben in großen Höhen ausgesprochen gut gewachsen.
Die Tibeter selbst haben einen fantastischen Schöpfungsmythos, mit Anklängen an den Darwinismus und Buddhismus. Im Kern stimmen die verschiedenen Varianten, die existieren, darin überein, dass das tibetische Volk der Verbindung eines Affen mit einer Dämonin entstammt, die sich auf einem Felsvorsprung über einem riesigen, einst das Tibetische Hochland bedeckenden Binnenmeer paarten (für den Teil mit dem Binnenmeer sprechen geologische Befunde). Wie es heißt, war der Affe eine Manifestation von Avalokiteshvara, des von Natur aus sanftmütigen Bodhisattvas des Mitgefühls, und die Dämonin eine erbarmungslose Kriegerin.
Diese Eigenschaften sollen auf ihre Nachfahren, das tibetische Volk, übergegangen sein und prägten in der Folge dessen Schicksal im Widerstreit von Mitgefühl und Grausamkeit. Selbst als im 7. Jahrhundert aus Indien der Buddhismus eingeführt wurde, zeigten sich die Tibeter kaum als Pazifisten. Anders als es Tibets neuzeitlicher Ruf als hermetisch abgeschottetes Königreich nahelegt, bestand durchaus Kontakt zur Außenwelt. In einer Ära, in der die Reitkunst die entscheidende Grundfertigkeit der Kriegsführung war, zogen Tibeter durch Zentralasien, brandschatzten Städte und unterwarfen andere Völker, die in das tibetische Volk eingegliedert wurden. Unter dem großen Herrscher Songtsen Gampo errichteten sie ein Reich, das mit dem der Mongolen, Türken und Araber rivalisierte. Für einen flüchtigen, doch kaum vergessenen Moment in der Geschichte waren die Tibeter sogar mächtiger als die Chinesen. Im Jahr 763 brandschatzten sie Chang’an, in der Zeit der Tang-Dynastie die Hauptstadt, heute bekannt als Xi’an und Heimat der Terrakotta-Krieger. Ihre Besatzung der Stadt dauerte lediglich 15 Tage, aber die Tibeter erinnerten sich noch lange mit Stolz daran.
Mitte des 9. Jahrhunderts zerfiel das Tibetische Reich in lauter kleinere Fürstentümer. Erst 1642 entstand unter der Führung mehrerer aufeinanderfolgender Dalai Lamas, die von den mächtigen Mongolen eingesetzt und unterstützt wurden, wieder ein starkes, zentralisiertes Tibet. Der fünfte Dalai Lama errichtete auf den Ruinen der Festung von Songtsen Gampo den Potala-Palast, um den Anschein einer sich aus der Vergangenheit herleitenden, ungebrochenen Nachfolge zu erwecken. Dieses Tibet war allerdings nicht halb so groß wie das frühere Reich, und die im Osten gelegenen, vormals tibetischen Gebiete waren jetzt weitestgehend aufgeteilt in verschiedene kleinere Königreiche und Lehen, von denen das von Prinzessin Gonpos Dynastie beherrschte Reich der Mei nur eines war.
Gonpos Vorfahren stammten ursprünglich aus dem Westen der Hochebene, nahe dem Berg Kailash – einer Region namens Ngari, auf die auch der Name Ngaba zurückgehen könnte. Wohl zur Stärkung ihrer Legitimität beriefen sie sich darauf, im Laufe des 9. Jahrhunderts, dem Goldenen Zeitalter Tibets, als Krieger unter dem Kommando der großen Herrscher in den Osten gekommen zu sein. Als das Tibetische Reich zusammenbrach, blieben sie einer offiziellen Chronik zufolge dort und begründeten ihr eigenes Lehen.
Für Abtrünnige gab es kaum einen besseren Ort als Ngaba. Es war wie im alten chinesischen Sprichwort: Der Himmel ist hoch, und der Kaiser ist weit. Von Ngaba bis nach Peking sind es über 1500 Kilometer – damals mindestens ein Monat zu Pferd –, und nach Lhasa ist es fast ebenso weit. Als sich das Reich der Mei im 18. Jahrhundert fest etabliert hatte, standen die östlichen Gebiete des Tibetischen Hochlands unter der Herrschaft der Mandschu, die China erobert und die Qing-Dynastie begründet hatten. Doch die Qing-Herrscher fühlten sich von der lästigen Aufgabe des Regierens überfordert. Berittene Krieger schickten sie nur dann, wenn Kämpfe zwischen aufsässigen Stammesführern das Reich gefährdeten. »Sollen die Barbaren sich selbst regieren« – so etwa schien man es zu halten. Viele Landesfürsten, darunter auch Gonpos Vorfahren, wurden von ihnen sogar mit dem Kaisersiegel als sichtbares Zeichen ihrer Amtsgewalt ausgestattet.
Ngaba bestand aber auch auf seiner Unabhängigkeit von Lhasa. Die Menschen in Ngaba betrachteten sich nicht als Untergebene des Dalai Lama, obwohl sie ihn als ihren geistigen Führer verehrten. Sie unternahmen Pilgerreisen nach Lhasa, besuchten zur Unterweisung die bedeutenden Klöster der Stadt und betrieben ihre Geschäfte; sie waren dort als gewiefte Händler bekannt. Was sie mit anderen Tibetern verband, waren die Volkszugehörigkeit, der Glauben und die Gebräuche. Sie besaßen dieselbe Schriftsprache – basierend auf einem nordindischen Alphabet –, auch wenn ihre jeweiligen Dialekte zu sehr voneinander abwichen, um sich verständigen zu können. Aber sie aßen dasselbe Getreide, die Tsampa genannte geröstete Gerste – in der Hochebene so überlebenswichtig, dass der Begriff »Tsampa-Esser« praktisch gleichbedeutend mit Tibeter war. Doch sie gehörten nicht zu den Untergebenen der Zentralregierung in Lhasa und folgten auch nicht deren Gesetzen. Statt sich als Böpa, als Tibeter, zu betrachten, verwiesen sie in der Regel auf ihren Stamm oder ihr Oberhaupt. Ansonsten erkannten sie die gemeinsame Abstammung dadurch an, dass sie sich als Volk aus dem »Schneeland« bezeichneten.
Eigentlich gehörte dieses Gebiet also nicht zu Tibet, doch mit Blick auf die Kultur war es durchaus keine rückständige Gegend. Der östliche Teil der Hochebene, von den Tibetern Amdo (der Nordosten) und Kham (der Südosten) genannt und von den Briten mitunter als »inneres Tibet« bezeichnet, brachte überdurchschnittlich viele angesehene Lamas, Gelehrte und Künstler hervor. So stammte etwa Tsongkhapa (1357–1419) aus Amdo, ein herausragender buddhistischer Philosoph und Begründer der Gelug-Schule, der mittlerweile vorherrschenden Richtung des tibetischen Buddhismus; außerdem der berühmteste lebende Tibeter überhaupt, der 14. Dalai Lama, der 1935 in einem Dorf namens Taktser zur Welt kam, rund 320 Kilometer nördlich von Ngaba gelegen. Aus Amdo kommt auch der 10. Panchen Lama, der dem Rang nach zweithöchste tibetische Lama und eine der Schlüsselfiguren der tibetischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Kham war der Herkunftsort von Rebellen unterschiedlicher politischer Couleur, darunter einige der ersten Tibeter, die der Kommunistischen Partei beitraten, sowie etwas später die radikalste antikommunistische Partisanengruppe überhaupt. Der legendäre Kriegerkönig des Gesar-Epos soll in Kham geboren sein. Heute lebt die Mehrheit der Tibeter in der östlichen Hälfte der Hochebene, in Teilen der Provinzen Qinghai, Sichuan, Gansu und Yunnan. Das sorgt für viel Verwirrung, denn nach Ansicht der chinesischen Regierung handelt es sich nicht um Gebiete Tibets, obwohl ihre tibetische Prägung unverkennbar ist, wie man feststellt, wenn man sie bereist. Trifft man gegenwärtig in New York oder London auf Menschen, die sich als Tibeter bezeichnen, stammen sie sehr wahrscheinlich von dort.
Die anschaulichsten Beschreibungen vom Leben im Reich der Mei entnehmen wir dem Werk A Brief Chronicle of the Origins of the Mei King for the Ears of Future Generations. Das dünne, in Seidenbrokat gebundene Büchlein wurde 1993 im Selbstverlag von einem Mann namens Chöphel herausgebracht, einem Sekretär von Gonpos Vater. Zur Zeit ihrer Herrschaft lebten die Mei-Könige in ständiger Furcht, da sie stets vor Umsturzplänen von Rivalen auf der Hut sein mussten. Waren Schwerter und Feuerwaffen nicht mächtig genug, riefen die Krieg führenden Parteien Schamanen hinzu, um dem Feind mithilfe von Beschwörungen zuzusetzen. Streitigkeiten wurden durch Reparationsleistungen beigelegt – Dörfer ganz nach Belieben der einen oder der anderen Seite zugeteilt. Die Besiegten wurden bestraft, indem man ihnen Gliedmaßen, Ohren oder Nasen abtrennte. Doch nicht alles drehte sich um Krieg und Vergeltung. Die Mei rühmten sich, hartgesottene Geschäftsleute zu sein und ihren Untertanen genügend Freiraum zu lassen, dem Beispiel der Herrschenden zu folgen. Der einzigartige Lebensraum des Tibetischen Hochlands brachte rare Produkte hervor wie die Duftdrüsen der Moschustiere, sehr gefragt bei Parfümherstellern in der arabischen Welt, und das aus Tibets zahlreichen verdunsteten Seen gewonnene Salz. Ngaba erwarb sich den Ruf eines geschäftsfreundlichen Umfelds; seine Kaufleute trieben von China bis nach Zentraltibet und Nepal florierenden Handel, vor allem mit Tee, der als Ladung ganzer Yakkarawanen quer durch das Hochland transportiert wurde.
Das Reich der Mei war kein Matriarchat; es entwickelte sich eher zufällig, dass die Königinnen die Könige in den Schatten stellten. Frauen waren in der Thronfolge zugelassen, sofern es keinen geeigneten männlichen Erben gab, was häufiger vorkam, weil einige Mitglieder der Herrscherfamilie an Unfruchtbarkeit litten und mindestens ein König geisteskrank war. Die Königinnen errichteten Klöster, unterzeichneten Verträge und führten Heere in die Schlacht. Eine Königin zog in den Krieg, um sich für ihren gehörnten Sohn an einer untreuen Schwiegertochter zu rächen. Derlei Angelegenheiten konnten Söhne ohne ihre Mütter nicht regeln.
Die im 18. Jahrhundert lebende Königin Abuza schmiedete ein Bündnis, das zum besonderen Merkmal der Mei-Dynastie wurde. Abuza war eine Außenseiterin, die in die königliche Familie einheiratete, dann ihren Gatten in seiner Machtposition aber rasch ausstach. Um 1760 traf sie den Vorsteher des Klosters Kirti, dessen Hauptsitz in Dzorge im äußersten Nordosten des Herrschaftsgebiets der Mei lag. Sie lud den Kirti Rinpoche (so die Ehrenbezeichnung des Klosteroberen) auf einen Besuch nach Ngaba ein.
Der Rinpoche gewann die Gunst der Königin, indem er eine zornige Gottheit bändigte, die das Königreich geplagt hatte – in Amdo besaß jede Anhöhe, jede Weide und jeder Fluss eine eigene Gottheit –, und eine andere Gottheit zur Schutzmacht des Herrscherhauses bestimmte. Daraus entwickelte sich nach dem als Chö-yon benannten Vorbild eine Priester-Patron-Beziehung. Der Priester gewährte spirituelle Unterweisung und verlieh dem Herrscher Legitimität; der wiederum bot materielle Unterstützung in Form von Geld, Viehherden oder Land. Gemeinsam waren sie erfolgreich und mehrten ihre Macht und Strahlkraft. Ein Jahrhundert später gründete Kirti eine Klosterniederlassung in Ngaba, die dann zu einer der einflussreichsten und politisch aktivsten wurde und mit zu Ngabas späterem Ruf als Hort der Aufständischen beitrug.
Auf die Königin ging auch ein einmonatiges, in jedem Frühjahr in Ngaba abgehaltenes Gebetsfest zurück. Dabei verbrannten die versammelten Tibeter Wacholderzweige und Räucherwerk und gaben gemäß der buddhistischen Geste des Mitgefühls für die Schlachtung vorgesehenen Tieren die Freiheit. Zur Unterhaltung veranstalteten sie Pferderennen und maßen sich im Bogenschießen. Die Leute aus der Gegend kamen mit Tonwaren, die sie zum Verkauf anboten. Das Keramikfest, wie es alsbald heißen sollte, war in Osttibet äußerst beliebt, bis es 2009 wegen der tibetischen Unruhen von den chinesischen Machthabern ausgesetzt wurde.
Die ruhmreichste aller Königinnen war Gonpos Großmutter, Palchen Dhondup. Zwar gibt es von ihr weder Fotografien noch Porträts, doch die Familienchroniken schildern sie als »sehr schöne Frau« und als »großherzig und intelligent«. Ihr Vater erzählte Gonpo einmal, dass ihre Großmutter »eine echte Kriegerin war, und wenn sie sich ihr Haar unter eine Kappe steckte, um in den Kampf zu ziehen, prächtiger aussah als jeder Mann«. Sie war in den späten 1890er-Jahren unter tragischen Umständen zur Welt gekommen. Ihre Mutter starb bei der Entbindung. Ihr Vater, König Gonpo Sonam, verlor 1913 bei einem außergewöhnlichen Unfall das Leben, als er den Bau einer Versammlungshalle im Kloster Kirti beaufsichtigte. Er wurde beim Einsturz des Daches erschlagen. So kam es, dass die verwaiste halbwüchsige Prinzessin, ein Einzelkind, dem Königreich vorstand. Nach tibetischer Tradition konnte eine junge Frau zwar als Herrscherin anerkannt werden, Voraussetzung war aber, dass es einen Mann in der Familie gab. Hastig wurde die Prinzessin deshalb mit einem Prinzen aus Golog nordwestlich von Ngaba vermählt. Doch obwohl er nominell als König fungierte, gab es keinen Zweifel, dass Palchen Dhondup die Zügel der Macht in den Händen hielt. Sie ließ sie selbst dann nicht los, als ihr eigener Sohn – Gonpos Vater Palgon Rapten Tinley – König der Mei wurde.
Die Königin Palchen Dhondup vollendete das verhängnisvolle Bauprojekt im Kloster, bei dem ihr Vater umgekommen war. Sie spendete Juwelen aus ihrem Haarschmuck, um damit Schnitzarbeiten an jenen Holzplatten zu finanzieren, die beim Druck des Gesamtwerks von Tsongkhapa verwendet wurden, dem Begründer der Gelug-Schule.
Aufgrund ihrer Bildung und ihrer Toleranz war die Königin hoch angesehen. Im Jahr 1924 kam der amerikanische Missionar Robert Ekvall mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn nach Ngaba, um Bibelübersetzungen in tibetischer Sprache zu verteilen. Zwar versuchten Mönche, ihn zu verjagen, doch er bekam eine Audienz bei der Königin. Schnell begriff er, dass sie diejenige war, die das Sagen hatte. »Der König war praktisch nur der Prinzgemahl«, berichtete Ekvall später in einem Interview.
Ekvall übergab der Königin Geschenke – ein Barometer, einen Kompass, Feldstecher und eine der übersetzten Bibeln. Während der Missionar sich noch immer unwohl in seiner Haut fühlte, durchblätterte die Königin die Bibel und kommentierte die hohe Qualität des Drucks. Dann las sie einige Passagen laut vor. Sie schien zwar nicht geneigt, zu konvertieren, ließ Ekvall aber wissen, dass ihr die ersten Sätze des Johannesevangeliums gefielen: »Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott.« Dies trifft sich mit den Glaubensvorstellungen im tibetischen Buddhismus, wonach die Sprache zum Wesen der menschlichen Seele gehört.
»Jetzt verstehe ich den Sinn«, sagte sie zu Ekvall.
Die Königin beeindruckte Ekvall als wortgewandt und wissensdurstig und, wie er in dem Interview sagte, »ausgesprochen mitfühlend«. Besonders hatte es ihr, wie er sich erinnerte, der kleine Sohn des Ehepaars angetan, weil sie, wie andere in ihrer Familie auch, nur unter Schwierigkeiten Kinder bekommen konnte. Überlebt hatte von allen bis dahin nur eins – Palgon Rapten Tinley.
Königin Palchen Dhondup hätte möglicherweise eine ruhmreiche Regentschaft gehabt, wäre diese nicht mit dem turbulenten Beginn des 20. Jahrhunderts zusammengefallen. Großbritannien und Russland hatten sich in einen heftigen Konkurrenzkampf um Einflussgebiete in Zentralasien verwickelt, und jeder, der ihnen im Weg stand, war gefährdet. Im Jahr 1903 führte der in Indien stationierte britische Oberst Francis Younghusband eine von ihm euphemistisch als »Expedition« bezeichnete Militäroperation in Tibet durch. Dabei wurden mehrere Tausend Tibeter getötet. Obwohl er die Rückendeckung des indischen Vizekönigs Lord George Curzon hatte, distanzierte sich die britische Regierung von dem Einsatz und zog ihre Truppen ab. Der Schaden war insofern irreparabel, als dadurch die Qing-Dynastie aus ihrer Selbstzufriedenheit gerissen wurde. Die chinesischen Mandschu-Herrscher hatten sich vorwiegend mit den europäischen Offensiven zur Zwangsöffnung von Vertragshäfen an der Küste beschäftigt und darüber ihre Westflanke vernachlässigt. Sicher war es nicht in ihrem Sinn, dass Großbritannien vom Dach der Welt auf China herabblickte oder seine Wasserversorgung kontrollierte. Nachdem sie von den Briten mit der Nase darauf gestoßen worden waren, erkannten die Chinesen die strategische Bedeutung der Hochebene. Bis heute geben viele gebildete Tibeter Großbritannien die Schuld an den Katastrophen, die in der Folge über Tibet hereinbrachen.
Obschon die Qing-Dynastie militärisch geschwächt war, führte sie 1909 ihrerseits eine Invasion Tibets durch; die chinesischen Truppen blieben dort bis 1911, als das Kaiserreich zusammenbrach. Die Tibeter nutzten den Moment, um alle chinesischen Repräsentanten des Landes zu verweisen. In der Folge konnte sich Tibet wieder als selbstständiges Land etablieren, das eigene Reisedokumente ausstellte und eine eigene Währung einführte. Allerdings handelte es sich lediglich um eine De-facto-Unabhängigkeit, da Tibet es versäumte, die Aufnahme in den Völkerbund, den Vorgänger der Vereinten Nationen, zu beantragen; der Nutzen dieser noch in den Kinderschuhen steckenden internationalen Organisation wurde nicht in vollem Umfang erkannt. Gerechterweise muss man sagen, dass das Konzept der Eigenstaatlichkeit im frühen 20. Jahrhundert noch nicht ausgereift war und die internationalen Beziehungen des imperialen Asiens nicht ganz mit dem übereinstimmten, was man in Europa darunter verstand. Die Tibeter ersuchten die Briten, ihre Unabhängigkeit anzuerkennen, mussten sich aber letztlich mit einer Übereinkunft zufriedengeben, wonach China das Recht der »Suzeränität« oder »Oberhoheit« erhielt. Der Begriff hatte den Vorteil, dass keiner genau wusste, was darunter zu verstehen war. Aus dem Schriftverkehr der Jahre nach dem Untergang des chinesischen Kaiserreichs geht hervor, dass Briten und Tibeter um die Übersetzung und Definition von Begriffen wie Suzeränität, Souveränität, Unabhängigkeit und Autonomie rangen. Letztlich blieb Tibets Status ungeklärt, und das zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.
Der Zerfall der jahrtausendealten Kaiserherrschaft Anfang des 20. Jahrhunderts hinterließ in China ein gefährliches Vakuum. Die von Sun Yat-sen gegründete Republik China zeichnete sich durch Machtlosigkeit aus, denn in dieser auch als Warlord-Ära bekannten Zeit wurde der Großteil des Landes von sich befehdenden Cliquen dirigiert. Der junge Kaiser Puyi gab sich, nachdem er aus der Verbotenen Stadt vertrieben worden war, in den 1930er-Jahren in einem Marionettenstaat namens Mandschukuo, den die Japaner im Nordosten Chinas eingerichtet hatten, einem ausschweifenden Lebensstil hin. Das restliche China unterstand dem Kommando des nüchternen Generalissimo Chiang Kai-shek, der Sun Yat-sen an der Spitze der Kuomintang oder Nationalen Volkspartei abgelöst hatte. Dann aber rückten die Japaner ins Land vor; zugleich musste sich Chiang Kai-shek mit einer immer stärkeren neuen Rivalin auseinandersetzen, die ihm im Nacken saß: der Kommunistischen Partei Chinas – deren Vorsitz bald darauf Mao Tse-tung übernahm.
Die Tibeter in Ngaba wussten nicht viel über die chinesische Politik. Sie waren mit ihren eigenen Konflikten beschäftigt, die rivalisierende tibetische Stammesführer untereinander austrugen, und schenkten diesem Krieg in weiter Ferne kaum Beachtung. Chinesen im Kampf gegen Chinesen – das war schließlich eine innere Angelegenheit, die mit Tibet offenbar nichts zu tun hatte.
Die Kommunisten hatten sich knapp 2000 Kilometer weit entfernt an der Grenze der Provinzen Jiangxi und Fujian niedergelassen und dort einen von Sowjets regierten Staat ausgerufen. Als Chiangs Truppen 1934 einen Angriff starteten, um sie zu vertreiben, teilten sich die Kommunisten in drei Heere auf und flüchteten auf einem Rückzug, der als der Lange Marsch bekannt wurde. Für die Kommunistische Partei Chinas ist es ein Heldenmythos, verewigt in zahllosen revolutionären Balladen und Opern – in etwa die Entsprechung zum Auszug aus Ägypten, jedoch anstelle von Moses mit Mao als zentraler Figur, der die Rote Armee in sichere Gefilde führte.
Verfolgt von Chiang Kai-sheks Armee flohen die Kommunisten immer weiter in den Westen Chinas, bevor sie die nördliche Richtung einschlugen und auf die Provinz Sichuan zusteuerten. Für die Tibeter war dies die erste Begegnung mit der Kommunistischen Partei Chinas. Sie sollte nicht gut ausgehen.
Die Rote Armee der 1930er-Jahre war noch nicht die formidable Kampfmaschine, zu der sie sich später entwickelte. Den chinesischen Soldaten fehlte es an Ausrüstung, Verpflegung und Ortskenntnissen. Die letzten Lehensherren im Hochland, die Qing, gehörten zur Volksgruppe der Mandschu und nicht der Han; die Boten, die sie in die Hochebene entsandten, waren in der Regel Mandschu oder Mongolen. Viele Karten und offizielle Dokumente waren in Mandschurisch verfasst. Bei den Soldaten der Roten Armee aber handelte es sich großteils um Han aus den Ebenen im Osten und Süden Chinas.
So idyllisch Tibet in prächtigen Bildbänden auch wirken mag; wer mit den natürlichen Gegebenheiten nicht vertraut ist, erlebt es als unerbittlich – mit einem Wetter, das auf gefährliche Weise unvorhersehbar ist. Man kann völlig durchnässt sein und erliegt im nächsten Moment schon dem Zauber eines doppelten Regenbogens, ehe unter den UV-Strahlen der Hochgebirgssonne die Haut runzelig wird. Hagelkörner, so groß wie Hühnereier, können einen ausgewachsenen Yak töten und mitunter auch Menschen. Die sauerstoffarme Luft verursacht bei Neuankömmlingen Schwächeanfälle und Kopfschmerzen, und heftige Schneewirbelstürme haben zur Folge, dass selbst Tibeter sich verlaufen und erfrieren. Für die Chinesen war das Hochland von Tibet Terra incognita.
»Wo sind wir? Sind wir gar nicht mehr in China?«, fragte ein fassungsloser Soldat seinen befehlshabenden Offizier, als sie durch die Grasfluren bis östlich von Ngaba zogen – so schreibt Sun Shuyun in ihrem Buch Maos Langer Marsch. Der kommandierende Offizier gestand, er wisse es auch nicht. Er schlug vor zu warten, bis sie auf jemanden träfen, der Chinesisch sprach. Aber sie trafen niemanden.
Die dringlichste Sorge für die Rote Armee war die mangelnde Verpflegung. Zuerst stahlen die chinesischen Soldaten die Ernte von den tibetischen Feldern, selbst wenn sie noch nicht ausgereift war, und bedienten sich an den Getreidevorräten. Sie fingen Schafe und Yaks ein und schlachteten sie. Viele Jungkommunisten waren noch immer idealistisch und wollten den Armen helfen; deshalb hinterließen sie manchmal, wie in Aufzeichnungen berichtet wird, Schuldscheine, nachdem sie tibetische Speisekammern geplündert hatten. Viel half es nicht, denn die Tibeter hatten bereits alle Möglichkeiten zur Erzeugung von Nahrungsmitteln ausgeschöpft. Das Hochland konnte keine größere Bevölkerungszahl ernähren, und zigtausend neu angekommene Soldaten schon gar nicht. Erstmals seit Menschengedenken gab es in Tibet eine Hungersnot.
Irgendwann entdeckten die Chinesen, dass die buddhistischen Klöster nicht nur tibetische Kulturschätze bargen, sondern auch potenziell Essbares. Es gab Gefäße aus Tierhäuten, die verzehrt werden konnten, wenn man sie nur lange genug kochte – eine Methode, die die Soldaten kannten, da sie ihre Gürtel, Gewehrriemen, Ledertaschen und Pferdezügel bereits verzehrt hatten. Sie aßen sogar aus Gerstenmehl und Butter geformte Figuren, wie aus einem Bericht hervorgeht, auf den die Wissenschaftler Jianglin Li und Matthew Akester stießen, die ausgiebig über diese Epoche geforscht haben. Wie es dazu kam, erzählt eine Schilderung aus den Erinnerungen Wu Faxians, eines früheren Politkommissars in Maos erster Armee. Er schrieb:
Einer unserer Quartiermeister besuchte einen lamaistischen Tempel. Beim Umhergehen stieß er die kleinen Statuen um, worauf er an einer leckte. Zu seiner Überraschung schmeckte sie süß. Er leckte ein zweites Mal, und sie war tatsächlich süß. Es stellte sich heraus, dass all diese kleinen verstaubten Buddhas, ganz gleich welcher Größe, süß schmeckten. Es war herrlich – als würde Kolumbus die Neue Welt entdecken! Er brachte einige kleinere Statuen mit zurück, säuberte sie und kochte sie dann mit Wasser auf. Sie waren alle aus Mehl und schmeckten richtig gut …
Von da an suchte der Quartiermeister in jedem Ort, in den wir kamen, nach lamaistischen Tempeln und kehrte dann mit Mehl-Buddhas zurück, die wir essen konnten.
Tibeter, die diese Zeit überlebt haben, erklären, die Chinesen hätten genau genommen Torma gegessen, bei denen es sich nicht um Buddhastatuen im eigentlichen Sinn handelt, sondern um Weihgaben. Die Chinesen aber sahen es anders: Sie gingen davon aus, im wahrsten Sinne des Wortes Buddhas zu essen. Dass dies ein Sakrileg war, wussten sie, doch es kümmerte sie nicht.
Die Tibeter leisteten erbitterten Widerstand. Die Königin ordnete an, Frauen und Kinder in die Berge zu bringen, während sie wehrfähige Männer zum Kampf einzog. Wenngleich strenge Buddhisten das Töten von Tieren verabscheuen und oftmals für eine Fliege beten, die in einer Schüssel Suppe ertrunken ist, können sie, einmal angegriffen, gnadenlose Krieger sein. Allerdings war es in Tibet grundsätzlich schwierig, eine Armee aufzustellen, weil in der traditionell ausgerichteten Gesellschaft rund 20 Prozent der Männer Mönche sind, die sich der mitfühlenden Seite der tibetischen Wesensart verschrieben haben. Die Königin war jedoch nicht bereit, Ausnahmen zuzulassen. »Wenn wir kämpfen, dann geschieht es zur Verteidigung der Religion und nicht nur des Landes«, so wies sie ihre Untertanen an, wie ein älterer Tibeter einem Chronisten mündlicher Tradition später berichtete.
Bewaffnet mit Speeren, Vorderladern und Musketen und mit amulettförmigen Gebetsbehältern um den Hals zum Schutz vor Gewehrkugeln, fochten sie auf heimischem Boden einen harten Kampf. Anfangs erzielten sie Erfolge und konnten in der Nähe des Klosters Amchok Tsenyi den Vormarsch der Roten Armee aufhalten. Das Kloster liegt an der Straße nach Chengdu, rund 15 Kilometer südöstlich von Meruma, wo die Soldaten der Mei ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatten. Beinahe die Hälfte des chinesischen Regiments mit 1300 Männern fiel im Kampf, wie Wu Faxian in seinen Erinnerungen schrieb. Doch innerhalb weniger Tage schickte die Nachhut Verstärkung, die die Tibeter zum Rückzug zwang.
Alle wurden aufgefordert, in die Berge zu flüchten, hinauf auf die Hochgebirgspässe, wohin die entkräfteten und hungrigen Rotarmisten ihnen nicht folgen könnten. Sie nahmen so viele Tiere mit, wie sie in die Berge treiben, und so viel Verpflegung, wie sie tragen konnten. Alles Übrige wurde versteckt. Alsbald durchkämmte die Rote Armee die Grundstücke verlassener Anwesen; auf der Suche nach Wertsachen und Getreide gruben sie die Böden um und räumten die Felder ab. Leer stehende Häuser wurden samt Nebengebäuden in Besitz genommen, wobei die Klöster in der Regel als die erlesensten Unterkünfte galten. Mao selbst kam nicht durch Ngaba, aber der Oberkommandierende der Roten Armee, Zhu De, wählte für sich die Versammlungshalle des Klosters Kirti, die größte der Gegend. Die Rotarmisten rissen Bodendielen und Dachsparren heraus, die ihnen als Brennholz dienten, und zogen Thangkas von den Wänden, um die Leinwände als Sitzgelegenheiten zu verwenden. Kupferschalen und Silberstatuen wurden zur Herstellung von Kugeln eingeschmolzen.
Inzwischen zeichnete sich ab, dass die Rote Armee wohl den Königspalast einnehmen würde, und Königin Palchen sah die Gefahr. Sie begab sich in den Gebetsraum und bat um Beistand. Ihre Untertanen vermuteten später, sie habe ein Orakel befragt, und es habe offenbar geantwortet, sie dürfe dem Feind nicht gestatten, von ihrem Heim aus eigene Zwecke zu verfolgen. Im Gebetsraum flackerten Reihe um Reihe Lampen, in denen geklärte Yakbutter verbrannt wird – die rituellen Lichter und das markanteste Merkmal tibetischer Klöster und Tempel. Sie nahm eine der kleineren Lampen, deren Flamme jedoch groß genug war, um an Vorhängen und Wandteppichen emporzuzüngeln. Und wenngleich die Außenseite des Palasts aus Lehm bestand, so war er innen aus Holz und die Möbel, Gemälde und Textilien leicht entzündlich, sodass der Palast in kürzester Zeit niederbrannte. Die Königin und ihre Familie flohen mit den restlichen Tibetern in die Berge.
Rund vier Monate blieben sie fort und warteten auf den Abzug der Roten Armee. Dann kehrten sie nach Ngaba zurück und ließen sich in einem Palast nieder, der hinter dem Kloster Kirti stand. Es waren magere Jahre. Die Armee hatte die Felder abgeerntet. 1936 kam die Rote Armee ein weiteres Mal durch die Gegend, und das Volk floh erneut in die Berge. Damals war Königin Palchen Dhondup überglücklich, als sie erfuhr, dass sie erneut schwanger war. In ihren späten Dreißigern, fast zwei Jahrzehnte nach der Geburt von Gonpos Vater, brachte sie ein Mädchen zur Welt, Dhondup Tso. Tragischerweise starb sie, wie ihre eigene Mutter, im Kindbett.
3
Die Rückkehr des Drachen
Von links nach rechts: der junge Panchen Lama, der Mei-König, der Dalai Lama und andere Repräsentanten auf ihrer Chinareise, 1954.
A