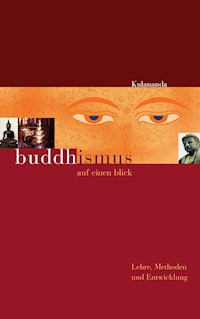
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Kurz, prägnant und klar beschreibt Kulananda Lehre und Methoden des Buddhismus, Ethik und Meditation und skizziert Entstehung und Entwicklung dieser 2500 Jahre alten Religion. Ideal für Einsteiger, aber auch als kleines Handbuch sehr nützlich (mit Glossar). INHALT: 1. Der Buddha; 2. Der Dharma - die Lehre: 2.1. Die Vier Edlen Wahrheiten, 2.2. Der Edle Achtfache Pfad (Der Pfad der Schauung, Der Pfad der Wandlung;); 3. Der Sangha - die spirituelle Gemeinschaft: 3.1. Zufluchtnehmen, 3.2. Wachstum und Entfaltung des Sanghas, 3.3. Die Entfaltung der spirituellen Schätze des Arya-Sanghas, 3.4. Weitere Entwicklungen des Sanghas, 3.5. Frauen im Buddhismus, 3.6. Spirituelle Freundschaft; 4. Buddhistische Ethik: 4.1. Karma, 4.2. Wiedergeburt, 4.3. Die Fünf Vorsätze; 5. Meditation: 5.1. Samatha, 5.2. Die Vergegenwärtigung des Atems, 5.3. Die Dhyanas, 5.4. Die Metta-bhavana, 5.5. Vipassana, 5.6. Die Sechs-Elemente-Praktik , 5.7. Visualisierungsübungen, 5.8. Formlose Meditationen, 5.9. Hingabe und Ritual; 6. Die Verbreitung und Entwicklung des Buddhismus: 6.1. Buddhismus heute, 6.2. Der Buddhismus im Westen; Anmerkungen; Begriffserläuterungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kulananda ist ein westlicher buddhistischer Lehrer. 1977 wurde er in den von Sangharakshita 1968 begründeten Westlichen Buddhistischen Orden aufgenommen (heute Buddhistischer Orden Triratna). Dort hat er mittlerweile eine führende Funktion inne. Er ist als Dharma-Lehrer, Autor und als Sprecher dieses Ordens tätig. Sein besonderes Anliegen ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen aus dem Westen möglichst effektiv Buddhismus praktizieren können.
Für meine Eltern Sydney und Edele Chaskalson
INHALT
Dank
Einführung
1. Der Buddha
2. Der Dharma – Die Lehre
Die Vier Edlen Wahrheiten
Der Edle Achtfache Pfad
Der Pfad der Schauung
Vollkommene Schauung
Die Drei Merkmale der bedingten Existenz
Der Pfad der Wandlung
Vollkommene Emotion
Vollkommene Rede
Vollkommenes Tun
Vollkommener Lebenserwerb
Vollkommene Bemühung
Vollkommenes Gewahrsein
Vollkommener Samādhi
3. Der Sangha – die spirituelle Gemeinschaft
Zufluchtnehmen
Wachstum und Entfaltung des Sanghas
Die Entfaltung der spirituellen Schätze des ārya-Sanghas
Weitere Entwicklungen des Sanghas
Frauen im Buddhismus
Spirituelle Freundschaft
4. Buddhistische Ethik
Karma
Wiedergeburt
Die Fünf Vorsätze
5. Meditation
Samatha
Die Vergegenwärtigung des Atems
Die Dhyānas
Die Mettā-Bhāvanā
Vipassanā
Die Sechs-Elemente-Praktik
Visualisierungsübungen
Formlose Meditationen
Hingabe und Ritual
6. Die Verbreitung und Entwicklung des Buddhismus
Buddhismus heute
Buddhismus im Westen
Anmerkungen
Begriffserläuterungen
DANK
Dieses Buch schöpft aus vielen Quellen. Es enthält nichts, das von mir allein stammt. Ich habe mich nicht gescheut, auf die Schriften und Vorträge meines Lehrers Sangharakshita (sprich: ssánga-rákschita) sowie meiner Freunde zurückgreifen. Insbesondere Andrew Skiltons Concise History of Buddhism, Vessantaras Das weise Herz der Buddhas sowie Anthony Matthews’ Meditation, der buddhistische Weg zu Glück und Erkenntnis haben mir sehr geholfen; ebenso hilfreich fand ich Stephen Batchelors The Awakening of the West.
Ohne die Schriften und Arbeiten meines Lehrers Sangharakshita hätte ich nichts Wesentliches zu sagen. Falls dem vorliegenden Buch hier irgendein Verdienst zukommt, habe ich es ihm zu verdanken. Es sind Gedanken aus all seinen Büchern eingeflossen, insbesondere aus Die Drei Kleinode, Sehen, wie die Dinge sind, A Guide to the Buddhist Path und The Ten Pillars of Buddhism.
Sangharakshita, Kamalashila (Anthony Matthews) und Nagabodhi haben das Manuskript gelesen und hilfreiche Anmerkungen gemacht. Vishvapani hat manche meiner Aufgaben übernommen, um mir Zeit zum Schreiben zu geben. Ihnen allen möchte ich danken.
EINFÜHRUNG
Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Ländern, die stark von buddhistischen Ideen und Übungsformen beeinflusst wurden. Doch seit der Zeit des Buddha – ein halbes Jahrtausend vor der Entstehung des Christentums – bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren für die meisten Menschen im Westen diese Ideen praktisch unbekannt. Um die Mitte des 20. Jahrhunderts begann sich dies jedoch zu ändern, und der Buddhismus gehört heute sogar zu den Religionen mit dem schnellsten Wachstum.
In einer Zeit, in der uns bloß zwischen den wachsenden Anforderungen der Konsumgesellschaft und Religionsformen, die unsere Gutgläubigkeit auf eine harte Probe stellen, zu wählen bleibt, wenden sich immer mehr Menschen dem Buddhismus zu. Sie sehen ihn als eine Möglichkeit, jene menschlichen und spirituellen Werte zu entdecken, die unserer heutigen Welt so sehr fehlen.
Doch was ist der Buddhismus? Wir sind daran gewöhnt, Religion mit einem Glauben an Gott zu verbinden – ganz gleich, in welcher Gestalt wir ihn uns vorstellen. Doch im Buddhismus gibt es keinen Gott. Handelt es sich hier also bloß um eine Philosophie, eine besondere Art von Weltsicht oder eine bestimmte Methode, um ein ethischeres Leben zu führen? Oder ist der Buddhismus gar eine Art von Psychotherapie, eine Methode, die uns dabei helfen soll, mit uns selbst und den ständigen Widrigkeiten des Lebens klarzukommen? Der Buddhismus enthält von all diesen Elementen etwas und ist zugleich auch sehr viel mehr.
Der Buddhismus fordert uns dazu auf, unsere üblichen Vorstellungen von Religion zu überdenken. Er hat mit Wahrheiten zu tun, die über das bloß Rationale weit hinausgehen, und entfaltet eine transzendente Schau der Wirklichkeit, die all unsere normalen Denkkategorien übersteigt. Der buddhistische Weg ist eine Art von spirituellem Training, das im Lauf der Zeit zu einer direkten und persönlichen Einsicht in diese transzendente Schau führt.
Wir alle besitzen die Fähigkeit, klarer, weiser, glücklicher und freier zu werden, als wir es gegenwärtig sind. Wir können direkt bis ins Herz der Wirklichkeit vordringen und die Dinge erkennen, wie sie wirklich sind. Die Lehren und Methoden des Buddhismus haben letztlich nur ein Ziel: uns zu befähigen, dieses Potential vollständig in uns selbst zu verwirklichen.
Im Lauf seiner langen Entwicklungsgeschichte verbreitete sich der Buddhismus in allen Ländern Asiens. In jedem neuen Land führte die Wechselbeziehung der ursprünglichen lokalen Kulturen mit den Lehren des Buddha zu tiefgreifenden Veränderungen auf beiden Seiten. Häufig löste der Buddhismus eine kulturelle „Renaissance“ aus. In manchen Fällen, beispielsweise in Tibet, war er überhaupt erst der Wegbereiter für Kultur. Doch im Zuge seiner Verbreitung veränderte sich auch der Buddhismus und passte sich den örtlichen kulturellen Gegebenheiten an. So gibt es heute die verschiedenen Formen des Buddhismus von Sri Lanka, Thailand, Burma, Vietnam, Kambodscha, Laos, Tibet, China, der Mongolei, Russland und Japan – und innerhalb dieser Formen existiert wiederum eine verwirrende Vielfalt von Schulen, Sekten und Sub-Sekten. Doch was ist in diesem Formenreichtum das eigentlich Buddhistische? Was haben all die verschiedenen Ansätze gemein?
In erster Linie ist es der gemeinsame Ursprung. Bei all diesen Formen handelt es sich um Äste, Blätter und Blüten, die aus dem Stamm des frühen indischen Buddhismus gewachsen sind. Sie alle berufen sich auf den Buddha, und sie alle akzeptieren und verkünden die ursprünglichen Lehren des Buddha – wenn auch mit deutlich unterschiedlichen Schwerpunkten.
Um die Grundlagen des Buddhismus zu verstehen, muss man daher so weit wie möglich zum historischen Buddha zurückgehen. Dazu betrachtet man die frühesten Texte und versucht herauszufinden, was sie uns heute noch zu sagen haben. Damit sollen spätere Entwicklungen jedoch nicht zurückgewiesen werden. Der westliche Buddhismus tritt ja das Erbe der gesamten buddhistischen Tradition an. Elemente des japanischen Soto-Zen können wir ebenso sehr verehren, achten und praktisch anwenden wie Übungsformen des tibetischen Vajrayāna oder des thailändischen Theravāda. Um jedoch die Tradition als Ganze verstehen zu können, müssen wir zu ihren Wurzeln zurückkehren.
Die meisten grundlegenden Lehren dieses Buchs gehen auf den frühen indischen Buddhismus zurück. Ich hoffe daher, dass damit das, worüber Buddhisten unterschiedlicher Traditionen verschiedener Meinung sein können, auf ein Minimum beschränkt bleibt. Aus demselben Grund habe ich mich dort, wo die Einführung von buddhistischen Fachbegriffen notwendig war, generell an die frühindischen kanonischen Sprachen gehalten und mich je nach Kontext für Worte aus dem Pali oder Sanskrit entschieden.*
Mit diesem Buch verfolge ich vor allem die Absicht, die Leser an die ganze Breite der buddhistischen Tradition heranzuführen, und zwar, indem ich einige ihrer wesentlichsten (und somit am weitest verbreiteten) Elemente herausstelle. Ebenso möchte ich zeigen, dass den grundlegenden Lehren des Buddhismus eine Bedeutung zukommt, welche über ihre historischen Ursprünge hinausreicht. Vor allem hoffe ich, dass einige Leser dazu ermutigt werden, diese Lehren selbst auszuprobieren. Bücher können sehr nützlich sein, doch wenn man wirklich wissen möchte, worum es im Buddhismus geht, muss man ihn praktisch erproben. Selbst der talentierteste Schriftsteller kann nicht den wirklichen Geschmack einer Orange beschreiben; ebenso wenig kann ein Buch je die Essenz buddhistischer Praxis vermitteln.
„So wie der große Ozean nur einen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes“, sagte der Buddha, „ebenso haben meine Lehren nur einen Geschmack – den Geschmack der Freiheit.“
*Die frühesten buddhistischen Texte wurden auf Pali und Sanskrit niedergeschrieben, wobei die Pali-Texte die älteren sind.
Die meisten Fachbegriffe sind in dieser Ausgabe in der gängigen wissenschaftlichen Umschrift klein und kursiv gesetzt. Namen sind weitgehend an die deutsche Aussprache angepasst (im letzten Kapitel wurde die englische Schreibweise der vielen asiatischen Namen beibehalten). Wo erforderlich, geben wir nach dem jeweiligen Wort in Klammern einen Aussprachehinweis. Zur besseren Orientierung sind viele altindische Worte mit Betonungszeichen versehen (z. B. á). Manchmal ist das aus technischen Gründen nicht möglich, da das betonte Zeichen einen die Länge des Vokals anzeigenden Querstrich trägt. Die Betonung stimmt in diesen Fällen mit dem langen Vokal überein.
Am Ende des Buchs haben wir zum Nachschlagen die häufigsten und wichtigsten Fachbegriffe zusammengestellt. Hier wird dann zu jedem Wort die in Fachkreisen oder sonst in englischsprachigen Ländern übliche Umschrift angegeben. Anm. d. Hg.
1. DER BUDDHA
„Buddha“ ist kein Name, sondern ein Titel und bedeutet „der Erwachte“ – erwacht im Hinblick auf die höchste Wirklichkeit, auf die Tatsache, wie die Dinge wirklich sind. Man wird zu einem Buddha, indem man Erleuchtung erlangt – einen Zustand transzendenter Einsicht in die wahre Natur der Wirklichkeit. In der Geschichte des Buddhismus hat es viele erleuchtete Menschen gegeben, doch wird der Titel „Buddha“ normalerweise nur für einen bestimmten Erleuchteten verwendet, nämlich für Siddhártha Gáutama, den Begründer der buddhistischen Religion, den ersten Menschen unseres Zeitalters, der den Weg zur Erleuchtung gegangen ist.
Siddhártha wurde etwa um das Jahr 485 vor unserer Zeitrechnung in Lumbini geboren. Lumbini lag nahe bei der Stadt Kapilavastu in einer Region unterhalb der Ausläufer des Himalaja, dem heutigen Grenzgebiet zwischen Nepal und Indien. Es war eine Zeit großer politischer Umwälzungen. Etwas südlicher, im zentralen Ganges-Becken entstanden mächtige neue Königreiche, die sich allmählich die älteren, stammesregierten Republiken einverleibten. Einige Republiken konnten noch standhalten, und in einer davon, dem Reich der Schakjer, wurde Siddhártha Gáutama geboren.
Siddhárthas Familie gehörte zur Kaste der Krieger, und sein Vater war ein Mitglied der herrschenden Schicht. Spätere Überlieferungen, die nur noch die Monarchien kannten, die bald darauf die ehemaligen Republiken eroberten, betitelten Siddhártha als „Prinzen“ und seinen Vater Schuddhódana als „König“. Wie auch immer seine korrekte Bezeichnung war, wir wissen, dass Schuddhódana reich und mächtig gewesen ist und dass der junge Siddhártha ein privilegiertes Leben geführt hat.
Bei Siddhárthas Geburt verkündete ein Wahrsager, der Knabe würde entweder ein politisches oder ein spirituelles Reich anführen (der Name Siddhártha bedeutet „der sein Ziel erreichen wird“). Den Legenden zufolge wünschte der Vater des hübschen, begabten Knaben, dass er das Leben eines politischen und nicht eines spirituellen Führers führen sollte. Also versuchte er, ihn an die Vorzüge von Reichtum und Macht zu binden, indem er ihn mit jedem verfügbaren Luxus verwöhnte und ihn von den unangenehmen Tatsachen der Welt abschirmte. Er arrangierte Siddhárthas Heirat mit einer schönen, vornehmen und gebildeten jungen Frau namens Yáschodhára, die ihm einen Sohn mit Namen Ráhula schenkte.
Doch in Siddhártha wuchs allmählich ein nagendes Gefühl von Unzufriedenheit. Er spürte, wie hohl sein an der Oberfläche angenehmes Leben war, und er konnte dieses Gefühl nicht länger unterdrücken. Aufgrund der ihm eigenen Integrität konnte er nicht so tun, als sei alles in Ordnung. Ihm drängten sich intellektuelle und spirituelle Fragen auf, für die es in seiner privilegierten Umgebung keine Antworten gab. Diese Zeit des Erforschens und Fragens ist sehr plastisch in der Geschichte von den so genannten Vier Ausfahrten beschrieben, vier Erlebnissen, die dem jungen Krieger bei Fahrten mit seinem Wagen widerfuhren und die einen entscheidenden Einfluss auf ihn ausübten.
Der Legende nach erblickte er eines Tages am Straßenrand zum ersten Mal in seinem Leben einen alten Mann und erkannte erstmals die Unausweichlichkeit des Alterns. In ähnlicher Weise wurde er danach mit Krankheit und Tod konfrontiert. Diese Erlebnisse überwältigten ihn völlig. Was machte ein Leben voller Vergnügen und Luxus für einen Sinn, wenn im Hintergrund Alter, Krankheit und Tod darauf lauerten, bis sie auch ihn, seine Familie und seine Freunde ergreifen konnten? Schließlich sah Siddhártha einen umherziehenden Bettelmönch, durch dessen Anblick er zu ahnen begann, dass es vielleicht eine Alternative gab, als Alter, Krankheit und Tod passiv hinzunehmen. Aber er erkannte gleichzeitig, dass er einige radikale, sogar schmerzhafte Schritte unternehmen müsste, wollte er sich auf die Suche nach dieser Alternative machen.
So verbrachte Siddhártha seine jungen Jahre: ruhelos, von zutiefst existentiellen Fragen geplagt, hin und her gerissen zwischen dem Leben, das seine Familie für ihn vorgesehen hatte und der religiösen Suche, zu der sein rastloser Geist ihn antrieb. Nachdem er Alter, Krankheit und Tod als unausweichlich erkannt hatte, riefen die Vergnügungen und Unternehmungen der Schakjer-Oberschicht nur quälende Leere in ihm hervor. Die Familientradition verlangte, dass er „mitmachte“, dass er sein Gefühl der Nichtigkeit all dessen überwand und sich um seine Aufgaben als Krieger und in der Regierung kümmerte. Doch wenn er ganz ehrlich zu sich war, wusste er tief in seinem Herzen, dass ein Leben, das die grundlegendsten Wahrheiten ignorierte, nichts für ihn war. Er stand nun vor der Wahl zwischen zwei gleichermaßen schwierigen Alternativen. Er konnte seine Augen vor der Realität verschließen, oder auf Familie, Luxus und Macht verzichten.
Er entschied sich für die Suche nach der Realität und schlich sich im Alter von 29 Jahren, ohne dass seine Frau und sein Vater es gewusst oder gar gebilligt hätten, heimlich aus dem Haus und ließ Frau, Kind, Familie und sozialen Status hinter sich. Er schor sich Haare und Bart ab, tauschte seine Kriegertracht gegen das Lumpengewand eines Bettelmönchs und begann seine Suche nach Wahrheit und Befreiung.
Es war eine unruhige Zeit. Rivalisierende Könige trachteten danach, ihre Reiche zu vergrößern, und brachten allmählich die ursprünglich familien- und stammesorientierte Gesellschaftsordnung unter ihre Kontrolle. Die alte vedische Religion mit ihrer brahmanischen Priesterschaft geriet mehr und mehr ins Fahrwasser dieser zentralisierten Regierungen, und so entstand eine neue Gruppe von Religionsausübenden. Dies waren die Wanderasketen, die, unzufrieden mit den herrschenden Sitten und den leeren Ritualen der etablierten Religion, ihr Zuhause und ihre soziale Stellung aufgaben, um nach Belieben umherzuwandern, von Almosen zu leben und die spirituelle Befreiung zu suchen. Siddhártha wurde solch ein „Wanderer“.
Er besuchte die berühmtesten spirituellen Lehrer seiner Zeit, die er jeweils schon bald in ihren spirituellen Einsichten übertraf. Er sah, dass selbst die erhabensten Geisteshöhen, in die sie ihn führten, ihm nicht die Antworten gaben, nach denen er suchte. So verließ er einen Lehrer nach dem anderen und setzte seine Suche allein fort.
Es war damals ein weit verbreiteter Glaube, dass man zur Befreiung des Geistes das Gefängnis des fleischlichen Körpers schwächen müsste. Also übte Siddhártha sich während der folgenden sechs Jahre in einigen extrem strengen Formen religiöser Kasteiung. Er trug keine Kleider, wusch sich nicht und verbrachte immer längere Zeiten ohne Essen und Schlaf.
… meine Glieder wurden wie dürres Rohr; wie ein Kamelhuf wurde mein Gesäß, mein Rückgrat wie eine Kugelkette, meine Rippen wie Dachsparren eines alten Hauses. Wie Wassersterne tief unten in einem Brunnen, so erschienen meine Augensterne tief versunken in meinen Augenhöhlen. Wie ein aufgeschnittener Kürbis in heißer Sonne, so schrumpfte meine Kopfhaut zusammen. Wenn ich meinen Bauch anfühlen wollte, berührte ich mein Rückgrat, und wenn ich das Rückgrat anfühlen wollte, berührte ich die Bauchhaut. … Wenn ich mit der Hand die Glieder rieb, fielen die wurzelfaulen Haare ab.1
Er erlangte großen Ruhm für die Intensität seiner asketischen Praxis. „Wie der Klang einer Glocke“ verbreitete sich dieser Ruhm in Nordindien und brachte ihm eine richtige Anhängerschaft. Doch das stellte ihn immer noch nicht zufrieden. Sechs Jahre nachdem er sein Zuhause verlassen hatte, war er der Lösung der grundlegenden Fragen der Existenz kein bisschen näher gekommen. Siddhártha erkannte, dass seine Entbehrungen ihn nirgendwohin gebracht hatten. Trotz seines großen Namens und hervorragenden Rufs als heiliger Asket hatte er den Mut, auch diesen Weg aufzugeben. Er begann wieder mäßig zu essen, woraufhin ihn seine Schüler, empört und entsetzt über seinen Rückfall, verließen.
Jetzt war er völlig auf sich gestellt. Familie, Stamm, Ansehen, Anhänger – er hatte alles hinter sich gelassen. Sämtliche Versuche, den Schleier der Unwissenheit zu durchdringen, waren gescheitert. Er war verzweifelt und wusste nicht, was er nun tun sollte. Nur eins wusste er genau: Er würde seine Suche nicht aufgeben.
Da fiel ihm ein früheres Erlebnis wieder ein. Als Junge hatte er einmal im Schatten eines Rosenapfelbaums gesessen und seinem Vater beim Pflügen zugesehen. Entspannt vom langsamen, stetigen Rhythmus der beiden Ochsen und zufrieden im kühlen Schatten sitzend, war er spontan in einen konzentrierten meditativen Zustand hinübergeglitten. Könnte dies der Weg zur Erleuchtung sein?
Der Legende nach setzte sich Siddhártha in diesem Zustand akuten, existenziellen Alleinseins mit gleichwohl unerschütterlicher Entschlossenheit unter einen Baum und erklärte:
Mein Fleisch möge welken und mein Blut vertrocknen, doch ich werde diesen Sitz nicht eher verlassen, bis ich Erleuchtung erlangt habe!
Viele Tage und Nächte lang saß er dort in tiefer Meditation. Die Legenden schildern lebhaft den existentiellen Kampf, den Siddhártha damals durchmachte. Dabei begegnete er Mara, dem Bösen – der archetypischen Verkörperung all dessen, was zwischen uns und der Wahrheit steht. Als er Siddhártha so entschlossen in tiefer Meditation sitzen sah, bekam es Mara mit der Angst zu tun:
Er hatte seine drei Söhne – Zerstreuung, Frohsinn und Dünkel – bei sich sowie seine Töchter – Unzufriedenheit, Verzückung und Lust. Sie fragten ihn, weshalb er so beunruhigt war. Er antwortete ihnen mit den Worten: „Seht diesen Weisen da, bekleidet mit der Rüstung der Entschlossenheit, mit Wahrhaftigkeit und spiritueller Tugend als seinen Waffen, die Pfeile seines Intellekts bereit zum Schuss! Er hat sich dort mit der festen Absicht niedergelassen, mein Reich zu erobern. Kein Wunder, dass ich mir Sorgen mache! Falls er mich erfolgreich überwinden und der Welt den Weg zum endgültigen Glück zeigen sollte, wäre mein Reich vernichtet. Doch noch hat er nicht das vollständige Wissen erlangt. Noch befindet er sich in meinem Einflussbereich. Solange noch Zeit dazu ist, will ich seinen feierlichen Vorsatz brechen und mich auf ihn werfen wie ein reißender Fluss gegen die Uferböschung!“ Doch Mara konnte gegen den künftigen Buddha nichts ausrichten. Samt seiner Armee wurde er besiegt und sie flohen in alle Richtungen: ihr Jubel verstummte, ihre Anstrengungen brachten kein Ergebnis, ihre Felsbrocken und Baumstämme lagen überall verstreut. Sie glichen einer feindlichen Armee, deren Anführer im Kampf geschlagen worden war. Besiegt, rannte Mara mit seiner Gefolgschaft davon. Der große Seher, befreit vom Staub der Leidenschaft, siegreich über die bedrückenden Mächte der Dunkelheit, hatte ihn überwunden.2
Siddhártha saß ruhig unter dem Baum und gestattete seinem Geist, Stille zu finden. Nach und nach begannen die verschiedenen Strömungen seines Geistes zusammenzufließen. Seine Konzentration nahm stetig zu. Je gesammelter Siddhárthas Geist wurde, desto klarer und leuchtender wurde er. Siddhártha ließ diesen Prozess durch nichts stören oder behindern, sondern erlaubte ihm sich zu entfalten und an Kraft zu gewinnen. Immer weiter und immer tiefer versenkte sich sein Geist in die Meditation, bis er so klar wie ein funkelnder Diamant war und immer heller strahlte. Siddhártha erfüllte dabei ein Gefühl tiefer Freude, das ihn jedoch nicht abzulenken vermochte. Er ließ auch diese Freude los und erreichte so Bewusstseinszustände von immer tieferem Gleichmut.
Allmählich begann das leuchtende Strahlen seines konzentrierten Geistes auch seine Vergangenheit zu erhellen. Siddhártha konnte sich an alle Einzelheiten bis hin zu seiner frühesten Kindheit erinnern. Und dann, plötzlich, konnte er sogar noch weiter zurückblicken, und frühere Leben tauchten in seinem Gedächtnis auf. Während seine Konzentration sich mehr und mehr vertiefte, konnte er immer weiter zurückschauen, und er sah, wie ein endloser Strom vergangener Leben in unaufhörlicher Folge vor seinem inneren Auge vorüberzog. Hier war er geboren worden, mit diesem Namen, hatte auf diese Art gelebt, war in diesem Alter gestorben und an jenem Ort wieder auf die Welt gekommen – immer und immer wieder. Er sah jedes seiner Leben mit all ihren Einzelheiten, weiter und weiter, in einem nie endenden Rhythmus. Geburt, Altern, Krankheit und Tod; Geburt, Altern, Krankheit und Tod – ein Kreislauf ohne Ende.
Dann fielen die Begrenzungen, die ihn von anderen getrennt hatten, von ihm ab, und er sah die Leben zahlloser anderer Wesen vor sich, ihre Mühen, ihre Erfolge und ihr Scheitern, und erlebte den unausweichlichen Rhythmus ihres Lebens: Geburt und Tod, Geburt und Tod, Geburt und Tod – den zeitlosen Pulsschlag der leidenden Menschheit.
Allmählich konnte Siddhártha in diesem nicht endenden Fluss von Veränderung ein Muster erkennen. Diejenigen, deren Leben von Freundlichkeit und Großzügigkeit geprägt war, wurden unter glücklichen Umständen wiedergeboren; wer sich von Gier und Hass hatte leiten lassen, kam unausweichlich unter leidhaften Bedingungen wieder auf die Welt. Indem er Leben um Leben betrachtete, entdeckte er, dass er die Folgen menschlicher Handlungen vorhersagen konnte. Wer anderen zu Glück verhalf, brachte auch für sich selbst glückliche Umstände hervor; wer Leiden und Trennung verursachte, fand sich allein in einer feindlichen Welt wieder. Dies war so offensichtlich, und doch konnten die Menschen es nicht erkennen, weil sie zu sehr mit ihren kleinen Alltagssorgen beschäftigt waren.





























