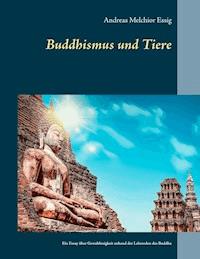
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nach der buddhistischen Lehre haben alle Lebewesen das gleiche Anrecht auf Freiheit, Glück und Liebe. Dies gilt absolut unabhängig von der Hautfarbe, dem Geschlecht oder der Art eines Lebewesens. Ein wesentlicher Aspekt der buddhistischen Meditationspraxis zielt daher darauf ab, ein stabiles Bewusstsein dieser Gleichberechtigung zu etablieren und einen wohlwollenden Geist für alle Lebewesen zu entfalten. Die Geistesschulung in dieser bedingungslosen Liebe sollte einhergehen mit ethischen Reflexionen und einem grundlegenden moralischen Verhalten. Der Buddha hat daher in Lehrreden verschiedener Quellen eindeutige Aussagen dazu gemacht und gefordert, dass ernsthaft praktizierende Anhänger gegenüber Tieren gewaltlos und hilfsbereit sind. Das impliziert, dass eine vegetarische oder vegane Lebensweise angemessen ist. Insbesondere in der gegenwärtigen Entwicklung, in der die massenhafte Produktion von Fleisch ein unvorstellbares Ausmaß an Leiden schafft, sind diese Worte des Buddha von Bedeutung. Leider gibt es über die Frage, ob der Buddha das Essen von Fleisch verboten hat, viele Missverständnisse. Vielfach besteht auch die Vorstellung, der Buddha hätte diesen Punkt nicht abschließend bestimmt. Dieses Essay soll zeigen, dass es eine eindeutige und unmissverständliche Position des Buddha zu dem Thema Fleischessen gibt. Dabei werden zahlreiche Zitate aus mehreren Lehrreden als authentische Quelle herangezogen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Verschleierte Kausalität
Versachlichung eines Lebewesens
Śrāvakayāna
4.1 Jīvaka Sutta
4.2 Angebot und Nachfrage
4.3 Unterschied zwischen einem Auftrag und dem direkten Töten von Tieren
4.4 Pātimokkha –Sorgsamkeit im Umgang mit Tieren und Kleinstlebewesen
Bodhisattvayāna
5.1 Śūragama Sūtra
5.2 Lakāvatāra Sūtra und Mahāparinirvāna Sūtra
Vajrayāna
6.1 Kriya-Tantra
6.2 Anuttara-Yoga-Tantra
6.3 Ausnahmeregelung im Vajrayāna: Krankheit
6.4 Ausnahmeregelung im Vajrayāna: Rituale
6.5 Missverständnisse von Vajrayāna-Praktizierenden
Bedingungslose Liebe für Tiere
7.1 Vegetarismus oder Veganismus?
7.2 Vegetarismus und Veganismus sind allein noch kein Weg
7.3 Ein Herz für Tiere entwickeln und erweitern
7.3.1 Entschleierung der Kausalität
7.3.2 Mitgefühl
7.3.3 Bedingungslose Liebe
1. Einleitung
Die bedingungslose Liebe und das grenzenlose Mitgefühl sind in allen Traditionen des Buddhismus zentrale Geisteshaltungen. Eine meditative Praxis, die Liebe und Mitgefühl unberücksichtigt lässt und nur auf die persönliche Entspannung und Sorgenfreiheit ausgerichtet ist, ist im Grunde ohne Essenz. Wenn uns der buddhistische Pfad nicht von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat und von Tag zu Tag zu einem warmherzigeren Menschen werden lässt, ist der Funke des erwachten Geistes noch nicht in unser Bewusstsein eingedrungen.
Wir alle wissen das aus Erfahrung oder intuitiv als Menschen, denen die Güte als Talent mitgegeben ist. Dennoch stellen uns die Herausforderungen des täglichen Lebens immer wieder vor neue Herausforderungen. Es ist nicht leicht, ein in allen Lebenslagen gütiger und mitfühlender Mensch zu sein. Das Ideal, das der Buddha vorgelebt hat, ist überragend und die Zerstreuungen des Alltags lassen dieses absolute Ziel bisweilen fern oder gar unerreichbar erscheinen.
Hinzu kommen gesellschaftliche Strukturen, die im 21. Jahrhundert mehr denn je „egoistisch“ genannt werden können. Das ökonomische Denken, der Erfolgsdruck, die Vereinzelung, die Beschleunigung – diese und andere Schlagwörter drücken eine Tendenz aus, die im krassen Gegensatz zu der Ausrichtung eines im buddhistischen Sinne heilsamen Lebens steht. Kapital scheint ein Zweck an sich zu sein. Der Wettbewerb um dieses fiktive Gut, das schon so oft in der Geschichte wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist, treibt die Akteure in ihrem Wahn zu immer größerer Herzlosigkeit.
Das Tier als Ware, als Sache, als wirtschaftliches Produkt, dem kein Recht auf Lebensentfaltung und Lebensgefühl zusteht – das ist tatsächlich eines der größten Probleme unserer Zeit. Die künstliche Beschleunigung des Wachstums eines Tierkörpers und die totale Reduktion eines Lebewesens auf seinen materiellen Verwertungsgehalt, zeigen erschreckend, was der Mensch sein kann, wenn sein Herz erkaltet und sein Verstand nur den eigenen Vorteil sucht.
Dabei sind aus buddhistischer Sicht die Täter nicht weniger bemitleidenswert als die Opfer. Von den karmischen Folgen solcher Einstellungen einmal abgesehen, ist ein gefühlloser Geist klein und verkrampft. Welcher Geist sollte denn ein inneres, befreites Glück erleben können, dessen Gedanken den Willen und die Gefühle anderer Lebewesen völlig missachtet? Wie sollen wir uns selbst lieben und unseren innersten Wünschen gerecht werden können, wenn wir blind für die Bedürfnisse anderer Wesen sind? Uns allen ist klar, dass das unmöglich ist. Ein Herz, das andere Herzen missachtet, empfindet keine Freude.
2. Verschleierte Kausalität
Das Phänomen der massenhaften Fleischproduktion ist ein Produkt unserer Zeit. Alles wird dem Prinzip des Marktes untergeordnet, so auch das Züchten und Schlachten von Tieren. Zu der Zeit das Buddha gab es keine Rationalisierung und auch keine Massentierhaltung. Daher gibt es auch keine Lehrreden des Buddha, aus denen wir explizit eine Antwort auf die Frage erhalten, wie wir uns dieser Entwicklung gegenüber verhalten sollten.
Ist es unethisch Fleisch zu essen, das aus der Massentierhaltung stammt? Sollten wir ausschließlich Fleisch mit einem Bio-Siegel essen? Sollten wir ganz auf den Konsum von Fleisch verzichten? Oder gibt es vielleicht gar keine ethisch-moralische Verbindlichkeit bezüglich des Fleischkonsums für Menschen, die Zuflucht in die Lehre und Praxis des Buddha nehmen?
Feststellen können wir zunächst, dass ganz losgelöst von ethischen Reflexionen der lieblose und zum großen Teil auch verachtende Umgang mit Rindern, Schweinen, Hühnern und anderen Tieren uns alle in irgendeiner Weise erschüttert. Selbst Menschen, die sonst mit wenig Bedacht durch das Leben zu gehen scheinen, sind betroffen, wenn sie Bilder aus Schlachthäusern sehen. Selbst den überzeugtesten Fleischessern kommt ein Moment des Zweifels, wenn sie in den Nachrichten erfahren, dass mehr als 100.000 Tiere pro Jahr in Deutschland vor dem Schlachten nur teilweise oder gar nicht betäubt sind und folglich bei vollem Bewusstsein, minutenlang an den Beinen hängend, mit dem Kopf nach unten ausgeblutet werden1.
Auf der anderen Seite ist die Gewöhnung an und die Lust auf das Fleischessen so groß, dass ein Verzicht in aller Regel2 ausgeschlossen erscheint. Auch gesundheitliche Argumente spielen eine große Rolle, da die Überzeugung allgemein sehr ausgeprägt ist, Fleisch sei für eine gesunde und reichhalte Ernährung unabkömmlich.
Eine geschickte Lösung dieses Widerspruchs zwischen Mitleid und Verlangen sind die betriebliche Zucht und der Handel. Der Konsument erwirbt und verköstigt die Wurst wie ein lieblich verpacktes Produkt an sich, wie etwas, das unabhängig von Züchten und Töten existieren würde. Wenn die Wurst fein gewürzt und mit Siegel in der Theke liegt, sehen wir nicht das Leiden des Tieres, das seinen Körper für unseren Konsum, für unseren Genuss auf der Zunge hergeben musste. Und selbst wenn wir in Dokumentationen von den Leiden der Tiere hören, stellt sich doch der volle Genuss des Fleisches wieder her, wenn nur die schrecklichen Bilder aus dem Schlachthaus wieder aus dem Bewusstsein gewichen sind. Gleichwohl gibt es eine ununterbrochene kausale Verbindung zwischen dem Fleisch auf unserem Teller und dem Tier, das optimaler Weise auf einer Weide gelebt hat.
Die Bedienung im Restaurant stellt das Fleisch vor uns auf den Tisch. Dieses hat sie von dem Koch empfangen. Der Koch hat das Fleisch aus dem Kühlschrank genommen. Dorthin gelangte es durch den Einkäufer, der es in einem Großhandel erworben hat. In die Regale des Großhandels wurde es von Verkäufern gelegt, nachdem ein Lastwagenfahrer das verpackte Fleisch aus der Schlachterei angeliefert hat. Dort hatte der Fahrer das Fleisch am Warenausgang erhalten. Die Verpackungsabteilung hat es dorthin befördert, nachdem die Fleischstücke von der Schlachtabteilung zugeschnitten worden waren. Vor dem Zuschnitt wurde das Tier betäubt und ausgeblutet. Vor der Betäubung wurde das Tier vom Bauer angeliefert und vor der Anlieferung wurde das Tier aus jener Gruppe von Tieren getrennt, mit denen es sein Leben bis dahin verbracht hatte.
Denken wir nun an dieses Tier, das auf unserem Teller liegt und ehemals in einer Gemeinschaft mit anderen Tieren in der Zucht gelebt hat. Dieses Tier hatte Empfindungen von Glück und Leiden. Dieses Tier hatte einen Willen, ein Streben nach Glück, wie auch wir dieses Streben haben. Es wollte Schmerzen vermeiden und wohlschmeckendes Futter zu sich nehmen. Als es noch klein war, wollte es spielen und herumtollen. Vieles wäre zu dem Lebenswillen des Tieres zu sagen.
Genauso, wie wir zurückweichen, wenn wir ausversehen die heiße Herdplatte berühren und wie wir den Schatten suchen, wenn die Sonne brennt, so auch wollte dieses Wesen Schmerzen und unangenehme Dinge vermeiden. Es hatte kaum die Möglichkeit dazu, allein etwas an seiner eigenen Situation zu ändern. Die Lebensbedingungen dieses Wesens waren durch den Menschen vorgegeben und das Tier hatte keine Wahl, in welchem Stall es lieber leben wollte. Und wenn es von einer Krankheit befallen gewesen sein mag, so konnte es kaum auf sich aufmerksam machen und etwas für seine Gesundung tun. Anders als wir, ist dieses Lebewesen zum großen Teil in seiner Existenz dem Willen anderer unterworfen gewesen.
Nun, niemand verbietet uns, Fleisch zu essen. Doch es ist eine Tatsache, dass wir gewöhnlich diesen Zusammenhang vollkommen ausblenden und dass wir keine gedankliche Verbindung zwischen dem Fleisch auf unserem Teller und dem Lebewesen, das diesem Fleisch zugrunde liegt, herstellen. In diesem Sinn betrachten wir diese Komponente mit einem verdunkelten Geist, der keinen Blick für Ursache und Wirkung hat.
1 Siehe dazu: Schweinerei im Schlachthof, Dokumentation des ZDF: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzoom/zdfzoom-schweinerei-im-schlachthof-100.html, 20.05.2018
2 Die Angaben über die Anzahl der Vegetarier in Deutschland variieren zwischen 5% und 10% für das Jahr 2017.
3. Versachlichung eines Lebewesens
Es fällt dem Menschen eigentlich schwer zu töten. Eine große Vielzahl derer, die gerne Fleisch essen, würden selbst niemals ein Tier töten. Sie würden es nicht über das Herz bringen, dem Huhn den Kopf selbst abzuhacken, weil sie dabei spürten, wie sehr das Tier leben will, wie sehr das Tier um sein Leben kämpft. Ohne eine innere Distanz zu dem Lebewesen, das getötet werden soll, ist es nicht möglich, zu töten. Der Schlachter muss das Tier in bestimmtem Maße als Sache, als Ware und als Grundlage eines Produktes, dem verkäuflichen Fleisch betrachten und die Empfindsamkeit des Lebewesens ausblenden.
Ich bin davon überzeugt, dass selbst ein Schlachter, der täglich guter Laune seine Arbeit ausführt, sehr große Abneigung verspüren würde, wenn er sein eigenes geliebtes Haustier schlachten sollte. Es würde ihm ähnlich schwerfallen, wenn er die zu schlachtenden Tiere gut kennen sollte, das eine Tier vom anderen zu unterscheiden wüsste, die Eigenheiten der Tiere erfahren hätte und auch ein Bewusstsein für die Gewöhnung hätte, die die Tiere untereinander und füreinander empfinden. Je stärker sich der Schlachter darüber bewusst wäre, dass das zu schlachtende Tier ein einzigartiges Wesen ist, mit individuellen Merkmalen und Verhaltensweisen, desto schwerer würde es ihm fallen, seinen Beruf auszuüben. Mit anderen Worten: Das Töten eines Tieres ist nur dann ohne Gewissensbisse möglich, wenn der oder die Tötende kein Bewusstsein für die Empfindsamkeit, den Willen und die Einzigartigkeit des zu tötenden Tieres hat.





























