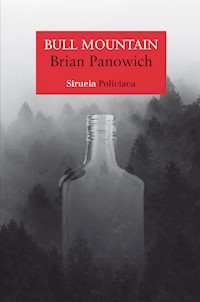9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bull-Mountain-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Sie wollte sich nie in die Geschäfte der Familie einmischen. Doch als die Familie zu zerfallen droht, bleibt ihr keine ander Wahl. Kate Burroughs hat schon einmal ihre dunkle Seite zeigen müssen. Um ihren Mann und ihren Sohn zu schützen, muss sie es wieder tun.
Jahrzehntelang herrschte der Burroughs-Clan über Bull Mountain – ein Drogenimperium im Norden Georgias. Die Macht wurde von Vater zu Sohn und von Bruder zu Bruder weitergegeben. Jetzt sind fast alle Burroughs-Brüder tot. Der letzte Überlebende, Clayton, ist ein gebrochener Mann im Kampf mit seinen Dämonen.
Als konkurrierende Clans zur feindlichen Übernahme von Bull Mountain ansetzen, ist es Claytons Frau Kate, die als erste erkennt, dass es nur einen Weg gibt, sich und ihren neugeborenen Sohn zu schützen: Sie muss den Burroughs-Clan einen und in seine vielleicht letzte große Schlacht führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Ähnliche
Brian Panowich
Bull Mountain burning
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch vonJohann Christoph Maass
Suhrkamp
Für Neicy
Für Mom
Und für meine Welpen,
Talia, Ivy & Olivia
Strike a few matches Laugh at the fire Burn a few edges Put them back in the pile Swing from the pain I don’t want to kill It’s time to go play in a minefield.
Travis Meadows
Wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter.
Winston Churchill
Prolog
Bull Mountain, Georgia
1972
Annette kannte jede Diele in- und auswendig.
Es hatte Monate gedauert, sich das Schema einzuprägen. Sie wusste, welche Bohlen knarzten und stöhnten, wenn sie darauf trat, weshalb sie genau darauf achtete, mit ihren nackten Füßen nur auf die paar wenigen zu treten, die fest angenagelt waren. Diese ganz bestimmten Streifen alter Eiche waren ihre Verbündeten geworden. Ihre Freunde. Sie schenkte ihnen das Vertrauen, sie nicht zu verraten. Dasselbe konnte sie über nichts und niemanden sonst sagen. Trotzdem, sie war achtsam, denn dies war der erste Versuch, die Route im Dunkeln abzulaufen. Sie zählte jedes Mal bis zehn, wenn sie ihr Gewicht auf eine von ihnen verlagerte, und tappte in Zeitlupe im Zickzackkurs durch den Flur. Sie passierte den Raum, den sich ihre beiden ältesten Söhne teilten. Vielleicht würde nach heute Nacht das permanente Gezanke zwischen den beiden darüber, wer in die obere Koje durfte, endlich aufhören. Der Gedanke war ein schwacher Versuch, das, was sie nun vorhatte, mit einem besseren Gewissen zu tun. Sie verharrte vor der Tür der Jungen und lauschte dem leicht durchbrochenen Schnarchen, hervorgerufen von der verkrümmten Nasenscheidewand ihres mittleren Sohnes. Sie erinnerte sich gut an den Tag, an dem er sich den zerstörten Knorpel eingehandelt hatte. Sein Vater war nicht gerade begeistert gewesen, als der Junge eine Dose Farbe in der Scheune verschüttet hatte. Er war vier Jahre alt gewesen. Sie lehnte sich gegen das solide Holz des Türpfostens – ein weiterer erprobter Komplize – und ließ zu, dass ihr das nasale Atmen ihres Sohnes zumindest in einem Ausmaß das Herz brach, dass es ihr selbst den Atem verschlug – allerdings nicht so sehr, als dass sie selbst ein Geräusch von sich gegeben oder Tränen vergossen hätte. Ihre Tränen waren vor langer Zeit versiegt. Sie führte zwei Finger zu den Lippen und platzierte dann den Abschiedskuss sanft auf der Tür. Sie schaute zu Boden und suchte nach der nächsten Diele in der Abfolge, dann nach der nächsten. Sie bewegte sich so langsam und flüssig wie Molasse. Einige Minuten später erreichte sie die letzte Tür zu ihrer Linken. Sie hielt inne, geräuschlos wie ein Dieb, und kam sich auch wie einer vor. Vorsichtig klemmte sie sich die Sportschuhe aus dem Ramschladen unter die Achsel. Sie hatte sie vor einigen Wochen während einer ihrer unbegleiteten Ausfahrten ins Tal unten in Waymore aus einer Mülltonne gefischt und sie in ihrem Schrank unter der Brauttruhe versteckt. Es waren Männerschuhe, und sie waren zwei Nummern zu groß, aber sie würden ihre Füße draußen vor Dornen und dem Brombeergestrüpp im Wald schützen – besser schützen als alles, was ihr zu besitzen je gestattet gewesen war. Sie ließ die Hand auf dem angelaufenen Messingknauf der Schlafzimmertür ruhen. Noch immer im Schneckentempo, nahm sie sich beinahe eine ganze Minute Zeit, den Knauf so weit zu drehen, bis der Metallzahn des Schlosses sich aus dem Schnapper zurückzog. Sie hatte die Scharniere gestern am frühen Morgen geölt, damit sich die Tür vollkommen geräuschlos bewegen ließ. Auch sie war zu einer Verbündeten geworden, trotzdem nahm sie sich Zeit, sie Zentimeter für Zentimeter zu öffnen.
Das Baby schlief. Annette durchquerte den mondhellen Raum, setzte nach wie vor jeden einstudierten Tritt mit Bedacht und sah zu, wie sich die Brust ihres jüngsten Sohnes in der Wiege hob und senkte. Sein Anblick genügte ihr, um festzustellen, dass sie noch immer die Fähigkeit besaß zu weinen. Vor der Wiege bahnte sich die Feuchtigkeit hinter den dunklen Tränensäcken unter den Augen ihren Weg. Sie war sich sicher, sie würde zu weinen beginnen. Sie war sich ebenso sicher, dass das ihr Ende bedeuten würde. Ihre Tränen. Das Salz würde ihr die Sicht verschleiern und dafür sorgen, dass sie einen falschen Schritt machte, und ein einziges leises, unfreiwilliges Schniefen würde in der Todesstille des Hauses gellen wie eine Sirene. Die Unfähigkeit, ihre Gefühle zu unterdrücken, würde der Grund dafür sein, warum sie erwischt wurde. Und sie würde ihren Tod bedeuten. Sie schloss die Augen und atmete tief durch. Sie dachte zu viel nach. Sie musste los. Mondlicht schien durch die Vorhänge, die sie aus einem alten Bettlaken gemacht hatte, und das bläuliche Licht verwandelte das rostrote Haar des Babys in blanken Kupferdraht. Sie beugte sich vor und glättete mit dem Handrücken die dünnen Strähnen auf seinem fragilen Schädel, nahm ihn dann schnell ihn die Arme und drückte ihn an ihre Brust. Ihre Bewegungen waren unbeholfen und hastig, und beinahe hätte sie einen der Schuhe fallenlassen. In diesem Moment war ihr Herzschlag so heftig, dass er jeden Muskel durchzuckte. Sie stand mit geschlossenen Augen da und presste mit dem Ellbogen den Schuh gegen die Hüfte. Sie stand so lange starr da, bis sie spürte, wie sie wieder atmete. Sie positionierte den Schuh erneut unter der Achselhöhle und drückte das Baby an sich, als es aufwachte.
»Shhh«, wisperte sie mit kaum hörbarer Stimme. »Ich bin ja da.«
Beruhigt durch die Wärme und Geborgenheit der Mutter, sank das Baby wieder in den Schlaf, ohne auch nur einen Mucks zu machen. Dies war das Einzige, was sie hatte dem Zufall überlassen müssen. Das Einzige, was sie nicht hatte planen können. Die Reaktion des Säuglings auf sie hätte alles gleich hier und jetzt beenden können, aber ihr Sohn, ihr makelloser Wonneproppen, würde ihr heute Nacht nicht zum Verhängnis werden. Zwei ihrer Söhne waren ihr bereits abhandengekommen, ihr gestohlen worden. Hilflos hatte sie über die Jahre hinweg zusehen müssen, wie dieser Ort seinen Anspruch auf sie geltend gemacht hatte. Sie hatte gedacht, dass wenn die Jungen erst etwas älter waren, sich in ihnen auch ein Fünkchen von ihr zeigen würde, aber da war nichts. Nichts gedieh in ihren Herzen außer demselben kohlpechrabenschwarzen Nichts, das bereits von ihrem Ehemann Besitz ergriffen hatte, seinem Vater und so vielen seiner Familie vor ihm.
Aber nicht von dir. Annette legte ihre Hand auf den flaumigen Kupferkopf des Säuglings. Noch kann ich dich retten. Wir können einander retten.
Sie zog sich von der Wiege zurück und schlüpfte so geräuschlos aus dem Zimmer, wie sie hineingekommen war, ließ dabei die Tür offenstehen, damit Mondlicht in die Diele fiel und ihr den Weg zur Vordertür – zum Wald – und in ihr neues Leben wies.
Die vergangenen Monate über hatte Annette ihren Mann bestohlen – bloß ein paar Dollar hier und dort. Von Gummibändern zusammengehaltene Bündel und lose Stapel von Zehn- und Zwanzig-Dollar-Scheinen lagen überall im Haus herum, so dass sie sich sicher war, die kleinen Beträge, die sie sich in den Ärmel gesteckt oder beim Putzen in den BH gestopft hatte, würden niemals auffallen. Sie hatte ihre Fluchtkasse mit einem roten Zopfgummi fixiert und sie in einem Marmeladenglas in der Nähe einer Gruppe von Amberbäumen am Rande der Rodung vergraben. Sie hatte außerdem etwas in Plastikfolie verpacktes Brot und gepökeltes Hirschfleisch gebunkert und eine Wolldecke für das Baby, falls das Wetter umschlagen sollte, aber heute Nacht war es trocken und heiß. Sie würde sie nicht brauchen. Das war gut. So musste sie weniger tragen.
Die Vordertür ließ sich mit der gleichen geölten Leichtigkeit öffnen wie die Tür zum Kinderschlafzimmer. Hier musste sie keine Schlösser öffnen. Es gab sie, aber sie waren nie nötig. Niemand traute sich, dieses Haus zu betreten. Es wurde verschlossen gehalten von Angst, und diese Angst hielt Eindringlinge davon ab, überhaupt nur darüber nachzudenken, es zu betreten. Sie hatte auch Annette davon abgehalten, darüber nachzudenken zu gehen. Vorsichtig drückte sie die Fliegengittertür auf. Das laute Klicken, das der Schnapper der Tür normalerweise produzierte, wurde durch einen kleinen Streifen Gewebeklebeband unterbunden. Sie hatte ihn dort angebracht, bevor sie zu Bett gegangen war. Das war ein riskantes Manöver gewesen und hätte entdeckt werden können, aber sie hatte keine Wahl gehabt. Statt des Klickgeräuschs des sich öffnenden Schnappers zu dieser Nachtzeit hätte genauso gut das Horn des Erzengels Gabriel ertönen können. Als sie gegen das Schutzgitter drückte, konnte sie sogar das Phantomecho in ihrem Kopf hören. Sie würde das Geräusch niemals vergessen, egal wie weit sie es auch hinter sich ließ. Es würde sie ewig heimsuchen. Es war das Geräusch einer Gefängniszelle, die sich allabendlich schloss. Sie just mit der Sache einschloss, die alle anderen außen vor hielt.
Auf der Veranda angelangt, im schwarzen Schatten des Vordachs, ließ sie die Tür zurück in den Rahmen gleiten und machte dann zwei große Schritte zu dem soliden Mauerstein am oberen Ende der Treppe. Gleich jenseits des Hofs und der Rodung vor ihr lag das Leben, von dem sie bereits beinahe zehn Jahre lang träumte. Ein Leben, das sie akribisch in allen Details heraufbeschworen hatte. Für sie und ihren Sohn, irgendwo weit weg von dem Blut und Zorn, die ihre Welt beherrschten. Sie spürte, wie die kalte Luft den Schweiß in ihrem Nacken kühlte, und sie gestattete sich, erneut tief durchzuatmen. Noch im selben Augenblick, als sie den süßen Geruch von Tabak und Maiswhiskey roch, der sich mit der Nachtluft mischte, legte sich unter der Haut eine Eisschicht um ihre Knochen.
Nein.
Sie schloss die Augen und lauschte. Außer dem Zirpen der Grillen war nichts zu hören. Dort war nichts, aber sie musste auch gar nichts hören, um zu wissen, dass er da war. Sie wusste es einfach.
Sie presste die Augen zu und drückte das Baby so fest an sich, wie sie konnte. Ihr Körper blieb ruhig, aber ihre Gedanken rasten. Sie betete zu Gott, es möge nur ein Streich sein, den ihr ihre Phantasie spielte. Sie flehte ihn an.
Gott sagte: Renn.
Sie konnte sich nicht bewegen, und nach diesem Augenblick des Zögerns gab es keinen Gott mehr, der der Rede wert gewesen wäre, nur noch das sanfte Klicken des Hahns am Revolver ihres Mannes.
»Ist es ein anderer Mann?«, hörte sie ihn aus der Dunkelheit hinter ihr sagen.
Sie konnte sich noch immer nicht rühren, nicht einmal zusammenzucken. Nicht sprechen. Das Eis, das ihre Knochen umgab, breitete sich in ihrem Blut aus, verwandelte es in dickflüssigen Brei. Die Pinien am anderen Ende der Rodung wogten in Zeitlupe, während sich der Abstand zwischen ihnen und ihr verdreifachte. Sie konnte nicht einmal blinzeln, obgleich ihre Augen trocken und kalt waren.
»Ich habe dich etwas gefragt, Frau.«
Sie wusste, er würde sie kein drittes Mal auffordern. Sie fand ihre Stimme und antwortete ehrlich.
»Nein.«
»Ist es, weil ich dich geschlagen habe?«
»Nein.«
»Warum dann?«
Sie wollte lügen, wusste aber, es war sinnlos. Sie sagte nichts.
»Du hast fast zehn Minuten gebraucht, um durch den Flur zu kommen. Ich bin hier draußen fast eingeschlafen.«
»Ich …«
»Solltest du in Erwägung ziehen, den Mund aufzumachen, um mich anzulügen, Annette, dann wird die Sache hier noch hässlicher, als sie bereits ist. Ich frage dich also noch einmal. Wo willst du hin?«
Annette sah zu ihrem Sohn hinab und akzeptierte die Realität des Augenblicks. »Weg.«
»Wohin weg?«
»Bloß weg. Weg von dir.«
»Dreh dich um, verdammt.« Seine Stimme klang tief und körnig wie feuchter Kies.
Annettes Körper entspannte sich, und sie tat, wie ihr geheißen. Ihr Ehemann saß auf der Veranda in dem Schaukelstuhl aus Pinienholz. Er hatte ihn für sie gemacht, als sie zum ersten Mal schwanger gewesen war. Er war in die Dunkelheit des Vordachs gehüllt, vollständig unsichtbar, bis er bereit war, sich zu zeigen. Als er aufstand, war das Erste, was sie sah, das silberne Blitzen in seiner linken Hand. Sie hatte bereits einen Moment zuvor gehört, wie der Colt zum Leben erwacht war, und jetzt konnte sie sehen, wie er dort an seiner Hüfte hing wie ein stählerner Handschuh – eine natürliche Verlängerung seiner Hand. Annette kannte diese Hand gut – wie hart und gnadenlos sie sein konnte. Jetzt konnte sie ihn sehen. Er trug kein Hemd und war barfuß. Er trug nichts außer der Arbeitshose, die er sich vom Schlafzimmerboden geschnappt hatte.
»Während du da drin die Flure entlanggekrochen bist, hab ich das Klebeband an der Fliegengittertür entdeckt. Schlau. Du warst immer verdammt schlau. Das hab ich an dir geliebt. Schlau wie ein Fuchs.« Er sprach über sie bereits in der Vergangenheitsform. »Ich hab den Scheiß schon kommen sehen. Gestern stank das ganze Haus nach WD-40, daher wusste ich, dass du so weit warst, die Sache anzugehen. Du hast jede Tür im Haus geölt – jedes Scharnier. Ich nehme an, du hast den Scheiß überall hingeschmiert, damit ich nicht erkenne, dass du bloß deinen Fluchtweg präparierst. Auch das war schlau, aber am Arsch bist du jetzt trotzdem.«
Sein Gesicht konnte sie nicht erkennen, aber sie wusste, er lächelte. Er sprach derart beiläufig, dass es sie krank machte.
»Hättest du die Hintertür nicht eingefettet, zusammen mit dem Rest, dann hättest du mich vielleicht durchgehen hören, nachdem du aufgestanden bist.« Er machte einen Schritt nach vorn und zwang Annette von der Veranda herunter. »Dann wärst du davongekommen.«
»Warte mal«, sagte sie, hielt die geöffnete Hand hoch, um den kommenden Schlag abzuwehren, aber Gareth machte keine Anstalten, sie zu schlagen. Er grinste bloß und stieg von der Veranda hinab. Im Mondlicht konnte sie ihn nun genau sehen. Seine fahle Haut leuchtete auf, und sie konnte jeden ausdefinierten Muskelstrang seines Brustkorbs erkennen und jede Ader in seinen Armen. Das Licht war so hell, dass sie ihren eigenen Namen lesen konnte, eintätowiert über seiner linken Brustwarze – gleich oberhalb meines Herzens, wie er ihr einmal erklärt hatte. Sie erinnerte sich, wie er sie noch in derselben Nacht mit einer zusammengerollten Zeitschrift geschlagen hatte, weil sie selbst kein dazu passendes Tattoo wollte. Das war die Nacht gewesen, in der sie entschieden hatte, ihn zu verlassen. Das lag nun beinahe zehn Jahre zurück.
»Willst du mich los sein, Annette?«
»Ja«, sagte sie.
»Weil du mich nicht mehr liebst? Ist es das?«
»Nein, Gareth. Das tue ich nicht mehr.« Sie war überrascht, dass es so einfach war, es zu sagen, und merkte, dass es ihn traf, das zu hören, an der Art, wie er die Oberlippe schürzte. Zorn war stets seine Reaktion auf Schmerz. Sie bedauerte, es gesagt zu haben, weshalb sie versuchte, es abzumildern.
»Lass uns einfach gehen, Gareth, bitte. Ich werde verschwinden und dich nie wieder behelligen.«
Gareths Lippe entspannte sich und verzog sich zu jenem halben Lächeln, das sie zu hassen gelernt hatte. »Ich werde dich gehen lassen, Annette. Das verspreche ich.« Er sah hinab auf den silbernen Colt.
»Tue das nicht, Gareth. Lass Erbarmen in dein Herz. Ich bin deine Frau. Du hast mich einmal geliebt, oder nicht? Du kannst uns einfach gehen lassen.«
»Meine Frau?« Gareth kaute auf dem Wort herum. »Das meint doch, bis der Tod uns scheidet, Annette. Hab ich Recht? Das war ein Versprechen, das wir uns gegeben haben. Oder etwa nicht? Erinnerst du dich daran?«
Tränen hatten auf Annettes Gesicht schmale Schlieren gebildet. »Ja.«
Gareth hob die Waffe und zielte auf seine Frau.
»Gareth, warte.«
»Halt den Mund.« Er kam noch einen Schritt auf sie zu, der Colt war jetzt nur noch Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt.
»Warte«, sagte sie erneut.
»Halt den Mund, hab ich gesagt. Hast du wirklich geglaubt, ich würde das hier zulassen? Bist du wirklich so dämlich? Du hast gedacht, du könnest dir einfach meinen Sohn schnappen, und ich würde das zulassen?«
»Er ist unser Sohn«, sagte sie. Sie klang beinahe, als schäme sie sich. Sie sah hinab auf ihre nackten Füße im feuchten Gras, als Gareth den silbernen Colt noch dichter an ihr Gesicht hielt.
»Runter auf die Knie.«
»Gareth, bitte.«
»Sofort.« Die Körnigkeit feuchten Kieses kehrte in seine Stimme zurück.
Dies hier ist das Ende, dachte sie. Er wird mich umlegen, hier an Ort und Stelle. Man würde sie in Segeltuch einrollen, auf die Ladefläche eines Trucks werfen und zu irgendeiner Müllkippe am Southern Ridge karren.
»Mach, was du für richtig hältst, Gareth, aber tu unserem Sohn nichts.«
»Unserem Sohn etwas tun?« Gareth lachte, und es klang aufrichtig. Mit großer Geste schaute er sich auf dem Grundstück um. »Du bist diejenige, die ihn gerade vom sichersten Ort auf diesem Berg entführen wollte. Du bist diejenige, die ihn bloß mit einer Decke um ihn herum in die Wälder mitnehmen wollte und, oh, warte mal …« Gareth griff in seine Hosentasche und warf ein Päckchen Bargeld auf die Erde. »… einer Decke und 340 Dollar, die du mir gestohlen hast.«
Das Geld war nicht mehr in dem Marmeladenglas, wurde aber noch immer von dem roten Haargummi zusammengehalten, mit dem Annette es umwickelt hatte, bevor sie es verbuddelte. Gareth ließ diese Enthüllung wirken, während Annettes Augen zu stumpfem Glas wurden. Die Realität dessen, was diese gefalteten Geldscheine versinnbildlichten, nahm ihr jeden Mut, den sie noch gehabt hatte.
Er hatte es gewusst. Er hatte die ganze Zeit Bescheid gewusst. Sie hatte nie eine Chance gehabt.
Ihre Beine wurden weich, und sie sank auf die Knie, ohne weitere Aufforderung. Der Fall schüttelte das Baby durch, es erwachte und bewegte sich, aber sie lockerte die Umarmung nicht. Sie starrte hinab in sein winziges rundes Gesicht, ein Gesicht, das eines Tages genauso aussehen würde wie das des Mannes, der mit einer Waffe vor ihr stand, und es durchströmte sie ein bittersüßes Gefühl von Frieden, angesichts der Gewissheit, dass sie zumindest die Transformation nicht mehr miterleben würde. Das gab ihr Kraft, und sie sah zu ihrem Mann hinauf. Sie wollte ihm sagen, dass die Flammen der Hölle bereits darauf warteten, seine Knochen zu rösten, aber sie tat es nicht. Sie konnte nicht. Nicht, als sie ihren mittleren Sohn, Buckley, bloß einige Meter hinter seinem Vater stehen sah. Er trug eines der T-Shirts seines Vaters. Es reichte ihm bis über die Knie, an einer Seite war es ihm von der blassen, knochigen Schulter gerutscht. Er war fast sieben und zeigte keinerlei Anzeichen von Angst im Dunkeln – bloß Neugier. Annette wischte sich die salzigen Tränenrinnsale von den Wangen und versuchte, wie die Mutter des Jungen zu klingen, nicht wie ein Häufchen Elend.
»Buckley, Baby. Geh wieder rein. Es ist alles in Ordnung.«
Der Junge kratzte sich an der Hüfte, bewegte sich aber nicht.
»Okay, Baby? Hör auf deine Mommy und geh wieder rein.«
»Deddy?«, sagte der Junge und sah zu seinem Vater auf. Selbst im Beisein seines Sohnes ließ Gareth die Waffe nicht einen Augenblick lang sinken.
»Buckley, hol deinen kleinen Bruder. Geh und leg ihn wieder in die Wiege.«
»Nein«, bat Annette. »Lass uns einfach gehen.«
Gareth kam noch näher und fuhr ihr mit dem kalten Stahllauf des Revolvers über die Wange. »Hörst du, Buck? Deine Miststück-Mama interessiert sich einen feuchten Kehricht für dich oder Halford. Sie will sich bloß Clayton schnappen und abhauen. Wir sollen zur Hölle fahren. Sie hat uns nicht mehr lieb, mein Sohn. Was hältst du davon?«
Buckley antwortete nicht. Er ging zu seiner Mutter und streckte die Arme aus, so wie sein Deddy es von ihm verlangt hatte. Es war sinnlos, sich zu widersetzen. Deddy hatte es gesagt, also tat der Junge es. Was sie sagte, was sie wollte, spielte keine Rolle. Hatte es nie. Sie küsste den Säugling auf die Stirn und reichte ihn seinem Bruder. Als es in Buckleys Armen lag, fing das Baby an zu weinen, und der knochige kleine Junge bemühte sich, es zu trösten. Er war klein, aber kräftig, und hielt das Baby fest umschlossen, bis es sich beruhigt hatte, und dann sprach er. Er sah seiner Mutter direkt in die Augen.
»Wiedersehen, Miststück-Mama.«
Die beiden Wörter, kaum laut genug, um überhaupt vernehmbar zu sein, dröhnten wie Donner in Annettes Ohren. Sie kam sich so alt und hohl vor wie der Eichenstumpf im Garten hinten, neben dem Gareth und sie immer gesessen und ihr Leben geplant hatten, noch bevor sie überhaupt dieses Haus gebaut hatten. Nichts von dem spielte jetzt noch eine Rolle. Nichts spielte über dies hinaus eine Rolle. Nichts. Sie betete, dass Gareth zumindest warten würde, bis die Kinder im Haus waren, bevor er es tat. Sie ließ das Kinn auf die Brust sinken. Sie war innerlich vollkommen leer. Keinerlei Gefühl war mehr in ihr. Gareth presste brutal den Lauf in ihren dichten braunen Haarschopf und drückte ab.
Der Abzug knallte mit einem gedämpften Klick gegen den Bolzen. Annette zuckte zusammen und hob dann langsam den Blick. Gareths Augen hatten sich zu schwarzen Schlitzen verengt, aber etwas war anders. Sie waren feucht. Das hatte sie noch nie zuvor gesehen. Sie verfolgte, wie er die Waffe sinken ließ und das gefaltete Geld vom Gras aufhob. Annette hielt den Atem an, als er es ihr vorne in die Bluse steckte. Er tat es auf grobe Weise, und es tat weh, aber das war ihr egal. Umbringen würde er sie nicht.
»Ich habe dich geliebt.«
Annette sagte nichts.
»So gut ich eben konnte.« Er wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht. »Also nimm einfach das Geld, das du mir gestohlen hast, und verschwinde von meinem Berg. Komm nicht zurück. Solltest du je wieder herkommen oder dich auch nur meinen Kindern nähern, dann wird der hier« – er hielt den Colt hoch – »beim nächsten Mal nicht ungeladen sein.«
Sie verharrte weiterhin auf den Knien, nicht sicher, was sie tun sollte.
»Hast du mich verstanden?«
Sie nickte, auch wenn sie es nicht verstand. In ihrer Brust fühlte sie ein magnetisches Ziehen, das von diesem Mann – diesem Monster – ausging, aber sie rührte sich nicht.
»Dann verzieh dich. Du mieses Stück.« Er steckte den Colt in den Hosenbund und drehte ihr den Rücken zu. Sie sah zu, wie er die Stufen zum Haus hinaufging und das Klebeband vom Schnappverschluss an der Fliegengittertür abzog. Sie hörte das fürchterliche Klick-Geräusch, als sie hinter ihm zufiel. Hier draußen klang es anders.
Buckley sah vom Fenster des vorderen Zimmers aus zu, wie seine Mutter im Dunklen herumkroch, um ihre Schuhe aufzulesen, und verfolgte dann, wie sie wie ein Schatten im Wald verschwand. Er hielt eine winzige Hand ans Glas und drückte sie platt. Er würde sie nie wiedersehen.
Mach’s gut, Miststück-Mama.
Gareth ging in die Küche, hob das Baby von den kalten Steinfliesen, wo Buckley es zurückgelassen hatte, und wiegte es so lange, bis es zu weinen aufhörte. Dann legte er den Jungen zurück in die Wiege und setzte sich in den Schaukelstuhl neben dem Fenster. Aus der Hosentasche zog er ein Walkie-Talkie hervor, drehte die Lautstärke herunter und drückte auf die Sprechtaste.
»Val, bist du da?«
»Ja, Boss. Genau da, wo ich sein soll. Sie kommt direkt auf mich zu.«
Gareth hielt das Walkie-Talkie locker im Schoß und starrte es an.
»Boss, bist du da? Wie soll ich die Sache angehen? Sie weiß eine Menge.«
»Spielt keine Rolle.«
Es folgte ein langes Schweigen. »Sie ist deine Frau, Gareth.«
»Auch das spielt keine Rolle.«
Er wartete die Antwort nicht ab. Er schaltete das Funkgerät aus und stellte es auf den Fußboden. Die nächsten paar Stunden blieb er noch wach, in der Hoffnung, zu hören, wie die Fliegengittertür sich erneut öffnete. Das würde sie, da war er sicher, aber sie tat es nicht.
1
»The Chute«
Irgendwo in den Untiefen der Wälder im Norden Georgias
Gegenwart
Der erste Feuerstoß ließ die Eingangstür der berüchtigten Billiardspelunke, einer umgebauten Scheune hoch oben auf dem Berg, in einer Wolke aus Splittern und Kleinholz zerstäuben, aber die dichtgedrängte, schwitzende Menge im Innern nahm wegen der Musik offenkundig keine Notiz davon. Erst die zweite Ladung Schrot, die die Decke durchsiebte und die Diskokugel zerschmetterte, sorgte für Aufmerksamkeit. Die Musik verstummte mit einem Kratzgeräusch, und Spiegelglassplitter, Akustikfliesen und Büschel rosafarbener Holzwolle segelten auf die Tanzfläche. Pulverdampf und Rigipsstaub erzeugten in der Bar einen dichten blauen Nebel, der stark nach Kordit roch. Innerhalb von Sekunden ging flackernd die Deckenbeleuchtung an. Ein Mann, ausstaffiert mit einem schwarzen Kampfanzug, das überstrapazierte Bein einer hellbraunen Strumpfhose über das Gesicht gezogen, lud die Flinte in seinen Händen ein drittes Mal durch.
»Pimmel auf den Boden, ihr Hurensöhne, sonst kriegt ihn jemand höchstwahrscheinlich weggepustet, ich schwöre.«
Ein Raum voller Statuen starrte ihn kollektiv mit leerem Blick an, aber der Mann wirkte entspannt, erfreut, schließlich im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen.
»Kein Witz, Leute. Der Letzte von euch Schwuchtiberts, der noch steht, wird einen ganz schlechten Tag haben. Jetzt hört auf, mich mit offenem Mund anzuglotzen, und runter mit euch.«
Der Schütze gestikulierte mit dem Lauf seiner Mossberg in Richtung des Betonbodens zu seinen Füßen. Er war von frisch verschüttetem Jägermeister glitschig und dünstete schales Bier aus, aber die Gäste des nächtlichen Zufluchtsorts begannen zu begreifen, was gerade ablief, und gingen, als der Rauch sich lichtete, nach und nach auf die Knie. Die Bar war ein baufälliges Gebäude, das einmal zum Trocknen von Marihuana gedient hatte. Es war auf einer Betonplatte errichtet, eine einfache Rahmenkonstruktion aus Kanthölzern, Gipskarton und Verputz, und verdankte seinen Ruf in den Blue Ridge Foothills seiner vollständigen Ignoranz gegenüber den Moralvorstellungen der Mehrheit der Bevölkerung. In dieser Gegend im Norden Georgias gehörte der Schuppen damit zu einer seltenen Spezies. Nacht für Nacht erwirtschaftete der Laden eimerweise Geld.
Die Klientel des Tuten’s Chute, oder einfach des Chute, wie die Einheimischen es nannten, bestand aus einer wilden Mischung von Streunern, Perverslingen, neugierigen Collegestudenten und Fetischjägern aus anderen Teilen des Bundesstaates. Der Art von Leuten, die in den traditionelleren Whiskeybars rund um Helen und Rabun County fehl am Platz waren. Typen der Art, die die meisten Leute gar nicht kennen wollten.
Der Mann mit der Waffe ging weiter in den Club hinein, gefolgt von drei anderen Männer mit von Strumpfhosen entstellten Gesichtern. Alle drei bewegten sich nach einem eingeprobten Muster, indem sie die Menge an den Flanken passierten und sich auf der weitläufigen Tanzfläche verteilten, dabei eine Bestandsaufnahme der Räumlichkeiten des Clubs und seiner Gäste machten. Der Anführer der Gangster ließ seinen Blick von einem Augenpaar zum nächsten hüpfen und wartete darauf, dass jemand diesem standhielt.
»Der, da vorne«, sagte er und zeigte auf einen Bullen von einem Mann mit einem überproportionierten, glattrasierten Schädel. Er war der Einzige, der nicht in die Knie gegangen war.
Einer der Gangster näherte sich ihm von hinten und rammte ihm mit Wucht den Kolben seines Gewehrs zwischen die Schulterblätter. Der Stoß ließ den großen Jungen in die Knie gehen. »Runter, hat der Mann gesagt, du verdammter Spasti.«
Der Hüne grunzte wie ein Tier, als er hinfiel, aber schüttelte den Schmerz rasch wieder ab und schickte sich an, wieder aufzustehen. Ein zweiter Hieb stoppte ihn, und diesmal lag er bäuchlings auf dem Boden, alle viere von sich gestreckt. Alle in der Bar zuckten ungläubig zusammen, als der Riesenschädel sich erneut aufzurappeln versuchte. Der Anführer presste seinen Gewehrkolben mit Wucht in den teigigen Nacken und drückte ihm seinen Kopf wieder flach auf den Boden.
»Unten bleiben, Corky, oder es wird dich deine Riesenmelone kosten.«
Der Mann am Boden sagte etwas in Richtung Beton, das niemand verstand.
»Bleib unten, Nails.« Eine neue Stimme war im Raum zu hören, und alle Köpfe drehten sich zur Theke. Freddy Tuten, ebenfalls ein Baum von einem Mann, war aus einem kleinen Büro hinter der Bar aufgetaucht. »Tu einfach, was der Mann sagt.«
Der Mann am Boden gehorchte. Er rührte sich nicht mehr und lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Beton. Der Mann mit dem Gewehr nahm es von Nails’ Nacken und wandte sich dem Mann zu, wegen dem er hergekommen war. Freddy Tuten war mindestens sechzig Jahre alt, aber er besaß die Statur eines Schwergewichtsboxers. Der Gangster kannte lediglich Freddies Ruf, aber die Gerüchte stimmten. Er hatte immer gehört, man sehe Freddy selten etwas anderes tragen als einen pinkfarbenen Bademantel aus Taft, auf dem in Kursivschrift der Buchstabe T eingestickt war. Der Mann mit der Schrotflinte hatte nicht geglaubt, dass ein erwachsener Mann in diesen Bergen mit einem solchen Aufzug durchkommen würde, bis jetzt. Denn heute Abend war keine Ausnahme. Freddy war exakt so gekleidet wie beschrieben, auch das mit dem Buchstaben am Revers stimmte. Er trug sogar hellblauen Lidschatten und grellen, kaugummipinkfarbenen Lippenstift. Aber so durchgeknallt der Alte auch aussehen mochte, dessen war sich der Gangster wohl bewusst, unterschätzen sollte man ihn nicht. Die Gerüchte berichteten auch von Freddys Lieblingswaffe – einem Baseballschläger aus Aluminium –, und die Dinge, die er damit Leuten angeblich angetan hatte, waren nicht schön. Freddy stand hinter der Theke und hielt den Schläger locker in beiden Händen. Das knapp einen Meter lange Metallrohr sah aus, als habe es ebenso viele Jahre auf dem Buckel wie sein Besitzer, und den Kerben und Dellen nach zu urteilen, waren das harte Jahre gewesen.
»Da sieh mal einer an«, sagte der Gangster. »Du musst wohl der berühmte Freddy Tuten sein.«
»Das ist richtig. Und du bist ganz offensichtlich der dämlichste Kackvogel diesseits des Bear Creek.«
Trotz der geplätteten Nase und dem verzerrten Wirbel, den die Strumpfhose aus dem Gesicht des Gangsters machte, war klar zu erkennen, dass er grinste. Schrotflinte versus Baseballschläger, das beruhigte. Geschissen auf die Gerüchte. Er hob die Mossberg und zielte damit direkt auf Freddy.
Tuten nahm eine Hand vom Schläger und kämmte sich das schulterlange, graumelierte Haar hinters Ohr. »Ich an deiner Stelle würde die Schrotflinte runternehmen, Junge.«
»Große Worte von jemandem in einem pinkfarbenen Bademantel. Was, wenn ich stattdessen einfach den Abzug drücke? Meinst du, der Schläger wird eine Ladung Schrot aufhalten?«
Tuten schüttelte den Kopf. »Nein, ich denke nicht.« Er schmiss den Schläger auf die Theke, der bis zum äußeren Ende kullerte und dann mit einen unbeeindruckend dünnen Ping auf dem Boden landete. »Ich nehme an, nichts kann mich retten, wenn du dich dazu entscheidest, das zu tun, aber ich kann dir versprechen, dass den Abzug zu betätigen deine einzige Option ist, solltest du vorhaben, hier lebend rauszukommen.«
Der Mann mit der Flinte lachte, aber es klang hohl und bemüht. Sein Gespräch mit diesem alten Silberrücken war vorbei. Sie waren aus einem bestimmten Grund hier, und er musste zur Sache kommen. Er sollte sich hüten, hier die Zeit mit Quatschen zu verplempern. Das war genau das, was der Alte wollte. Der Gangster drehte sich um, hob die Stimme und wandte sich an seine Männer. »Curtis, du und Hutch fesselt alle auf dem Boden mit Kabelbindern, wie ich es euch erklärt habe. JoJo, du stellst dich da vorne hin und hältst die alte Schwuppe hier in Schach, während er den Safe öffnet. Sollte er irgendetwas anderes tun als das, was ich ihm sage, pustest du ihm seinen verdammten Schädel weg.«
»Verdammt, und ob ich das tun werde«, sagte JoJo und richtete vom anderen Ende der Theke aus sein Gewehr auf Tuten. Der Anführer griff in seine Tasche und zog einen dicken schwarzen Packen Plastikfolie hervor. Einige der Leute, die am Boden an allen vieren gefesselt wurden, zuckten zusammen, als er die Mülltüte aufschüttelte und sie vor Tuten auf die Theke legte.
Der Alte schaute eher wie ein enttäuschter Großvater drein als wie eine alternde Dragqueen, die mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt wurde. Er griff nach der Tüte und schüttelte erneut den Kopf. »Dämlich«, sagte er leise und wandte sich dem hinteren Tresen zu.
»Wie war das, Alterchen? Was hast du gesagt?«
»Ich sagte, dass du dämlich bist. Dämlich. Ich meine, ist dir überhaupt klar, dass du gerade allen hier drin die Namen all deiner Kumpel verraten hast – Hutch, JoJo, Curtis. Ich meine, verdammt, Junge. Wie schwer meinst du, wird es mir fallen, euch Typen zur Strecke zu bringen, wenn der ganze Schwachsinn hier vorbei ist?«
»Nun, vielleicht zeigt dir das, wie viel Sorgen wir uns deswegen machen, dass du in deiner pinkfarbenen Robe weißt, wer sind.«
Der Gangster versuchte hart zu klingen, aber Tuten wusste, dass er ihm doch gerade ein kleines bisschen Angst eingejagt hatte. Er konnte es riechen. Seine Stimme hatte an den Rändern leicht brüchig geklungen.
»Meine Robe sollte dir eigentlich egal sein, Penner. Was dir hingegen nicht egal sein sollte, ist, wem das Geld im Safe gehört. Wen glaubst du eigentlich, raubst du hier aus?«
»Aussehen tut’s, als wär’s die Zahnfee.«
Tuten schüttelte zum dritten Mal den Kopf und ging hinüber zum Safe. »Reiß nur weiter deine Schwulenwitze Junge. Glaub nur weiterhin, dieser kleine Schaufenstereinbruch, den du und deine Jungs hier ausgebrütet haben, würde sich für dich auszahlen. Ich kann dir versprechen, das wird er nicht.«
»Rück einfach das Geld raus, Schlampe.«
Mittlerweile wurde Tutens Geduld einer harten Probe unterzogen. Er konnte dieses Scheiße-Gelaber nur eine bestimmte Zeit lang aushalten, aber er hielt sich im Zaum und tat wie ihm geheißen. Er räumte ein paar Flaschen von Valentines berühmtem Pekannuss-Whiskey zur Seite und griff dann nach dem gerahmten Foto, mit dem er das Zahlenschloss des in der Wand eingelassenen Safes verdeckte. Er hielt einen Moment lang inne und starrte es an. Es war eine Aufnahme von ihm und einem anderen Mann in einem Army-Tarnanzug, die vor über vierzig Jahren gemacht worden war. Das sepia-getönte Foto sah nicht einmal echt aus. Es sah eher aus wie eine Requisite aus einem Film über den 2. Weltkrieg oder ein nachgemachtes Stück Nostalgie-Nippes, wie man es in einem Stammtischlokal findet.
»Mach hin, Arschloch.« Der Gangster klopfte mit dem Lauf seiner Schrotflinte auf die Theke. Tuten stellte das Bild vorsichtig vor eine Reihe Schnapsflaschen aus Plastik und machte sich am Schloss zu schaffen.
»Weißt du«, sagte er, während er an dem Rädchen drehte. »Ich nehme an, es ist wohl besser, dass du dämlich bist. Ich meine, es wäre furchtbar, würde ich rausfinden, dass du richtig schlau bist, einen Job hast, Familie – vielleicht Kinder –, weißt du, Menschen zu Hause, die von dir abhängig sind.«
»Halt einfach die Fresse und dreh weiter.«
»Weil das eine Schande wäre. Wenn man dämlich ist, ist es für alle Beteiligten leichter, wenn man tot ist.«
»Beeil dich, verdammt noch mal.«
»Ach, und JoJo, Hutch und Curtis da drüben? Mann, ich hoffe wirklich, dass sie auch dämlich sind.« Tuten sah sich über die Schulter hinweg um. »Na, zum Teufel. Müssen sie wohl sein, da sie dir hier reingefolgt sind.«
Alle drei Männer starrten Tuten an, und er warf ihnen ein breites Grinsen zu.
»Ganz ruhig, Jungs. Der labert nur so daher. Versucht, uns aus dem Konzept zu bringen. Es ist, wie ich gesagt hab. Jeder weiß, dass bei der Bude hier die Luft raus ist. JoJo hatte Recht. In den Wäldern hier wartet kein großer böser Wolf mehr. Es gibt jetzt bloß noch diese alte Schlampe, die die Kohle von den anderen Schlampen einstreicht.« Er wandte sich an Tuten. »Du kannst dir also das Theater sparen. Wir alle wissen, es gibt auf diesem Berg nicht auch nur eine Menschenseele, die es einen feuchten Dreck interessiert, ob du lebst oder stirbst. Also halt die Fresse, öffne den Safe und mach die verdammte Tüte voll. Ich sag’s jetzt nicht noch mal.« Der Gangster schob mit dem Gewehrlauf die Tüte näher zu Tuten und schaute sich um. »Macht mich schon krank, hier nur rumzustehen. Hier stinkt‘s wie in einer Kläranlage. Ich verstehe nicht, wie ihr Kissenbeißer es hier drin aushaltet.«
Tuten sagte nichts mehr. Auch er war des Geplänkels überdrüssig. Er starrte das Foto auf dem Tresen an, während er an dem Schloss arbeitete. Es war sein Bruder, Jacob, der auf dem Bild neben ihm stand. Drei Tage nachdem das Foto gemacht worden war, hatte ihm ein koreanischer Soldat ins Gesicht geschossen. Es war der einzige Gegenstand in der ganzen Bar, der ihm wichtig war, und er hatte es gründlich satt, diesem homophoben Stück Scheiße zuzuhören. Er drehte am Zahlenschloss, ohne den Blick von dem Foto abzuwenden – links, rechts und wieder nach links.
Der Gangster bemerkte das Foto überhaupt nicht, aber er bemerkte sehr wohl die knotigen Knöchel des Alten. Sie waren allesamt kreuz und queer mit Beulen aus Narbengewebe überzogen. Er musste wohl einmal ein Straßenschläger gewesen sein, aber das war lange her. Jetzt war er bloß ein alter Mann mit Lippenstift und Lidschatten. Der Gangster klopfte erneut auf die Theke. »Fünf Sekunden, alter Mann.«
Als der Safe mit einem Klicken aufsprang, konnte jedermann im Raum spüren, wie sich die Spannung löste. Tuten zog die Stahltür auf und achtete darauf, langsam genug hineinzugreifen, damit niemand einen Rappel bekam.
»So ist’s fein. Los geht’s. Mach den Sack voll.«
»Wollt ihr auch das Dope?«
»Verdammt, und ob wir das Dope wollen«, krähte JoJo durch die Bar, als habe man ihn gefragt.
Tuten füllte den Müllsack mit faustdicken Bündeln Bargeld und zwei verschließbaren Frischhaltebeuteln voll schmutzig gelbem Badewannen-Crank. Der Mann mit der Flinte wurde beim Anblick des Geldes ganz nervös. Das hatte alles schon viel zu lange gedauert. Er sah sich um und sondierte den Raum. Seine Jungs hatten die Hände aller, die bäuchlings auf dem Boden lagen, mit Kabelbindern fixiert, waren dabei auf wenig oder keine Gegenwehr gestoßen, Curtis aber hatte noch immer Schwierigkeiten mit dem kahlköpfigen Typen, der ein paar Minuten zuvor nicht hatte unten bleiben wollen.
»Was ist das Problem, Curtis? Fessle das Arschloch.«
»Versuch ich ja, Clyde, aber verdammt. Guck dir mal seine Hände an.« Curtis zerrte Nails’ linken Arm nach oben. Die Hand des Mannes war doppelt so groß wie eine normale Männerhand und zu einem ovalen Etwas angeschwollen. Die Stummelfinger, die herausguckten, waren kaum ein Glied lang und überwiegend von dicken, vergilbten Fingernägeln überwuchert, die sich bogen und seine Fingerspitzen verdeckten. Die Hand des Mannes sah aus wie ein Gummihandschuh, den man aufgeblasen und am Handgelenk zugeknotet hatte – bloß mit Krallen.
»Was zum Henker?«, sagte Clyde. »Fessle ihn einfach, Herrgott noch mal.«
Curtis mühte sich mit dem dünnen Plastikstreifen ab. »Ich krieg den verdammten Kabelbinder einfach nicht drum.«
»Dann scheiß drauf. Wir sind hier eh fertig. Knall ihn einfach ab.«
Curtis ließ Nails’ Arm los und stand auf. Er schickte sich an, eine kleinkalibrige Pistole aus dem Hosenbund zu ziehen.
»Warte mal«, sagte Clyde. »Mit der Erbsenpistole wirst du nicht weit kommen. Lass mich mal machen.«
»Einen Moment mal.« Tuten warf die Tüte mit dem Geld und den Drogen auf die Theke. »Warum nimmst du nicht einfach, weswegen du hergekommen bist – Clyde? Nimm’s einfach und lass den Mann in Frieden. Er wird dir keine Scherereien machen. Du hast mein Wort.«
Clyde legte den Kopf schief und starrte Tuten an. »Ach, du Scheiße. Woher denn der plötzliche Tonartwechsel, Tuten? Hast du eine Schwäche für den Spasti hier?«
Tuten schob die Tüte mit dem Geld weiter in Clydes Richtung.
»Ich glaub’s nicht.« Clyde lachte. »Ist der verdammte Wasserkopf hier etwa dein Lover?«
»Nein«, sagte Tuten. »Nichts dergleichen. Nails ist nicht schwul. Ich will bloß nicht, dass er euch tötet, bevor ich keine Gelegenheit hatte, herauszufinden, wer ihr eigentlich seid.«
»Er – uns töten?« Clyde lachte jetzt noch lauter, und diesmal klang es ehrlich. Er dreht der Theke den Rücken zu und richtete das Gewehr auf Nails, aber da war es bereits zu spät.
Nails schwang die entstellte Faust, die Curtis nicht hatte fesseln können, über den Fußboden wie eine Abrissbirne. Er erwischte Clyde und Curtis beide an den Knöcheln und schlug ihnen mit einem Hieb die Beine weg. Sie fielen rückwärts zu Boden, und Clydes Gewehr flog wirbelnd Richtung Tür. Innerhalb von Sekunden hatte sich Nails den Aluminiumschläger geschnappt, den Tuten ihm ganz offensichtlich vor einigen Minuten zugerollt hatte, um ihn mit voller Wucht auf Clydes linkem Schienbein niedersausen zu lassen. Das Knirschen und Knacken des Knochens schallte durch den Raum.
»Verdammte Axt«, sagte Tuten, zog die Worte in die Länge. Clyde brüllte in einer beinah unhörbaren Stimmlage, und draußen irgendwo in den Wäldern bellte ein Hund. Nails zog Clyde an dem Fuß, der an seinem zertrümmerten Bein hing, über den mit Schutt bedeckten Fußboden zu sich heran. Clyde verlor das Bewusstsein.
Nails musterte den dürren Mann mit dem ramponierten Bein, keinerlei Anzeichen von Mitleid in seinen eigentümlichen, überproportionierten Augen. »Tut mir leid, Fred. Ich muss ihn umlegen. Ich bin kein Spasti. Er hat mich Spasti genannt – zwei Mal.«
»Ich hab’s gehört, Nails. Tu, was du tun musst, aber lass mir zumindest zwei von den anderen am Leben.«
»Halt!«, brüllte Curtis. Er hatte seine .22er fallenlassen, als er zu Boden ging, es war ihm aber gelungen, in Richtung Tür zu hechten und Clydes Gewehr zu schnappen. Er zielte damit auf Nails. »Na, und wer ist jetzt der gottverdammte Boss?«, sagte er und lud die Mossberg durch, wie er es bei Clyde gesehen hatte. Die ungenutzte Patrone, die noch in der Kammer steckte, flog seitlich aus der Waffe und drehte sich wie ein Kreisel auf dem Beton. Alle im Raum starrten wie hypnotisiert das kleine rote Windrädchen an.
Nach einem langen Augenblick drückte Curtis ab. Man hörte lediglich ein leeres Klicken. Nails und Tuten schauten verwirrt drein, bevor Tuten in ein dröhnendes Lachen ausbrach, das ihn so heftig erwischte, dass daraus ein Raucherhusten wurde. JoJo und Hutch, die bisher wie die Ölgötzen dagestanden hatten, rannten in Richtung Tür. Curtis warf mit dem nutzlosen Gewehr nach Nails – der es fing – und robbte weiter in Richtung der zerstörten Tür, ließ den ohnmächtigen Clyde am Boden zurück.
Nails setzte sich auf, die Waffe in der Hand. Er war noch immer durcheinander. »Ist das gerade echt passiert?«
»Jep«, sagte Tuten, während er um die Theke herumkam und anfing seine Freunde mit einem Schälmesser von den Kabelbindern zu befreien.
Curtis kam schließlich auf die Beine und stolperte nach draußen auf den El Camino zu, der dort wartete. JoJo saß bereits auf dem Fahrersitz und jagte den Motor wieder und wieder im Leerlauf hoch. Curtis hechtete über die Heckklappe auf die Ladefläche des funkelnd-schwarzen Muscle-Cars, während Hutch auf den Beifahrersitz sprang.
»Los!«, brüllte Curtis. »Los!«
»Was ist mit Clyde?«
»Scheiß auf Clyde, JoJo. Fahr!«
JoJo trat aufs Gaspedal, und der Wagen röhrte. Der Auto-Truck-Hybrid entfachte hinter sich einen Staubsturm, als er sich langsam vom Schauplatz des abgebrochenen Raubüberfalls entfernte. Er fuhr kaum sechs Meter weit den Feldweg entlang, bevor der Motor von selbst aufheulte und das Auto abrupt zum Stehen kam, wodurch Curtis gegen das Heckfenster geschleudert wurde. Der Wagen hüpfte noch ein paar Meter die Buckelpiste entlang, bevor er schließlich spotzend den Geist aufgab.
»Was zum Henker, JoJo?«
JoJo drehte den Schlüssel in der Zündung, aber außer einem tiefen schleifenden Geräusch war nichts zu hören. »Abgesoffen«, sagte er.
»Abgesoffen?«, bellte Hutch. »Wie zum Teufel soll er abgesoffen sein? Wir sind doch schon gefahren. Versuch‘s noch mal.«
JoJo drehte erneut den Schlüssel, was lediglich ein Klickgeräusch hervorrief, kaum lauter als das Zirpen der Grillen draußen.
»Hast du getankt, wie wir dir gesagt hatten?«, sagte Hutch, schaute nach hinten durch das Rückfenster zur Bar, vor dessen Eingangstür sich nun die Männer sammelten.
JoJo schaute entrüstet drein. »Natürlich hab ich getankt. War kurz bevor wir hergekommen sind bei der Tankstelle. Der Tank ist randvoll, Mann.«
Curtis donnerte mit der Faust gegen das Dach und brüllte durch die Heckscheibe. »Verdammt noch mal, JoJo. Hast du wieder Diesel genommen?«
Jetzt sah JoJo zugleich beleidigt und beschämt aus. »Scheiße, nein, Mann. Ich hab den grünen Stutzen genommen. Du meintest, ich soll den grünen Stutzen nehmen.«
Curtis schlug nun mit beiden Fäusten gegen das Dach. »Nein, nein, nein, du Idiot. Nicht den grünen Stutzen nehmen, habe ich gesagt. Ich sagte …«
Aber es spielte keine Rolle mehr, was Curtis sagen wollte. Die linke Seite seines Gesichts und ein Gutteil seiner Schulter verschwanden in einem feinen rosafarbenen Nebel, der die Heckscheibe überzog, durch die Hutch geblickt hatte. Beinahe im selben Augenblick spritzlackierte er das Innere des Fensters mit Erbrochenem.
Nails stand auf der Veranda des Chute, bedeckt von Clydes Blut, und balancierte Clydes Gewehr in der Armbeuge. Diesmal beachtete niemand die rote Patronenhülse, die in die Büsche flog.
»Bring sie nicht alle um, Nails. Ein paar von denen brauch ich lebend.«
Nails ließ die Waffe sinken und schleuderte sie dann in die Büsche.
»Geht eh nicht. Nicht damit jedenfalls. Sie haben mir nur eine Patrone übriggelassen.«
Tuten schloss seinen Mantel in der kühlen Nachtluft und band sich die flauschige Kordel fest um die Hüfte. Er legte sich das Gewehr, das JoJo im Club beim Rausrennen hatte fallenlassen, über die Schulter und machte sich auf zum Wagen. »Auf dem Nummernschild steht Boneville«.
Nails beschirmte seine Augen mit der Hand und blinzelte. »Ja, stimmt.«
»Wo zum Henker liegt Boneville?«
»Wen interessiert’s?« Nails wischte sich die Hände an der Vorderseite seiner Jeans ab. »Soll ich Scabby Mike anrufen?«
»Nee, ist ja mitten in der Nacht. Lass uns erstmal ein paar Anhaltspunkte für ihn sammeln. Du nimmst den da.« Er deutete mit dem Gewehr auf Hutch, der bereits aus dem verendeten Auto geklettert war und sich in den Wald geschlagen hatte. »Ich bin zu alt für das scheiß Gerenne. Ich werd ein bisschen mit dem Fahrer plaudern.«
JoJo saß noch immer hinter dem Steuer, hielt es mit beiden Händen umklammert, als Tuten zur Tür an der Fahrerseite kam. Der Junge murmelte vor sich hin. Er war noch immer damit beschäftigt, sich daran zu erinnern, ob er jetzt den grünen Stutzen benutzt hatte oder nicht.
2
Bezirk Waymore Valley, Georgia
Clayton Burroughs hörte die Nachricht von Scabby Mike ein zweites Mal ab und steckte dann sein Telefon zurück in die Tasche. Er hatte jetzt so lange im hinteren Gang von Pollard’s Corner Gas ’n’ Go gestanden, dass er vergessen hatte, was er eigentlich hier wollte. Das Percocet machte das manchmal. Benebelte ihn. Die Hände tief in den Taschen vergraben, spielte er mit Telefon und Geldbörse, wartete dar-auf, dass sich der Nebel in seinem Kopf lichtete, und blickte sich dann noch immer orientierungslos zwischen den Reihen staubiger Aluminiumregale um. Gläser mit Duke’s Mayonnaise und Konservendosen zum Aufreißen mit Wiener Würstchen und Dinty Moore Schmalzfleisch standen fein säuberlich aufgereiht in der häufig vergessenen Lebensmittelecke des kleinen Außenpostens. Clayton bezweifelte, dass davon in den letzten Jahren etwas verkauft oder aufgestockt worden war. Niemand erstand beim alten Pollard altmodische Soleier oder verbeulte Dosen mit Babynahrung zu überhöhten Preisen, wo es doch ein paar Kilometer weiter eine IGA gab.
Moment mal kurz … Babynahrung. Endlich machte es bei ihm Klick. Claytons Blick blieb an einem Stapel Carolina-blauer Reisepackungen Feuchttücher für Babys hängen, und schließlich verschwand der Nebel ganz.
Windeln! Das war es, was er auf den Zettel geschrieben hatte. Aber waren es Huggies oder Pampers gewesen?
Er konnte sich das nie merken. Die rote Folie, in der sie verpackt waren, kam ihm bekannt vor, er meinte sie schon mal gesehen zu haben, wenn er im Babyzimmer herumgegeistert ist, aber darauf sein Leben verwetten würde er nicht. Die Medikamente sorgten dafür, dass er solchen Scheiß von einer Minute auf die andere einfach vergaß. Darum hatte er sich einen Zettel geschrieben, aber jetzt konnte er auch den Zettel nicht finden.
Herrgott, Clayton, wenn du Windeln als Entschuldigung vorschiebst, warum du so früh das Haus verlässt, solltest du dir zumindest die Marke merken.
Wieder durchwühlte er seine Hosentaschen, zog dieselbe Brieftasche und dasselbe Mobiltelefon hervor, wie er es bereits dreimal gemacht hatte, um zu schauen, ob sie noch da waren. »Verdammt«, murmelte er und steuerte dann auf die Regale mit den Babysachen zu, bückte sich und schnappte sich schnaufend den mit rotem Plastik umhüllten Klotz. Er klemmte sich ihn fest unter die Achsel wie einen Football und entschied, sich nicht eine Sekunde länger damit zu beschäftigen. Seine Chancen, richtigzuliegen, standen bei fünfzig Prozent. Vielleicht hatte er ja einmal Glück.