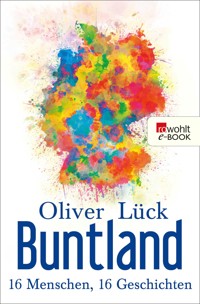
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein ungewöhnliches Reisebuch, das zeigt, wie schräg, vielfältig und bunt unsere Heimat ist. Oliver Lück zeigt Deutschland, wie es in großen Teilen schon lange ist: bunt. Dafür porträtiert er 16 Menschen aus 16 Bundesländern, die, obwohl keine Prominenten, die wahren Persönlichkeiten und Vorbilder unserer Gesellschaft sind, weil sie grenzüberschreitende Leben führen. Es ist das besondere, unkonventionelle Denken, das diese Charaktere und ihre Art zu leben eint. Oliver Lück erzählt ihre Geschichten nicht romantisierend oder gar naiv, sondern mit einem tiefen und sehr klaren Blick für das Leben einzelner Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Oliver Lück
Buntland
16 Menschen, 16 Geschichten
Über dieses Buch
Ein ungewöhnliches Reisebuch, das zeigt, wie schräg, vielfältig und bunt unsere Heimat ist.
Oliver Lück zeigt Deutschland, wie es in großen Teilen schon lange ist: bunt. Dafür porträtiert er 16 Menschen aus 16 Bundesländern, die, obwohl keine Prominenten, die wahren Persönlichkeiten und Vorbilder unserer Gesellschaft sind, weil sie grenzüberschreitende Leben führen. Es ist das besondere, unkonventionelle Denken, das diese Charaktere und ihre Art zu leben eint. Oliver Lück erzählt ihre Geschichten nicht romantisierend oder gar naiv, sondern mit einem tiefen und sehr klaren Blick für das Leben einzelner Menschen.
Impressum
Die genannte Seitenzahl im Impressum bezieht sich auf die Printausgabe
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Textpassage auf S. 106f. aus: Anke Bär, Kirschendiebe oder Als der Krieg vorbei war
© 2018 Gerstenberg Verlag, Hildesheim
Fotos im Bildteil © Oliver Lück
Lektorat Tobias Schumacher-Hernández
Umschlaggestaltung ZERO Media GmbH, München
Umschlagabbildung FinePic, München
ISBN 978-3-644-40340-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Alles so schön bunt hier
Es liegt schon Jahre zurück, aber ich erinnere mich noch gut daran, wie ich mit meinem Schwiegervater – sein Name war Halil, er war Türke und starb 2011 – an einem späten Abend im April auf der Terrasse seines Hauses am Ägäischen Meer saß und er mir von einer Wichtigkeit erzählte. Es sei nicht irgendeine Wichtigkeit, betonte er, nicht nur wichtig für ihn oder die Familie, sondern wichtig für das ganze Land, die Türkei, und ja, vor allem wichtig für die ganze Welt. Es ging um ein Stück Obst, das mehr war als bloß etwas Essbares und Genussvolles. «Diese Frucht ist alles», sagte Halil damals – es ging um den Granatapfel.
Rot, prall und stolz lag dieser Apfel vor uns auf dem Tisch. Und die Unterhaltung, die eigentlich ein Vortrag war, zog sich über eine Stunde hin. Halil erzählte von der Türkei, dem Granatapfelland. Er sprach vom nahen Izmir, der Millionenstadt am Meer, wo die Händler an jeder Straßenecke stünden, die Wagen vollbepackt mit leuchtenden Granatäpfeln und daneben eine Fruchtpresse. Dunkelpurpur, satt und gehaltvoll sei der Saft, frisch und süßsäuerlich. In jede Soße kämen immer auch ein paar Tropfen. Jeder Türke wisse das. Und überhaupt sei jede Türkin und jeder Türke ja schon über die Muttermilch mit Granatäpfeln großgezogen worden. Und als Halil, der auch noch das Märchen vom weinenden Granatapfel und der lachenden Quitte erzählte, all diese Dinge über das mythenschwere Obst verkündete, war es, als ob er von Allah persönlich sprach.
Bevor er den Apfel feierlich aufschnitt, hielt er die faustgroße Frucht noch eine Zeitlang in der Hand und betrachtete sie schweigend. Dann griff er zum Messer. Und wer schon einmal einen Granatapfel gegessen hat, der kennt dieses leichte Chaos, das sich im Innern eröffnet. Die Kerne hängen sehr fest in der Schale. Sobald man versucht, sie herauszulöffeln, verletzt man die empfindliche Hülle und macht schlimme Flecken. Halil aber war ein wahrer Meister. Nach 20 Sekunden waren alle Kerne draußen. Keine Ahnung, wie er das hinbekam. Aber alles blieb sauber. Dann sagte er noch genau zwei Worte: «Essen, bitte!»
Es mag etwas seltsam erscheinen, ein Buch über Menschen und Geschichten aus Deutschland in der Türkei zu beginnen. Doch manchmal ist es ja so, dass man erst seinen Blickwinkel ein Stück verändern – oder besser gleich das Land verlassen – muss, um eine freie Sicht auf die Dinge zu bekommen. Man richtet sich neu aus. Das Herumkommen weitet den Blick. Wer von außen schaut, tut das mit einer Mischung aus Staunen, Belustigung und Schrecken. Und Halil hatte eine sehr klare Vorstellung von seinem Land. Er war einer der ersten Gastarbeiter gewesen, die zu Beginn der Sechziger nach «Almanya» gekommen waren. Mehr als 30 Jahre hatte er als Schweißer im Ruhrpott und später in München gelebt.
Natürlich ist es nicht möglich, die Türkei anhand eines Granatapfels zu erklären. Im Rückblick ist auch schwer zu sagen, ob Halil das alles wirklich so gemeint hatte. Aber er hatte sich sehr viel Mühe gegeben und sichtlich Freude daran gehabt. Und er mochte Granatäpfel. Das alles imponierte mir. Und ich dachte an Deutschland, das mir fast ausländisch fremd erschien. Denn lange hatte es für mich nur einen Gedanken gegeben, wenn es ums Reisen ging: möglichst weit weg. Nur dort konnte das Abenteuer warten. Nicht in Berlin oder Bad Nauheim. Und schon gar nicht dort, wo ich aufgewachsen war, wo Schleswig-Holstein noch nicht schön ist und Hamburg nicht mehr. Deutschland? Was kümmerte mich Deutschland! Viel zu klein, viel zu eng – das Land und seine Leute. Ich musste erst nach Indien, Angola oder Costa Rica, nach Indonesien, Russland und in die Türkei, um zu verstehen, warum Menschen um die ganze Welt fliegen und bei uns Urlaub machen wollen. Touristen in Deutschland? Waren für mich immer die anderen gewesen.
Bis heute fällt es mir schwer, meine Heimat mit Hilfe von Labskaus, Spätzle oder Weißwurst zu begreifen. Selbst Riesling oder Bier können da nicht helfen. Aber Gefühle für das eigene Land entstehen ja auf vielfältigste Weise, und auch das Essen kann da eine Rolle spielen: Der Gedanke an Omas Schmalzgebäck aus der runden Dose oder an das von Mama geschmierte Butterbrot in der blauen Tupperbox löst etwas Wohliges aus. Es gibt regelrechte Trostrezepte, die das Heimweh erträglicher machen. Es gibt Menschen, die sich Bratwürste um die halbe Welt schicken lassen, damit die Sehnsucht nach zu Hause nicht zu groß wird. Der vertraute Geschmack dieser Würste soll trösten. Andere haben für den Notfall heimische Brezeln in der Tiefkühltruhe. Manch einer beginnt zu weinen, wenn er in der Fremde ein Bier aus seiner Heimatstadt trinkt. Und man kennt auch den Geruchstrost von Kindern, die auf Reisen ein Schmusetuch dabeihaben, das nie gewaschen werden darf. Wussten Sie, dass das Heimweh zu Beginn des 18. Jahrhunderts noch als schwere, nicht zu heilende und daher tödliche Krankheit galt?
Damit hier kein Missverständnis entsteht: In diesem Buch geht es nicht um die Suche nach einer gemeinsamen Identität. Und keine Sorge, ich werde Ihnen auch nicht das Land erklären – das müssen Sie schon selber versuchen. Nur eine Frage: Welche Farbe sehen Sie, wenn Sie auf Deutschland blicken? Schwarz-Rot-Gold? Etwas zu simpel und auch ein bisschen langweilig. Schwarz und Weiß? Einige denken ganz sicher so – selber schuld! Doch ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es ist viel einfacher: Deutschland ist bunt. Zum Glück.
Zwei Jahre lang bin ich durch alle Bundesländer gereist und habe erzählenswerte Geschichten gesammelt. Oft werde ich gefragt, wie ich die Menschen finde, über die ich schreibe. Ganz ehrlich: Ich weiß das gar nicht so genau. Häufig ist es nämlich so, dass sie plötzlich da sind. Selbst in Teutendorf oder in Muschwitz. Man sitzt irgendwo, hört etwas und fragt nach. Man nimmt sich Zeit und kommt ins Gespräch. Viele Begegnungen haben genau so angefangen. Auch das Bayern-Kapitel: Ich saß in einer Würzburger Weinstube, bestellte Schoppen und Brotzeit. Ein Mann setzte sich zu mir an den Tisch. Und schon bald erzählte Josef, wie er mal drei fremden Rumänen, die eine Panne auf der Autobahn hatten und unbedingt nach Hause zu ihren Familien mussten, sein vollgetanktes Auto lieh. Den Fahrzeugschein gab er ihnen auch gleich mit. Es war kurz vor Weihnachten. Josef wollte helfen. Und am Ende unserer ersten Begegnung in Würzburg sagte er dann auch noch einen schönen Satz: «Buntland ist überall.»
Solche Erzählungen sind es, die ein Land sehr viel greifbarer machen als Zahlen, Farben oder die Politik. Und Menschen wie Josef sind sehr viel spannender als 99,9 Prozent derer, die im Fernsehen unterwegs sind. Weil sie echte Geschichten zu erzählen wissen. Nichts Exklusives dabei. Schon gar nichts Prominentes. Aber ganz alltäglich sind diese 16 Menschen aus 16 Bundesländern eben auch nicht. Und vielleicht umschreiben ja auch zwei Zeilen von Element of Crime den Umgang mit der Heimat und der eigenen Sicht darauf gar nicht so schlecht, wenn es im Song «Blick aus dem Fenster» heißt: Wer nicht geht, kommt nie wieder, und wer bleibt, ist nie weg. Der Rest liegt im Auge des Betrachters.
BADEN-WÜRTTEMBERG
1Der Herr der Dinge
Frank Dähling ist Sammler, Naturschützer, Geschichtenerzähler und noch vieles mehr. Seit über vierzig Jahren lebt er in einer jahrhundertealten Wassermühle im Kraichgau. Hier rettet er das, was vom Fortschritt bedroht ist.
Wer Frank Dähling trifft, muss damit rechnen, nach vier Tagen Besuch über 23 Stunden Gespräch auf Band zu haben. Frank ist jemand, der gerne redet. Er weiß auch viel zu sagen. Er kann Dinge so erzählen, dass sie für immer in Erinnerung bleiben. Er wird vieles über die Studentenbewegung der sechziger Jahre verraten. Darüber, wie er in Frankreich als Vagabund lebte. Oder wie manche seiner Freunde in den Terrorismus abrutschten. Er wird seine Sammlung von über tausend Mausefallen zeigen. Doch vor allem soll es um eine Insel gehen, die nicht von Wasser umgeben ist. Ein Kleinod, wo man sich frei und zugleich geborgen fühlen kann. Und wer mal einige Tage dort verbracht hat, der wird danach ein wenig brauchen, um zurückzukehren in den Alltag der Anderswelt da draußen.
Ein Ort mit dem Namen Raußmühle kann ein ziemlich guter Platz für jemanden sein, der sein Leben lang rauswollte aus verkrusteten Gewohnheiten, raus aus Zwängen, raus aus den Vorstellungen der anderen. Wer den Innenhof betritt, muss unter einem steinernen Bogen hindurch und ein schweres, schmiedeeisernes Tor aufschieben, an dem der Rost frisst. Die Scharniere quietschen, als wären sie seit Jahrhunderten nicht geölt worden. Es ist das passende Geräusch für das, was dahinter zu entdecken ist. Vor über 700 Jahren soll das Mühlengehöft gebaut worden sein. Es liegt verborgen und verwunschen hinter verwilderten Büschen und wucherndem Gestrüpp. Stolze alte Bäume umgeben die Mauern der einstigen Wassermühle zwischen Heilbronn und Karlsruhe, westlich der angenehm überschaubaren Fachwerkstadt Eppingen mit ihren 20000 Einwohnern.
An diesem Tag riecht es nach geilem Bock. Streng und sehr säuerlich. «Der ist heute kaum zu halten», ruft Frank, der plötzlich vor einem steht und auf den Stall mit den Ziegen zeigt. Seit 1975 lebt er hier. Zunächst mit Freunden. Dann mit seiner Lebensgefährtin Heidi. Mit Hund und Katzen, Enten und Hühnern. Mit Schafen, Ziegen und einigen Bienenvölkern. Die Gänse hat kürzlich der Fuchs geholt. Die Pullover werden zwar schon seit Jahren nicht mehr selber gestrickt, aber Käse, Wurst, Milch, Apfelmost oder Brot selbst gemacht. Insgesamt sind es sechs Hektar Land, die Frank mit einfachsten Mitteln bewirtschaftet. Das Gras wird für den täglichen Bedarf mit der Sense geschnitten. Er versucht, möglichst wenige Maschinen einzusetzen. Als zusätzliches Futter holt er die Lebensmittel von einem Supermarkt, die weggeworfen werden sollen. Täglich sind das säckeweise Brot und Kisten voll mit Gemüse und Obst.
Wie eine Insel liegt die Raußmühle im Meer der Monokulturen. Sie ist umgeben von Raps und Mais. Soweit das Auge reicht. Jedes Jahr mehr. Die Natur wird umgekrempelt und abgeräumt. Wer durch die Felder wandert, sieht kaum noch Schmetterlinge und keine Hummeln mehr. Auch immer weniger Bienen oder Insekten hüpfen und krabbeln herum. Die Landwirtschaft hat ihnen den Garaus gemacht. Wildtiere haben die Flucht ergriffen. Und längst sind die stahlgrauen Hallen des Eppinger Gewerbegebietes auf Sichtweite herangewachsen.
Frank sagt: «Obwohl wir hier zivilisiert leben, wird die Grenze zwischen Wildnis und Zivilisation bei uns besonders deutlich.» In den letzten vier Jahrzehnten hat er viel dafür getan, dass der Hof zu dieser ökologischen Insel werden konnte. Er hat Hunderte Bäume gepflanzt, darunter seltene Arten wie Speierling oder Elsbeere. Er hat Pflanzen wieder heimisch gemacht, darunter Heilkräuter wie Herzgespann oder Beinwell. Er hat Teiche angelegt. Biotope sind entstanden. Entlang der Elsenz, die über Jahrhunderte das Mühlrad angetrieben hatte, bevor sie umgeleitet wurde und heute 80 Meter im Rücken der Mühle fließt, hat sich eine natürliche Auenlandschaft gebildet. Bei Frank darf alles wachsen und wuchern. Das Ergebnis ist überwältigend: Man hat rund 500 Pflanzen- und fast 50 Vogelarten gezählt. Pirol, Nachtigall, Eule, Turmfalke, verschiedene Arten Kleiber, Spechte und Baumläufer, Zilpzalp, Zeisig und Zaunkönig. Es ist ein Ort, der so wirkt, als habe jemand die Welt auf wundersame Weise geheilt.
Man glaubt zu sehen, dass Frank viel nachgedacht hat in seinem Leben. Seine Stirn zieren beeindruckende Denkfalten. Sein kantiges Gesicht wird umrahmt von einer schneeweißen, zum Seitenscheitel frisierten langen Haarwolke, die sich unten mit dem wild wuchernden Vollbart vereint. So hat man sich den Zauberer Merlin immer vorgestellt. Frank sieht aus wie jemand, der sehr deutlich machen will, dass ihn das Gerede über Äußerlichkeiten oder gar Mode schlichtweg nicht interessiert. Eine Filzjacke, eine dreckige Jeans. Auf dem Kopf eine Proletenkappe aus dunkelbraunem Leder. Er sieht aus wie ein in die Jahre gekommener Widerstandskämpfer. Er ist der Protest in Person. Und wenn er in seinem wilden Garten beim Frühstück sitzt, hebt er manchmal tatsächlich noch drohend die Faust, wenn wieder eines dieser riesigen Erntemonster vorbeirauscht und man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. «Das ist die moderne Landwirtschaft», ruft er in das Dröhnen des Mähdreschers hinein. «Und dort hinten», jetzt deutet er auf das benachbarte Maisfeld, wo alles in Reihe wächst, «da endet die ökologische Vernunft.»
Frank, geboren 1944 im Bombenkeller eines Pforzheimer Krankenhauses, ist das, was man ein Unikum nennt, ein Solitär, der seine Macken und Marotten hat und auch auslebt, der beharrlich Widerstand leistet gegen den Triumph der Industrialisierung. «Die Welt ist wahnsinnig geworden», sagt er, «wir Menschen kennen kaum noch unseren Ursprung. Er ist uns fremd geworden. Doch wohin hat uns dieser sogenannte Fortschritt gebracht? Wir verseuchen die Böden, verpesten die Luft, roden die Wälder und müllen die Meere mit Plastik zu. Der Mensch hat sich die Erde unterworfen und ist ein aus der Balance geratener Raubsäuger auf zwei Beinen.» Anderswo würde so einer wie er wohl aussortiert werden. Weil Schrullen und Eigenarten den geregelten Lauf der Dinge stören. Weil Menschen, die sperrig sind, im Räderwerk des täglichen Lebens nichts zu suchen haben. Dabei kann er mit Leuten umgehen, keine Frage, sie haben Respekt vor einem, der so auftritt, der den Weg des größtmöglichen Widerstandes bis heute nicht scheut.
Im Jahr 1334 wurde die Raußmühle erstmals urkundlich erwähnt. Sehr wahrscheinlich ist sie sehr viel älter. Im Laufe der Jahrhunderte sollen mehr als 30 Müllerfamilien hier gelebt haben. Noch bis 1958 drehte sich das Rad. Korn wurde zu Mehl, Hanf wurde zu Öl. Dann flatterte ein Brief der Bundesregierung ins Haus: Das Wasserrecht wurde entzogen. Zuungunsten vieler kleiner Mühlen, zugunsten weniger großer. 1974 erfährt Frank durch einen Bekannten von der alten Wassermühle im Kraichgau. Kurze Zeit später fährt er das erste Mal hin und erlebt eine Enttäuschung. Der marode Dreiseitenhof wird als Schrottplatz genutzt und ist mit Stacheldraht umzäunt. Die Autowracks sind in drei Etagen übereinandergestapelt. Batterien und Öltanks laufen aus. Alles sickert in die Erde. Die Scheune hat kein Dach mehr, es steht nur noch das Gemäuer. Die Fenster und Türen des Wohnhauses, in dem Brennnesseln wachsen, sind ausgeschlagen. Ein verfallenes, verwildertes Gehöft. Eine vom Einsturz gefährdete Ruine. Nicht mehr zu retten, heißt es. Frank pachtet den Hof trotzdem. Denn da ist auch etwas, das nicht zu sehen, aber zu spüren ist, etwas, das standhält. Es ist, als wollte dieser Ort ihm etwas mitteilen.
Er beginnt aufzuräumen. Meter für Meter trägt er das vergiftete Erdreich ab. Der Boden ist übersät mit Scherben. Er legt den gesamten Hof einen halben Meter tiefer und stößt auf das mittelalterliche bucklige Natursteinpflaster. Er lässt einen Experten vom Amt für Denkmalpflege kommen. Der Mann ist sofort überwältigt. 1976 wird die Raußmühle zum Kulturdenkmal erklärt. Nun darf sie nicht mehr abgerissen werden. Nun ist es möglich, Fördergelder zu beantragen. Frank kauft den Hof. Sein Vater bürgt für ihn. Er kann einen Kredit aufnehmen. 70000 Mark für das Grundstück. Die Gebäude sind nichts mehr wert. Frank wird der neue Raußmüller. Damals kann er noch nicht wissen, dass diese Entscheidung sein Leben bis heute prägen wird. Er sagt: «Alles, was ich je an Geld verdient oder geerbt habe, habe ich in diese Mühle gesteckt.» Und immer, wenn er dachte, es gehe nicht mehr weiter, standen Wandergesellen oder Freunde vor der Tür und fragten: «Kann ich irgendwie helfen?»
Heute zählt die Raußmühle zum Europäischen Kulturerbe. Sie ist ein Museum für die Geschichte des ländlichen Lebens und ein Ort, an dem die Zeit wie konserviert wirkt. Zurückgeholt und haltbar gemacht. Mehrmals im Monat führt Frank Besucher über den Hof. Jedes Mal begrüßt er sie zu «einem Rundgang durch die verschwundene Zeit». Das wichtigste Exponat ist die Mühle selbst: Er zeigt ihnen die mächtigen Mahlsteine und das Herz der Anlage: das sogenannte Planetarium mit seinem Königsrad und dem Winkelzahnradgetriebe. Alles wurde mit viel Geduld restauriert. Es gibt eine spätmittelalterliche Rauchküche und eine Alchemisten-Stube. Auf drei Etagen ist die Scheune bis unter das Dach gefüllt mit Exponaten aus den Jahrhunderten. Es sind zehntausend Dinge und mehr, die Frank zusammengetragen hat. Er hat sie in Scheunen und auf Speichern entdeckt, von fliegenden Trödelhändlern und auf Auktionen gekauft. Ein sagenhaftes Sammelsurium. Ein Kuriositätenkabinett, in dem Epochen sich begegnen, Zeiten sich berühren, Relikte nebeneinanderstehen. Alles hat seinen Platz gefunden. Darunter viele Werkzeuge, die in einer sich rasch mechanisierenden Landwirtschaft als nicht mehr gebraucht zurückgelassen wurden. Spielzeuge und Möbel. Münzen, Schädel und alte Küchengeräte. Wanderstöcke, Türklopfer und Sonnenuhren. Der Lehrbrief eines Müllers von 1765 auf Pergament. Ein Kutscherhut aus Maulwurfsfell. Der Käfig eines Vogelhändlers aus Heilbronn. In den zwanziger Jahren lief er damit nach Stuttgart, um dort seine Kanarienvögel zu verkaufen, 200 Tiere auf dem Rücken. Es gibt auch eine Wendebohlentür, die 500 Jahre alt ist. Jedes Öffnen klingt, als halte noch immer der erste Besitzer persönlich den Griff fest. «Eine Komposition», nennt es Frank, schiebt sie sehr langsam auf und lauscht dem knarzenden Kreischen der Jahrhunderte.
Es gibt Menschen, die sich problemlos von etwas trennen können. Frank gehört nicht dazu. Er ist jemand, der gegen das Verschwinden und Vergessen ankämpft. Den Satz des kanadischen Technikkritikers Pat Mooney hat er nicht ohne Grund auf einen seiner Schränke geschrieben: Es könnte sein, dass unsere Generation die erste ist, in der die Menschheit mehr Wissen verliert als dazugewinnt. Frank rettet, was vom Fortschritt bedroht, was im Alltag überflüssig geworden ist. «Mir sind keine Details zu klein», sagt er. Und zu jedem Gegenstand kennt er die Geschichte. Es ist die Poesie der Dinge. Es sind Geschichten, die ganze Leben erzählen. So bringt er die Dinge zum Sprechen. Er sagt: «Sie sind Zeugen einer anderen Zeit. Und wir holen uns diese Zeit zurück, indem wir uns erinnern. Diese Erinnerungen machen ein Museum aus.»
Seine Führungen können zwei Stunden dauern oder auch sieben. Es kommt darauf an, wie Frank in Form ist und wie viel die Gäste vertragen. In einem offenen Zauberschrank zeigt er Objekte der Volksmagie und des Aberglaubens: konservierte Schlangen. Getrocknete Frösche. Gekreuzte Hühnerfüße als Abwehrzauber gegen böse Mächte. Knochenwürfel. Die Pfeife eines normannischen Schamanen. Das Fett von Gehängten. Rituell zerbrochene Scheren. Ein Glas mit Rattenschwänzen, die vor hundert Jahren noch in deutschen Apotheken gegen Keuchhusten verkauft wurden. Bauopfer wie eine mumifizierte Katze oder einen kleinen Hund, die lebendig unter Schwellen und in Wänden eingemauert wurden, um die Geister gnädig zu stimmen. Eine Folterecke mit Halsgeigen, Fußfesseln und Daumenschrauben. Ein Verlobungsring, auf dem zwei winzige Hände die Merkel-Raute bilden. Eigentlich ein Symbol für die Vulva, erklärt Frank, es bedeutet: Ich möchte mich dir ganz hingeben. Oder der Spazierstock eines SS-Mannes, der Mitglied der Totenkopfbrigade war. Eine Frau kam und sagte, sie habe einen ganz bösen Stock von ihrem Onkel zu Hause. Sie wolle ihn verbrennen. Frank aber brauchte das handgeschnitzte Exemplar mit dem grobschlächtigen Schädelgriff unbedingt. Er sagt, er wollte zeigen, wie sich das Hässliche des Menschen, das wirklich Böse anfühlt.
Als Nächstes präsentiert er seine Mausefallensammlung, die größte in Deutschland. Mehr als tausend Fangmaschinen sind es mittlerweile, die ältesten 500 Jahre alt. «Eine der wichtigsten Erfindungen, die der Mensch je gemacht hat», sagt er, «ohne sie wären wir verhungert.» Immer wieder hält Frank Vorträge über die Kulturgeschichte der Mausetotmaschinen. Regelmäßig schickt er Teile seiner Sammlung auf Reisen, wenn Museen seine Fallen für Ausstellungen mieten. Es gibt Drahtgitterfallen, Wippbrettfallen und Wasserfallen. Es gibt Mäuseguillotinen und Stromschlagfallen, Quetsch- und Würgeapparate. Es gibt mit Schwarzpulver gefüllte Sprengstofffallen, Mäusehämmer und eine Lebendfalle namens Mausoleum. Jede Art des Tötens lässt sich bei Frank finden: erschießen, ertränken, zerquetschen, vergasen, erschlagen, köpfen, erwürgen. Der neueste Trend: eine Anlage, die eine SMS verschickt, sobald eine Maus in die Falle gegangen ist.
Einmal, es ist schon viele Jahre her, da hat Frank alle Raußmüller, die er finden konnte, zu einem großen Treffen in die Mühle eingeladen. Elf Raußmüller kamen. Eine Nachfahrin aus Schaffhausen in der Schweiz rief an, weil sie nicht dabei sein konnte, aber unbedingt von einer Geschichte berichten wollte, die man in ihrer Familie seit Generationen zu Weihnachten erzählt: Zur Zeit der napoleonischen Kriege, vor rund 200 Jahren, sah der damalige Raußmüller die französischen Reiterheere kommen. Er lief hinaus auf eine Anhöhe. 25000 Franzosen und ein Raußmüller. Er rief, so laut er konnte: «Halt, stehen bleiben, oder es gibt ein Unglück!» Dann feuerte er einmal in die Luft, lief davon und versteckte sich auf dem Ottilienberg, vier Kilometer entfernt. Die Pistole warf er vorher in den Brunnen im Innenhof der Mühle. Die Franzosen brachen das Tor auf, suchten den Heckenschützen, fanden ihn aber nicht. Nach acht Tagen trieb der Hunger den Raußmüller aus seinem Versteck. Napoleons Soldaten waren fort. Die Mühle stand aber noch.
Frank lauschte der Erzählung der Schweizerin bis zum Ende. «Entschuldigen Sie», sagte er dann, «aber ich muss Sie enttäuschen. Die Geschichte kann nicht stimmen. Es gibt keinen Brunnen auf der Raußmühle. Das muss sich jemand ausgedacht haben.» Erst Jahre später stieß er bei Ausgrabungen tatsächlich auf den Brunnen. All die Jahrzehnte war er zugeschüttet gewesen. Er legte ihn frei. Er grub viele Tage. Als er bei fünf Metern angekommen war, fand er die Pistole des Raußmüllers, einen zweiläufigen Vorderlader. Ein Hahn war gespannt und mit Kugel gestopft, der andere war abgefeuert. Das war der Beweis: Die über 200 Jahre alte Geschichte stimmte.
Man begegnet selten Menschen, die so vielseitig interessiert sind wie Frank. Er hat auch seine Vorfahren gesammelt. Er hat die Lebenswege der Dählings bis in das Jahr 591 zurückverfolgt und ihre Geschichten erforscht. Seine eigene scheint er zweigeteilt zu haben – es gibt einen Teil mit Mühle und einen davor, einen ohne: Damals studierte er in Mainz. Dann kam der 2. Juni 1967, ein frühsommerlicher Freitag, der vieles dramatisch verändern sollte. Es war sechs Jahre nach dem Mauerbau, 22 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es sollte noch zehn Jahre dauern, bis damit Schluss war, dass Ehefrauen in Deutschland ihre Männer fragen mussten, ob sie arbeiten gehen dürften, weil sie gesetzlich verpflichtet waren, den Haushalt zu führen. Es war ein Wendepunkt in Franks Leben, denn nun tippte ein Student ihm von hinten auf die Schulter und sagte: «In Berlin ist ein Student erschossen worden. Wir lassen uns das nicht länger bieten! Los, komm mit!» – «Wohin?» – «Wir gehen auf die Straße. Los! Jetzt!» Frank überlegte, nur kurz, dann lief er mit.
Bis zu diesem Moment hatte er sich nicht für Politik interessiert. Er war ein völlig unpolitischer Student der Philosophie, Ethnologie und Paläontologie gewesen. Auf der Demonstration, die vor dem städtischen Theater in Mainz stattfand, waren Hunderte. Frank selber blieb zurückhaltend und schaute sich alles aus einiger Entfernung an. Bis er ohne Vorwarnung den Gummiknüppel eines Polizisten ins Gesicht bekam. Und dann gleich noch einmal. Zunächst war er fassungslos, dann wütend. Schließlich erwachte ein Zorn in ihm, den er so gar nicht gekannt hatte. «Und schon war ich bei der nächsten Demo wieder dabei und hatte eine rote Fahne in der Hand», erzählt er. «Plötzlich war ich mittendrin.»
Der Tod von Benno Ohnesorg in Berlin, erschossen vom Kripo-Mann und Stasi-Spitzel Karl-Heinz Kurras. Die Schläge der Polizei in Franks Gesicht. Die Fotos des Massakers von Mỹ Lai, als US-Soldaten alle 504 Bewohner eines südvietnamesischen Dorfes ermordeten. Das Bild des toten Che Guevara. Die Aufnahme des damaligen Polizeipräsidenten von Saigon, der einen Offizier des Vietcong auf offener Straße mit einem Kopfschuss hinrichtet. Das Foto von Kim Phúc, dem vom Napalm verbrannten Mädchen, das schreiend und voller Angst unbekleidet auf einer Landstraße vor den Bomben flüchtet. Alle diese Bilder, die in kürzester Zeit zu Ikonen des Widerstandes wurden, fraßen sich fest in Franks Hirn. Manchmal konnte er vor Wut kaum schlafen. Es war wie ein Erweckungserlebnis.
Am Abend sitzt Frank in der Wohnstube an einem quadratischen Nussbaumtisch, darin eingekerbt die Initialen FD. Das Harz des Essigbaumes knackt im Lehmofen. Er öffnet die erste Flasche Zweigelt und spricht nun drei Stunden über seine Zeit in Frankreich, ein halbes Jahrhundert her. Paris 1967: Er war 23 und Gaststudent an der Sorbonne, einer der ältesten Universitäten Europas. Ein Zimmer hatte er nicht. Die ersten Monate schlief er unter Brücken. Er war mehr auf der Straße als in den mit Kronleuchtern und Stuck verzierten Hörsälen. Studenten aus der ganzen Welt kamen damals in die Stadt. Viele hatten Blumen in den Haaren, trugen schillernd-bunte Klamotten und manchmal auch gar nichts. Flower-Power in Paris. Es war das Ende der sechziger Jahre und der Anfang der großen Studentenrevolte. Es begann eine friedensbewegte und rebellische Zeit.
Bald wohnte Frank in einem besetzten Haus im 4. Arrondissement, inmitten von Paris. Keine 20 Minuten bis zur Universität. Dort, wo heute das Centre Pompidou steht. Unten im Keller lebten Araber. Nur jede zweite Etage war bewohnt. Die Stockwerke dazwischen waren zugeschissen und zugepisst. Irgendwann suppte alles durch die Decke. Frank hauste in einer verdreckten Rumpelbude mit französischen Clochards und seiner späteren Freundin Marie-Jo. Eines Tages tauchte ein 19-jähriger Deutscher auf. Gerhard war ein Straßendieb. Ein Kleinkrimineller. Ein lustiger Vogel. Schnell verstanden sie sich. Sie lebten ein unsagbar wildes Leben. Sie waren Haschrebellen. Sie saßen nackt auf den Dächern. Frank war barfuß unterwegs und hatte Flöhe im Parka. Seine Stiefel hatte er einem Renato aus Berlin geliehen, der sich für einen Job in einem Geschäft vorstellen wollte, aber keine anständigen Schuhe hatte. Renato stiefelte los und kam nie wieder.
Sehr lustig sind diese Geschichten, so wie Frank sie erzählt. Doch so lustig war das alles gar nicht. Es war ein Leben zugedeckt mit Alkohol. Es war schön und gleichzeitig fürchterlich traurig. Immer wieder wurde er verhaftet und geschlagen, saß Nächte in vollgekotzten Gefängniszellen und wurde am nächsten Tag mit einem Tritt aus der Wache geschmissen. Auf der Straße spielte er gegen Passanten Marienbad, ein Strategiespiel mit Streichhölzern. Der Einsatz: ein Essen. Frank verlor nie. Über Monate hielt er sich so über Wasser. Er wog keine 52 Kilo damals. Und dann wurde er krank und noch dünner. Er konnte nicht mehr schlucken. Schwarze Angina. Er drohte zu verhungern. Gerhard und die anderen trugen ihn auf einer selbstgebauten Bahre einen Kilometer durch das Viertel bis zum Hôtel-Dieu de Paris, dem Armenkrankenhaus. Dort aber konnte niemand die acht Francs bezahlen, um hineingelassen zu werden. Also weiter zu einem anderen besetzten Haus, in dem regelmäßig extravagante Partys im Keller stattfanden. Auch Leute der High Society feierten dort, darunter der französische Beatnik und heutige Popsänger Michel Polnareff, schon damals ein Superstar. Frank brauchte dringend Penicillin. Sie fragten Polnareff. Er gab ihnen 500 Francs. Das rettete Frank das Leben.
Als eines Tages Polizisten die besetzten Häuser stürmten, flüchteten Frank, Marie-Jo und Gerhard über die Dächer. Sie verließen die Stadt. Es war November. Sie wollten in den Süden. Nach Korsika. Sie trampten. Die meiste Zeit liefen sie. Sie bettelten und aßen die nicht gelesenen Trauben, Mandeln und überfahrene Hasen. «Wir hatten die Befreiung der ganzen Welt im Kopf. Nicaragua. Vietnam. Deutschland. Wir wollten die herrschende Klasse vom Sockel stoßen», blickt Frank zurück, «und nun waren wir unterwegs und ganz, ganz arme Würstchen. Kein Geld und nichts zu essen.» In Avignon wären sie fast verhungert. Fast wären sie erfroren. Fast wären sie erschlagen worden. Irgendwann hatten sie nur noch eine Decke und eine Kerze. Diese Erfahrungen haben ihn tief verändert, sagt Frank heute. Und dann tauchte plötzlich sein Vater in Südfrankreich auf. Max Dähling war mit dem Auto gekommen, um seinen Sohn nach Hause zu holen. Und Frank war froh, wieder nach Deutschland zu kommen. Marie-Jo und Gerhard fuhren gleich mit.
In Heidelberg lebten Frank und Gerhard dann als freischaffende Künstler und gründeten eine militante Malergruppe. Frank studierte wieder. Im Sommer 1971 durchschoss er auf dem Marktplatz eine Leinwand mit einem Kleinkalibergewehr und signierte das Bild. Er nannte es «Die Ermordung der Petra Schelm». Sie war das erste Mitglied der RAF gewesen, das wenige Tage zuvor in Hamburg von einem Polizisten erschossen worden war. Sie war die Freundin von Thomas Weisbecker, der in Augsburg erschossen wurde. Weisbecker war ein Freund von Georg von Rauch, der in Berlin erschossen wurde. Solche Zeiten waren das damals in Deutschland.
«Es war Krieg», sagt Frank, der nun eintaucht in die siebziger Jahre, in eine erstarrte und zugleich bewegende Zeit. Es war das finsterste Kapitel in der Geschichte der jungen Bundesrepublik. Es war die Zeit, als sich Deutschland vor Terroristen fürchtete. Nicht vor irgendwelchen islamistischen Gewalttätern, sondern vor deutschen Bürgerkindern aus meist behüteten Elternhäusern. Jeder Motorradfahrer konnte gleich seine Waffe ziehen. In jedem Kofferraum konnte eine Geisel liegen. Jeder Langhaarige mit Parka war ein Bombenleger. Autojagden, ungeschickte Banküberfälle, Perücken, Pistolen, die nicht funktionierten, Pistolen, die funktionierten, Bekennerschreiben, Sondermeldungen der Polizei im Radio. Es war eine bleierne Zeit der Hilflosigkeit und der Hysterie. Es waren erschütternde und absurde Jahre, als jeder zweite Deutsche die Todesstrafe forderte. Überall hingen übergroße gelbe Fahndungsplakate mit den Fotos, auf den die Personen immer sehr böse guckten. Zum Fürchten sollten diese Verbrechervisagen aussehen. Kam einer von ihnen ums Leben oder wurde gefasst, wurden die Gesichter auf den Steckbriefen mit einem schwarzen Stift durchkreuzt. «Terroristenlotto» nannte man das damals. Eine solche theatralische Suche hatte es sonst nur im Western gegeben. Tot oder lebendig. Mit Belohnung. 1000 Mark. 10000 Mark. Später sogar 100000 DM für Hinweise, die zur Ergreifung der Gesuchten führten. Der Staat war der RAF auf den Leim gegangen und hatte sich selber nicht mehr unter Kontrolle.
Auch Frank fühlte sich als Revolutionär. Er war Mitglied im Kommunistischen Bund Westdeutschlands. Robert Mugabe, damals Kommunist und später einer der schlimmsten Diktatoren Afrikas und mordender Unterdrücker Zimbabwes, schlief in Franks WG auf dem Boden auf einer Luftmatratze. Er kannte auch viele, wie Klaus Jünschke, Elisabeth von Dyck oder Siegfried Hausner, die später den Weg der Gewalt wählten, der nicht seiner werden sollte. «Unser Hass war groß, meiner auch», denkt Frank zurück, «wir hatten es satt, zu politischen Fragen zu schweigen. Wir waren wütend, voller Tatendrang und gleichzeitig ohnmächtig. Wir haben die Leute der RAF gekannt. Wir haben auch mit denen diskutiert. Wir haben sie aber nie unterstützt. Und zum ersten Mal erlebte ich, wie sich Freunde von mir radikalisierten, die es anfangs wirklich gut gemeint hatten.»
Er selber war auch nicht frei von romantischer Verklärung. Er bewunderte die RAF und ihre Anführer, vor allem die frühere Journalistin Ulrike Meinhof, die forderte: Mensch oder Schwein, jeder müsse eine Entscheidung treffen. Dafür oder dagegen, das war keine Alternative, sondern ein auferlegter Zwang. Gegen den Staat. Gegen die Alt-Nazis, von denen viele wieder in höchsten Ämtern saßen. Gegen die eigenen Eltern. Gegen das Schweinesystem. Vereint im Protest gegen den Vietnamkrieg. Unter den Studenten galt eine Art revolutionäre Moral. Manche rissen ihre Passbilder aus den Personalausweisen und klebten Fotos von Che Guevara oder Ho Chi Minh hinein. Viele hatten sich aufgemacht, die Gesellschaft zu verändern. Sie waren angetreten, das Land zu revolutionieren. Aber das allein genügte ihnen nicht, sie wollten auch die Menschen verwandeln, am besten jeden einzelnen. Arbeitskreise, Versammlungen, Flugblätter. Nächtelange Diskussionen im legendären Hörsaal 13 der Heidelberger Uni. Schließlich ging es um nicht weniger als um eine bessere Welt, um bessere Erziehung, um Gleichberechtigung, freie Liebe, Schluss mit dem Muff. Sie wollten die ganz große Revolte, die den Kapitalismus stürzen sollte. Du kannst alles ändern, du musst es nur tun! Das war der Sound der Achtundsechziger. Das war die Idee. Die Wirklichkeit sah anders aus.
«Wir sind völlig vernarrt gewesen und haben uns gnadenlos selbst überschätzt», so sieht es Frank heute, «wir haben uns verblendet in etwas hineingesteigert.» Überall waren Befreiungsbewegungen entstanden. Doch immer nur reden genügte irgendwann nicht mehr. Aus Befreiungskämpfern wurden Verbrecher. Und was heute auf die drei Buchstaben RAF zusammengeschnurrt ist, war einst ein deutsches Schlachtfeld, das sehr viel größer war: die Bewegung 2. Juni, die Revolutionären Zellen, die Schwarze Hilfe, die Rote Zora, in Heidelberg das Sozialistische Patientenkollektiv (SPK), anfangs eine Art Therapiegemeinschaft von Ärzten, Pflegern und Patienten der psychiatrischen Uniklinik, dann eine zunehmend militante Gruppe, die immer radikaler wurde und mit der RAF gemeinsame Sache machte. Und was damals, im Frühjahr 1971, kaum einer wusste: Die bundesweit gesuchten führenden Köpfe der RAF – Baader, Ensslin, Meins, Meinhof und Raspe – kamen monatelang immer wieder in der Kellerwohnung der Heidelberger Psychologiestudentin und späteren Terroristin Margrit Schiller in der Uferstraße 52 unter.
Es dauerte nicht lange, und auch Gerhard war bei den Treffen des Patientenkollektivs dabei. Er bewaffnete sich. Wenige Wochen später ging er in den Untergrund. Frank weiß noch, wie er ihn das letzte Mal traf, im Juli 1971. Sie saßen in Franks Zimmer, und keiner sprach ein Wort. Sie glaubten, überwacht zu werden. Alles, was sie sagen wollten, schrieben sie auf ein Stück Papier. Sie schoben ihre Sätze hin und her und verbrannten alles in einem Aschenbecher. Frank war zutiefst erschüttert. Gerhard war ein Rad in der Terrormaschine der Roten Armee Fraktion geworden. Nur vier Monate später wurde er zum Mörder. In Hamburg erschoss er den Polizisten Norbert Schmid. Es war der 22. Oktober 1971, und von jetzt an nannte man die Terroristen nicht länger «Baader-Meinhof-Bande», was zu sehr nach Lausbubenstreich klang. Denn jetzt lag ein 32-jähriger Beamter tot auf der Straße, der auch Ehemann und Vater zweier Mädchen im Alter von fünf und sechs gewesen war. Dieser Tag veränderte alles. Es war der erste Mord der RAF. Und die Gewalt wurde mehr.
Frank verfolgte aus der Ferne, in den Zeitungen und im Radio, wie alles weiterging: Im Juni 1972 wurde Gerhard an der Seite von Ulrike Meinhof in Langenhagen bei Hannover festgenommen. Bei der Verhaftung hatte er dummerweise Franks Adresse in der Tasche. Mit einem Schlag war nun auch er im Visier der Behörden, wurde befragt und überwacht. Immer wieder fühlte er sich verfolgt. Später bekam er Briefe aus der Haft, die mit Gerhard Müller unterschrieben waren. «Einmal sogar mit Gerd Müller», erinnert er sich, «dabei hatte er sich niemals Gerd genannt. Außerdem waren die Briefe mit verschiedenen Schreibmaschinen getippt. Sie waren nicht von ihm, sondern von der Polizei», glaubt Frank bis heute. Gerhard wurde zu einem der Kronzeugen im Stammheim-Prozess, wo er gegen Baader, Meinhof & Co. aussagte. Die Anklage wegen Mordes wurde fallengelassen. 1979, nach sechseinhalb Jahren, kam er frei, bekam eine neue Identität und tauchte ein zweites Mal unter. Dieses Mal für immer. Frank weiß bis heute nicht, ob er noch lebt. Das weiß keiner. Gerne hätte er noch einmal mit Gerhard gesprochen. Über 70 müsste er heute sein. Er soll vor über zehn Jahren gestorben sein, heißt es. Er soll sich umgebracht haben. «Oder wurde er ermordet? Vielleicht sogar von den eigenen Genossen?», rätselt auch Frank noch immer.
Irgendwann hatte Frank erkannt, dass die Dinge sich nicht so verschieben würden, wie er und die anderen immer gedacht hatten. Es kam die Erkenntnis, dass die Revolution nicht stattfinden würde. Und er fragte sich: Was fange ich nun an mit meinem angebrochenen Leben? Er war fast fertig mit dem Studium, dann brach er die Brücke hinter sich ab, wie er sagt. Nach 14 Semestern verbrannte er seine angefangene Magisterarbeit. So ein Abschluss wäre damals viel zu bürgerlich gewesen. Der junge Hippie wollte zurück zur Natur. Er wollte Bauer werden. Immer war vom großen Aufbruch die Rede gewesen, Aufbruch hierhin, Aufbruch weiß Gott wohin. Doch nun stand plötzlich eine ganz andere Frage im Raum: Wo liegen eigentlich meine Wurzeln? Und dann kam die Magie des Moments: Frank entdeckte die Raußmühle.
Doch auch in den Jahren danach stand Frank weiter unter Beobachtung. Einmal wurde die Mühle von 30 Polizisten mit Maschinenpistolen umstellt. Immer wieder wurde alles durchsucht. Es tauchten Leute auf, die behaupteten, ihn von früher zu kennen. Sie stellten Fragen und verschwanden wieder. Er wurde verdächtigt, die RAF zu unterstützen. Zu jener Zeit langten dafür schon ein paar Benzinkanister im Keller. Und manchmal, meint er, habe er sich wohl auch gefürchtet, wo gar nichts zu fürchten war. Aber das ist jetzt auch vorbei. Das Band zeigt fünf Stunden und 21 Minuten. Frank hat leichte Kopfschmerzen. Der Rotwein. Das viele Reden. Er hat den ganzen Tag geredet. Es ist weit nach Mitternacht.
Am nächsten Vormittag fährt Frank nach Eppingen zu einem großen Supermarkt. Jeden Tag rettet er dort haufenweise Essen vor der Mülltonne. Für seine Tiere. Hinten am Lieferanteneingang warten bereits zwölf grüne, prallgefüllte Gemüsekisten mit Kartoffeln, Salatköpfen und Pilzen, mit Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Äpfeln, mit Spargel, Orangen und Lauch. Sechsmal die Woche holt er ab, was aussortiert wird. Zweimal die Woche fährt er zur Eppinger Tafel. Selbst dort bleibt immer etwas über. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel sollen es sein, die in Deutschland jedes Jahr weggeschmissen werden. Das sind 220 Kilo pro Person. Weil Essen immer und überall zu bekommen ist, hat es an Wert verloren. Was ich heute kaufe, kann ich morgen wegschmeißen. Absurde EU-Normen, strenge Gesetze. Wie groß darf ein Apfel sein? Wie lange ist ein Joghurt mindestens haltbar? Eine Gurke darf auf zehn Zentimeter Länge maximal zehn Millimeter gekrümmt sein. Alles ist peinlichst genau geregelt. Und was auch nur im Kleinsten nicht den Richtlinien entspricht, wird aussortiert. Frank sagt: «Aus Essen wird Müll. Wir verspotten die Natur.»
Auf dem Rückweg zur Mühle werden Hunderte Fruchtfliegen mitfahren. Sie werden vorne auf dem Lenkrad und auf dem Armaturenbrett sitzen. Nun aber muss Frank doch noch mal rein in den Markt, Quark und Schmalz besorgen. Wie ein Fremdkörper wirkt er zwischen den Regalen und Tiefkühlschränken. Der Konsum ist ihm zutiefst zuwider. Er hasst Geld. Man muss es so sagen. Er selber sagt: «Ich bin ein Feind des Geldes.» Bis heute verwechselt er «Mark» mit «Euro». Vielleicht auch nicht ganz unabsichtlich. Und nun steht er in der endlosen Schlange an der Kasse und erzählt vom Dachsenfranz, einem Italiener, der um 1870 in Eppingen auftauchte. Ein Waldmensch, der in selbstgegrabenen Erdhöhlen lebte, der sich mit Kräutern und Hexenwerk auskannte. Er wurde gerufen, wenn irgendwo Ratten, Mäuse oder Dachse gefangen werden mussten. Und ebenso froh waren die Leute, wenn dieser seltsame, etwas unheimliche Fallensteller wieder fort war. Auch, da er nicht besonders gut roch, regelmäßig schmierte er sich mit einer selbstgemachten Paste ein. Ein Eigenbrötler, der kurz vor dem Ersten Weltkrieg spurlos verschwand und schon deshalb zu einem Mythos wurde, der aber auch durchaus ein Feinschmecker war. Frank ist jetzt Franz, mit knorriger Stimme raunt er: «Has’ zäh, Katz’ gut, Dachs sährr gut, sährr gut!» Die anderen Kunden an der Kasse gucken leicht verstört.
Die nächsten Stunden wird Frank durch seine Bibliothek im Obergeschoss der Mühle führen. Wenn die Tage kürzer werden, sitzt er hier im Sessel. Dann liest er. Dann forscht er. Drei Räume. Mehr als 25000 Bücher. Gestapelte Werke. Bretterweise Belletristik. Alle gelesen hat er nicht. Undenkbar. Sie wachsen aus den Regalen auf den Boden und in den Flur hinein. Er hat sie auf Flohmärkten oder in Antiquariaten gefunden. Er hat sie ersteigert oder geschenkt bekommen. Längst musste er sie in zweiter oder gar dritter Reihe schichten. Statisch gesehen könnte es bald bedenklich werden. Einer der Räume kann gar nicht mehr betreten werden, obwohl die Tür fehlt. Hunderte Bücher versperren den Eingang. «Die Bücher, die hinten stehen, sind für mich verloren», sagt Frank, «die werde ich in diesem Leben nicht mehr in die Hand nehmen können.» Seit Jahren sortiert er. Gerade ordnet er die volkskundliche Abteilung. Hier die Widerstandsliteratur. Dort Räuber, Vagabunden, Obdachlose und Außenseiter, Figuren auf der Kippe, Zauberer und Prozesse. Tausend Bücher über die Geschichte der Zigeuner. In einer anderen Ecke seine magische Bibliothek mit Grundformeln der Zauberei. Oder: Das Buch der Geheimnisse. Eine Sammlung 260 besonders magnetischer und sympathetischer Mittel wider Krankheiten, körperliche Mängel und Übel und zur Beförderung unserer nützlichen und wohltätigen Zwecke. Oder auch: Alchemie und Mystik. Die Elixiere des Nostradamus. Das Seelenleben der Heiligen. Die Seherin von Prevorst. Geisterstunde der Gelehrten. Geschichte der Inquisition. Die Philosophie des Störenfrieds. Es dauert nicht lange, und im Kopf dreht sich alles.
«Wenn ich noch Zeit finde» – ein Satz, den Frank häufiger mal sagt. Er macht zu viel. Er hat noch viel vor. Vielleicht zu viel. Mal sehen. Gerade saniert er das alte Bachbett hinter der Mühle mit Helfern des Fördervereins, den er gegründet hat. Denn das ist das Einzige, was noch fehlt: das Rauschen des Wassers und das Klappern des Mühlrades. Das ist sein Traum. Doch jeder Tag, an dem dieses Projekt nicht zu Ende geführt wird, macht es schwieriger. Kinder hat Frank keine. Auch Heidis Tochter möchte den Hof nicht übernehmen. «Falls sich doch jemand finden sollte, darf nichts verkauft werden. Alles muss erhalten bleiben», sagt er. So will er es auch in sein Testament schreiben. Vielleicht wird der Förderverein die Mühle und das Museum mal fortführen. Und wie es auch sein wird, wird es am Ende tragisch sein: Denn kein Mensch wird diese Sammlung jemals annähernd so verstehen wie er. Viele Geschichten werden auf immer verloren sein. Doch was bleibt von einem Menschen, wenn er gestorben ist? Frank sagt: «Bei mir wird es wohl mal heißen: Da lebte einer, der die Mühle gerettet hat.»
Wind setzt ein und streicht durch die Bäume und den Hof. Es regnet Blätter. Vom Sumpf der Elsenz zieht feuchter Dunst in undurchsichtigen Schwaden herüber. Wie weiche Nebelgeister wabern sie über die Wiesen. Frank geht noch einmal raus und holt seine Viecher rein. Es gibt Menschen da draußen, die ihn einen Querkopf und die Raußmühle eine Insel der Rückständigkeit nennen. Andere sprechen von einem Gegenentwurf zur industrialisierten Welt. Und wieder andere sehen diesen Ort als gelebtes Gesamtkunstwerk. Frank sagt: «Manche halten es für verrückt, was ich hier mache. Ich finde es sehr vernünftig.» Doch eines betont er: «Die Mühle ist kein Idyll, dafür müssen wir zu sehr für ihren Erhalt kämpfen. Es ist der Versuch, ein winziges Stückchen Erde aus dem Kampf gegen die Natur herauszuhalten.» Und dann lehnt er sich zurück, nippt an seinem Rotwein und zitiert einen Spruch aus alter Zeit: «Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.»
THÜRINGEN
2Stern? Schnuppe!
Früher kochte sie groß, dafür bekam sie einen Stern. Heute kocht sie klein und kommt groß raus. Maria Groß ist eine ungewöhnliche Köchin, die sich in Erfurt selbst verwirklicht. In der Küche. Im Garten. Zu Hause. Willkommen in der Ostzone.
Allein durch ihren Namen gehört sie zu den Menschen, die im Fernsehen größer wirken als in echt. Er ist wie geschaffen für eine eher kleine Frau. Und auch an diesem Tag Anfang Mai ist Maria Groß nicht zu übersehen. Sie trägt eine plüschige, braune Pelzweste – optisch eine Mischung aus Kaninchen, Schaf, Vogel und Fuchs –, dazu Jeans und Turnschuhe. Ihre langen dunkelbraunen Haare hat sie wild nach oben gezwirbelt. Eine Spange mit Filzblume gibt Halt. Die Sonnenbrille steckt im Haar – als wäre sie im Urlaub. Auch zu überhören ist Maria nicht. Wohlwollend beschrieben: Sie hat ein Lachen, das man nie mehr vergisst. Laut und lang. Oft auch ein bisschen schmutzig. Aber immer geradeheraus und echt. Man könnte sagen: Sie lacht, wie sie ist.
Am Morgen war Maria mit dem Zug aus München gekommen. Sie hatte dort für eine Kochshow vor der Kamera gestanden. Nun ist sie müde, kniet auf einem Acker in der Nähe von Weimar und wühlt in schwarzbrauner Erde. Heichelheim ist in ganz Thüringen bekannt. Es ist das Kartoffeldorf. Hier gibt es ein Kloßmuseum, wo der Besucher den Weg der Knolle zum Kloß mit Soße erleben kann. Oder Antworten auf wegweisende Fragen bekommt wie: Kannte Goethe Klöße? 300 Einwohner hat der Ort, und alles dreht sich um das Eine.





























