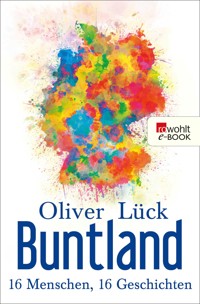9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In unserer digitalen Welt wirkt eine Flaschenpost wie ein Relikt aus uralter Zeit. Doch sie ist zeitlos. Und grenzenlos. Sie ist wie ein Schatz. Im Sommer 2008 begegnet Oliver Lück einer Lettin, die ihm 35 Briefe aus dem Meer zeigt. Jetzt macht er sich auf die Suche nach den Absendern. Sein Weg führt ihn von Litauen bis Deutschland, von Dänemark nach Russland und sogar bis in die Niederlande. Er besucht Arne, einen schwedischen Fischer, der auf einer entlegenen Insel lebt und über 100 Briefe gefunden hat. Er lernt einen Flaschenpostredakteur aus Kiel kennen, der eine Zeitung herausgibt, die man nicht kaufen, aber finden kann. Und auf Rügen trifft er einen Mann, der regelmäßig Nachrichten mit Wind und Wellen verschickt und schon mehr als 30 Antworten aus sieben Ländern bekommen hat. «Flaschenpostgeschichten» nimmt sich Zeit für besondere Menschen und ihre Erzählungen, die alle über die Ostsee miteinander verbunden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Oliver Lück
Flaschenpostgeschichten
Von Menschen, ihren Briefen und der Ostsee
Über dieses Buch
In unserer digitalen Welt wirkt eine Flaschenpost wie ein Relikt aus uralter Zeit. Doch sie ist zeitlos. Und grenzenlos. Sie ist wie ein Schatz. Im Sommer 2008 begegnet Oliver Lück einer Lettin, die ihm 35 Briefe aus dem Meer zeigt. Jetzt macht er sich auf die Suche nach den Absendern. Sein Weg führt ihn von Litauen bis Deutschland, von Dänemark nach Russland und sogar bis in die Niederlande.
Er besucht Arne, einen schwedischen Fischer, der auf einer entlegenen Insel lebt und über 100 Briefe gefunden hat. Er lernt einen Flaschenpostredakteur aus Kiel kennen, der eine Zeitung herausgibt, die man nicht kaufen, aber finden kann. Und auf Rügen trifft er einen Mann, der regelmäßig Nachrichten mit Wind und Wellen verschickt und schon mehr als 30 Antworten aus sieben Ländern bekommen hat. «Flaschenpostgeschichten» nimmt sich Zeit für besondere Menschen und ihre Erzählungen, die alle über die Ostsee miteinander verbunden sind.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, April 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Tobias Schumacher-Hernandéz
Karten Peter Palm, Berlin
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
Umschlagabbildung und Fotos im Tafelteil Oliver Lück
ISBN 978-3-644-54911-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Ostsee ist Postsee
1. Kapitel
Die Briefe der Biruta Kerve
In den Wind geschrieben
2. Kapitel
«Schjene liebe Gruesse aus Russland»
Der Flaschenpostautomat
3. Kapitel
Herrn Arnes Schatz
«Eine Flaschenpost ist völlig unzeitgemäß»
4. Kapitel
Tief im Westen
Planschen in Plastik
5. Kapitel
Auf Augenhöhe mit dem Meer
«Ich bin doch bloß der Postbote»
6. Kapitel
Einsame Spitze
36818 Tage
7. Kapitel
Sara auf Safari
«Flaschenpost finden ist wie Pilze sammeln»
8. Kapitel
Wortschätze
Käpt’n Kork, bitte melden …
9. Kapitel
Stille Post
Paldies, Tak, Ačiū, Spasiba, Dziękuję, Tack und Danke an …
Bildtteil
Ostsee ist Postsee
Es gibt Sachen, die nur Kinder machen: auf einer Autobahnbrücke stehen und winken. Kaugummis am Automaten an der Ecke ziehen. Einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann schicken. Oder Briefchen schreiben, die man, klein gefaltet und nass geschwitzt, seiner großen Liebe zusteckt. Darauf die alles entscheidende Frage: Willst du mit mir gehen? Gleich darunter die möglichen Antworten mit den Kästchen zum Ankreuzen: Ja. Nein. Vielleicht. Weiß nicht.
Auch eine Flaschenpost gehört zu den Ideen, auf die bloß Kinder kommen können. Dachte ich immer. Genauer gesagt, glaubte ich das bis zum 26. Juni 2008. Damals fuhr ich mit meinem alten VW-Bus von Land zu Land. Viel Zeit und kein Ziel. Europa ohne Ende. Das war der Plan. Nach der Reise wurde sogar ein Buch daraus, mit Geschichten, die mir in 20 Monaten begegnet waren. Es heißt «Neues vom Nachbarn – 26 Länder, 26 Menschen».
Einen dieser Menschen traf ich an besagtem Tag Ende Juni in einem Dörfchen namens Nida. Ich war gerade von Litauen nach Lettland gefahren und hinter der Grenze auf die erste Sandpiste in Richtung Meer abgebogen. Eigentlich suchte ich nicht mehr als einen ruhigen Schlafplatz, doch dann entdeckte ich einen mit Treibgut bunt geschmückten Garten, der eigentlich kein Garten, sondern eine große Galerie war. Bestückt mit aus Müll gebauten Kunstwerken. Hier lebte eine weißhaarige Frau, damals Mitte 60. Mit Biruta Kerve fing alles an.
Denn am Strand vor ihrer Haustür hatte sie nicht nur viel Plastik und Treibholz gesammelt. Sie hatte auch reichlich Flaschenpost gefunden. Liebesbriefe und Urlaubsgrüße. Zettel voll Wut und Bitterkeit. Nicht ernst gemeinte Hilferufe, Gedichte und kleine Malereien. 35 Briefe aus der Ostsee. Viele von Kindern. Die meisten von Erwachsenen. Biruta hatte allerdings nie Antworten geschrieben. Sie sprach kein Englisch und kaum Deutsch. Sie hatte kein Telefon und keinen Computer. Aber sie verwahrte die Schriftstücke für viele Jahre wie einen Schatz.
Also machte ich mich daran, den Absendern vom Fund ihrer Flaschenpost zu erzählen. Ich telefonierte, schrieb Karten und tippte weit über 500 E-Mails. Ein reger Schriftverkehr entwickelte sich. Ich wollte wissen, was für Menschen dahintersteckten, was für Geschichten sie erzählen konnten. Einige Botschaften blieben Briefgeheimnisse, da die Schreiber nicht mehr zu erreichen waren. Manche der Kinder von damals waren längst erwachsen und hatten selber Kinder.
Zwei Jahre fuhr ich immer wieder in die Ostseeländer, um diese Menschen zu treffen. Und die Recherche nahm ungeahnte Ausmaße an: Denn eine der Nachrichten kam von Thomas, der auf Rügen lebt. Er verschickt regelmäßig Flaschenpost. Das ist sein Hobby. 30 Antworten hat er schon bekommen. Eine von Mogens, einem dänischen Strandpolizisten von der Insel Bornholm, der seit 1971 mehr als 200 verkorkte Postwurfsendungen gefunden hat, viele davon aus DDR-Zeiten.
Durch diese Briefe lernte ich weitere Schreiber kennen: eine junge Dänin, die sechs Sprachen spricht und in Tansania eine zweite Heimat gefunden hat. Einen Schriftsteller aus Malmö, der in den neunziger Jahren seinen Herzenswunsch in eine Flasche steckte und auf die Reise schickte: Er wollte Schriftsteller werden. Einen Meeresbiologen aus der Ukraine, der auf seinen Forschungsfahrten in aller Welt schon mehr als 200 Mal Flaschenpost geschrieben und diese mit Seriennummern versehen hatte. Oder eine holländische Schulklasse, deren Flasche auf kuriosem Wege von Rotterdam nach England, durch Nord- und Ostsee bis nach Lettland wanderte. Darin auch der Wunsch eines Jungen mit den wohl größten Dingen, die sich ein Zehnjähriger vorstellen kann: Star Wars und Weltfrieden.
Am Ende hatte ich eine Auswahl von fast 300 Briefen. Die meisten gut lesbar, nur wenige von der Sonne ausgeblichen oder vom Salzwasser zersetzt. Ein roter Faden spann sich kreuz und quer durch die Ostsee. Ein soziales Netzwerk. Denn alle diese Menschen sind als Absender und Finder über zwei oder drei Ecken miteinander verbunden. Geschichten, die das Meer schreibt: Flaschenpostgeschichten.
Wie die von Arne, einem bärtigen Fischer, der auf einer winzigen Insel in Südschweden lebt. Er hat vier Nachbarn und fährt selten ans Festland, nur dann, wenn es unbedingt sein muss. Und wenn er zurückkommt, ist er froh, wieder zu Hause zu sein. Arne hat seinen Platz im Leben gefunden. Er hat auch schon mehr als 100 Flaschen mit Post gesammelt. Vor Jahren mal war eine von Thomas aus Deutschland dabei. Und auch das ist eine Verbindung in diesem Buch: Ich treffe eine Frau in Lettland, die mir eine Flaschenpost aus Deutschland zeigt, dessen Schreiber mir von einem schwedischen Fischer erzählt. Manchmal ist es gut, sich von den zufälligen Begegnungen leiten zu lassen.
In Zeiten von Passwörtern und Profilbildern, wo alle stets erreichbar, aber niemals greifbar sind, wo man 245 beste Freunde hat und an allen Ecken geliked, gelöscht oder gefolgt wird, wirkt eine Flaschenpost wie etwas Uraltes aus einer anderen Welt. Wie ein Selfie aus der Steinzeit. Denn sie tut das, was vielen heute seltsam erscheint: Sie lässt sich Zeit. Manchmal nur ein paar Tage, meist viele Jahre, oft für immer. Wobei, manchmal kann auch schon ein Paket, das man kurz vor Weihnachten zur Post bringt, zum Abenteuer werden.
Vor Jahren mal wollte ich ein Päckchen an einen guten Freund schicken. Darin lauter kleine Kostbarkeiten, die ich nicht mehr brauchte, die aber einen gewissen Wert hatten und im Internet sicher Höchstpreise erzielt hätten. Wie zum Beispiel noch originalverpacktes goldenes Lametta aus dem Jahr 1982. Es war ein richtig gutes Lametta. Es hatte feine Fäden, die trotzdem schwer genug waren, um auch wirklich hängen zu bleiben. Oder eine stark verstaubte Kassette mit Polkamusik aus dem Jahr 1986. Eine Dose Labskaus aus dem Vorratskeller meiner Eltern, das Mindesthaltbarkeitsdatum war abgelaufen, als es im Fernsehen noch drei Programme und Sendeschluss gab. Sogar einen langen Zopf, den ich mir viele Jahre zuvor abgeschnitten und in eine Schublade gelegt und vergessen hatte, packte ich in den Karton.
Das Paket aber kam nie an. Ich brachte es zur Post, und es verschwand. Bis heute frage ich mich, wo das Lametta und das Labskaus geblieben sind und was derjenige, der das Päckchen öffnete, wohl dachte, als er meine Haare sah. Er wird sich gewundert haben, so viel ist sicher. Vielleicht wird er sich sogar geärgert haben. Es waren ja auch 500 Lose für den Jahrmarkt beigelegt – alles Nieten.
Es gibt Menschen, die ihre Kontoauszüge schreddern und in Plastikflaschen stecken, um sie meistbietend bei E-Bay zu versteigern. Dazu der Hinweis: Wollten Sie nicht immer schon mal etwas völlig Verrücktes kaufen? Und es gibt Menschen, die dafür 2,99 Euro ausgeben. Plus 2,50 Euro Versand. Früher gab es so etwas nicht. Und früher war die Ostsee das, was den Osten vom Westen trennte. Heute verbindet sie. Früher schrieb man «privat» auf einen Brief, wenn man sichergehen wollte, dass er nicht auch von anderen gelesen werden sollte. Heute schreibt kaum noch jemand Briefe. Auch Zeitungsannoncen, in denen Brieffreunde gesucht werden, sind verschwunden. Es sind keine Telefonzellen mehr da. Das Klick und Klack der Schreibmaschinen ist verklungen. Selbst Zeitungen und Bücher kämpfen ums Überleben.
Doch auch heute findet man sie noch: die Dinge, die irgendwie schon immer da waren und einfach nicht verloren gehen wollen. Visitenkarten zum Beispiel, die immer griffbereit sind, auch wenn das Smartphone längst den Geist aufgegeben hat.
Oder eine Flaschenpost natürlich, die schon da war, als Frauen und Männer noch Kinder waren. Die heute noch da ist, wenn gestresste Männer und Frauen wieder wie Kinder sein wollen. Denn eine Flaschenpost ist zeitlos. Das habe ich in den Jahren der Recherche zu diesem Buch gelernt. Und das Meer, so hat es Arne, der schwedische Fischer, mir erzählt – und ich glaube ihm, denn er muss es ja wissen: «Das Meer», sagte er, «das kennt keine Wege. Es kennt bloß Richtungen.»
Einigen wird die Flaschenpostgeschichte, die nun folgt, bekannt vorkommen. Sie steht etwas kürzer in «Neues vom Nachbarn». Doch genau dort muss dieses Buch jetzt beginnen: in Lettland. In Birutas buntem Garten am Strand von Nida. Im Sommer 2008.
1
Die Briefe der Biruta Kerve
Sie lebt alleine in einer Holzkate am Strand und sammelt das, was die Ostsee ihr bringt. Für andere ist es nicht mehr als der Müll des Meeres. Für Biruta aus Lettland sind es Geschenke, die ihr der Wind und die Wellen machen – darunter 35 Flaschenpostbriefe aus halb Europa.
Der schmale Pfad führt durch einen Kiefernhain bis auf eine Düne, wo eine kleine Holzbank steht. Von hier hat sie einen guten Blick. Manchmal sitzt sie einfach nur da und schaut zu, wie die Ostsee ihre Farbe wechselt und mit schäumenden Zungen über den Strand leckt. Sie hört den Möwen zu, die so schrill und ausdauernd schreien, als ginge es um Leben und Tod. Und dann tapst Biruta Kerve los, sie geht auf die Suche. Sie liest auf, was das Meer sich irgendwann geholt hat und nun zurückgibt. Sie sammelt, was die letzte Flut in den braunschwarzen Spülsaum geschleppt hat, was die Stürme in den Schilfgürtel geschmissen haben, was ganz vorne, wo Wasser und Land sich trennen, in der Brandung dümpelt.
Heute sind es zwei Dutzend Flaschenverschlüsse, eine Zahnbürste, ein Feuerzeug, fünf leere Flaschen Wodka, eine Packung Erdnüsse aus Deutschland, eine Dose Schnupftabak aus Schweden und acht Dosen Mais aus Russland, rostig und angefressen vom Salzwasser, aber laut Aufdruck noch vier Jahre haltbar. Die Ostsee muss eine Menge schlucken, doch irgendwann spuckt sie alles wieder zurück an Land.
Für andere ist es nicht mehr als der Müll des Meeres. Für Biruta sind es Geschenke, die ihr der Wind und die Wellen machen. Sie trägt die Fundstücke in ihren Garten hinter der Düne und fügt sie ein in ihr Gesamtkunstwerk. Schutzhelme, Rettungsringe, Frisbeescheiben. Puppen, Uhren, Verkehrshütchen und Schleppnetze – Dinge, die verloren gingen oder im Sturm gekappt werden mussten. Einmal hat sie einen Fernseher gefunden, er funktionierte noch. Ein anderes Mal einen Feuerlöscher, dann einen Kühlschrank, einen Wasserkocher oder Kaffeemaschinen. Vier Kilogramm Orangen, kistenweise Bananen. «Die Tage danach gab es Bananenkuchen», erzählt sie, «auch viele Gläser Püree und Marmelade habe ich eingekocht.» Und regelmäßig kommt Brennholz an.
Biruta sagt: «Das Meer gibt und nimmt. Doch oft ist es großzügig zu mir. Jeden Tag werde ich neu überrascht. Jeden Tag sieht der Strand anders aus.» Und auch ihr Garten verändert sich: Fahnen in vielen Farben flattern an meterlangen Ästen im Wind. Bojen, mit denen Fischer ihre Leinen markieren, wachsen wie riesige Früchte an den Bäumen. Seltsame Wesen aus knorrigem Treibholz glotzen ihre Betrachter mit Flaschendeckelaugen an. Zahnbürsten sind zu Blumenmustern arrangiert. Einen Ölanzug, wie ihn Arbeiter auf Bohrinseln tragen, hat sie ausgestopft, mit einem Fußball als Kopf, und ihm eine Sonnenbrille aufgesetzt. Badelatschen sind in Reihe an den Hühnerstall genagelt. Die Hühner übersieht man in dieser bunten Welt aus Treibgut.
Von Nida, wo Biruta lebt, sind es gerade mal zwei Kilometer bis zur Grenze. Es ist das südlichste Dorf an Lettlands Küste – vermutlich auch das einsamste. Stundenlang kann man am Strand laufen, ohne einem Menschen zu begegnen. Während im Norden in Liepāja und im Süden im litauischen Palanga Touristen ihre Badetücher ausbreiten, Luftmatratzen aufpusten und dicht gedrängt am Strand liegen, hat es hier noch nie nach Sonnencreme gerochen, hat noch nie ein Verkäufer Eis am Strand verkauft. Der Eiserne Vorhang hing gleich hinter Birutas Holzkate – zwischen ihr und dem Meer.
Der Strand war zu Sowjetzeiten gesperrt. Es patrouillierten Soldaten. Wachtürme standen alle 100 Meter. Und doch lebten damals mehr Menschen hier, über 100. «Fast alle waren Fischer», erzählt Biruta, «doch dann durfte keiner mehr zur See.» Die Ruderboote wurden mit Äxten in Stücke gehauen. Tag für Tag pflügte das Militär breite Furchen in den Sand, um die Spuren möglicher Flüchtlinge oder Spione sofort entdecken zu können. Den Menschen sollte die Flucht so schwer wie möglich gemacht werden. Fast 50 Jahre lang.
Biruta hat in dieser Zeit in drei verschiedenen Staaten gelebt, ohne auch nur das Haus verlassen zu haben. 1944 wurde sie im von Nazi-Deutschland besetzten Lettland geboren. Ein Jahr später eroberte die Sowjetunion die Küstenlinie zurück. Und 1991 wurde Lettland wieder unabhängig. «Der schönste Tag meines Lebens», sagt Biruta heute noch. Auch wenn damals vieles schwieriger wurde und viele Letten – als die Freiheit endlich Gewissheit war – Reißaus nahmen. Die meisten Höfe sind seit Jahren verlassen. Man hat sie aufgegeben und lässt sie verfallen. Nur noch fünf der Häuser sind bewohnt. Die Menschen, die geblieben sind, sind alt, die meisten weit über 70. Es ist ein einfaches, meist selbstversorgtes Leben, mit Plumpsklo auf dem Hof und Brunnen hinterm Haus. Mit Holzofen und ohne Telefon. Mit oft kargen Mahlzeiten aus selbst gesammelten Zutaten, reich an Geschmack, weil ohne Geschmacksverstärker.
Viele Mauern in Nida sind grün überwuchert. Elche und Wölfe, Füchse und Biber leben wieder hier. Ganze Kolonien von Störchen suchen zwischen Meer und Moor, auf den Wiesen hinter den Dünen, nach Fressbarem. Die Natur erobert das Land zurück. Und hier, wo die Ostsee im Westen liegt, kann der Himmel ein Spektakel sein. Er fegt alles weg, wenn er will. Er wird eins mit dem Meer, wenn er will. Bleigrau und graublau. Gleich wird es Regen geben. In Nida kann man das Wetter von weitem kommen sehen. Jetzt ziehen drohende Wolkenwände von der See herüber. Der Wind wird stärker.
Biruta sammelt noch schnell einige Zweige im nahen Wäldchen, für den Ofen. Sie mag es, wenn es von einem auf den anderen Moment anders riecht, die Luft schwerer wird und nach feuchtem Heu schmeckt. Sie liebt es, wenn die Winde so kräftig am Wellblechdach ihres Hauses rütteln, dass sie nachts nicht schlafen kann. Und wenn es im Frühjahr und im Sommer blüht, wenn es noch bunter wird in Birutas Garten, beginnt die schönste Zeit des Jahres für sie, «dann habe ich ein Leben in Hülle und Fülle. Das ist eine große Freiheit. Das ist alles, was ich mir wünsche.» Und auch an unwirtlichen Wintertagen, wenn der mächtige Westwind heult wie ein krankes Tier und so stark ist, dass niemand mehr aufrecht gehen kann, und er die Ostsee einfach über den schmalen Strand drückt, auch die Dünen die Sturmflut nicht aufhalten können und das Wasser direkt vor ihrer Haustür steht, wenn die Wellen donnern, dass es sich wie ein Beben aus der Hölle anhört, dann scheint die Zeit endgültig still zu stehen im einsamen Nida, wo die Vergangenheit so gegenwärtig und die Zukunft so ungewiss ist.
Regelmäßig aber wird das kleine Nida verwechselt – mit einem anderen ehemaligen Fischerdorf, das in Litauen, keine 100 Kilometer entfernt, liegt und auch Nida heißt. Die beiden Orte verbinden der Name, die Ostsee und ihre Geschichte, beide waren von den Sowjets besetzt. Heute gibt es keine Gemeinsamkeiten mehr. Das andere Nida ist so ganz anders. Es ist das genaue Gegenteil. Dort gibt es Haupt- und Nebensaison. Es gibt Hotels und Restaurants. Es gibt Tausende Touristen und einen Supermarkt, der täglich von 7:30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet hat. Im Hafen liegen Segelyachten. Die Häuser sind frisch renoviert, das Holz ist in warmen Farben gestrichen, und die Straßen sind asphaltiert. In der Touristeninformation kann man Thomas-Mann-T-Shirts kaufen. Sein ehemaliges Sommerhaus ist heute ein Kulturzentrum. Das Dorf ist ein Menschenmagnet. Es liegt zwischen Haff und Ostsee auf der Kurischen Nehrung, dem schmalen Fetzen Land, den sich Litauen und Russland teilen, der wie eine seltsame Laune der Natur wirkt, wo weiße Wüstenberge mitten im Meer enden. Über 1500 Menschen leben in diesem Nida, das jeder kennt. Das Nida in Lettland kennt keiner. Zwei Dörfer, ein Name, zwei Welten.
Biruta ist nie im namensgleichen Dorf gewesen. «Ein Nida langt mir», sagt sie. Zu verkaufen steht auf vielen Schildern, die vor den Höfen im sandigen Boden stecken. Doch niemand kauft die Grundstücke, nur einige reiche Litauer oder Russen gönnen sich in Birutas Heimatdorf ein Sommerhaus, verbringen dann aber kaum Zeit hier. Denn die Zeit läuft anders in Nida, vielen viel zu langsam. «Hier gibt es nur das Meer. Zeit darf bei uns noch Zeit sein», sagt sie, «vermutlich ist es den meisten zu ruhig hier.» Und ihre meerblauen Augen verraten den Rest. Es solle ihr recht sein, sie komme gut alleine klar, sagt sie. Doch wer viel alleine ist, der schweigt auch viel, wenn er nicht alleine ist. Auch bei Biruta ist das so. Sie braucht immer ein wenig, um sich an Gesellschaft zu gewöhnen. Dann aber, nach einiger Zeit, beginnt sie von sich aus etwas mehr zu erzählen, auch über sich und ihre Geschichte.
Vor der Unabhängigkeit Lettlands war sie einfache Traktoristin in der regionalen Kolchose «Padomju Latvija» – zu Deutsch: Sowjetisches Lettland. Die umliegenden Dörfer waren in einem großen Kollektiv zusammengeschlossen, mit einigen tausend Menschen. Sie erzählt, wie sie die Felder bestellte. Sie erzählt, wie die Ernte eingeholt wurde. Und wie man morgens in ein Glas pusten musste und der Brigadeführer seine Nase hineinsteckte. Wessen Atem nach Wodka roch, durfte den Tag nicht arbeiten, nicht Trecker oder Mähdrescher fahren. Mit dem Kollaps der Sowjetunion verschwanden auch die Staatsbetriebe, Biruta und ihr Mann Jurji verloren ihre Arbeit. Doch eine Alternative gab es nicht im einsamen Nida.
Der Strand aber, der war nun wieder frei zugänglich. Und schon bald fingen die beiden an, das Strandgut, das sie auf ihren langen Spaziergängen fanden, zu sammeln und in ihren Garten zu schleppen. «Wir hatten nicht viel, also mussten wir erfinderisch sein», erzählt sie, «was man hatte, das hatte man. Und das reichte meistens auch.» Sie mussten sehen, was die Natur für sie bereithielt. Meist früh um vier oder fünf am Morgen – noch vor allen anderen – stiefelten sie los. Aus allem, was die Wellen brachten, wurde etwas gemacht. Gewaltige Baumwurzeln haben sie geschliffen und bunt geschmückt. Aus Plastikrohren haben sie Torbögen gebaut. Hölzerne Kraken und Müllmonster bevölkern nun das Dorf. In ihrem kleinen Kunstpark hat der Müll eine neue Bedeutung bekommen. Er muss nicht verschwinden, er darf bleiben. TrashArt würde man die Skulpturen und Objekte heute in der Kunstsprache wohl nennen. «Kunst?», wiederholt die kleine Frau mit den weißen Haaren erstaunt, «wohl eher nicht. Ich mache mir das Leben bunt – das ist alles.»
Im Januar 2006 ist ihr Mann mit 66 an Krebs gestorben. Er liegt auf dem kleinen, von Büschen und Bäumen eingefassten Friedhof gleich gegenüber ihrem Garten begraben. Sie hat Steine am Strand gesammelt und auf sein Grab gelegt. Sie sind rund geschliffen vom ewigen Gleichlauf der Wellen, «vom Leben», wie Biruta sagt. Ihren Ehering trägt sie weiter am Finger. «Der bleibt für immer.» Und auch sie wird in Nida bleiben und weiter das sammeln, was die Ostsee ihr bringt. «Das führe ich fort», sagt sie, «für mich und Jurji.» Der Staat zahlt ihr eine kleine Rente, etwas mehr als 100 Lats im Monat – das sind keine 150 Euro. Sie braucht ihren Gemüsegarten zum Überleben. Einmal die Woche fährt sie ins 60 Kilometer entfernte Liepāja, um Einkäufe zu machen und ihren Sohn zu besuchen. Eine Tagesreise mit dem Bus. Doch die Stadt ist nichts für sie, «viel zu viele Menschen auf viel zu wenig Platz. Wenn ich dort leben müsste, würde ich krank werden. Das ist mir zu laut. Ich möchte in Ruhe am Meer sein.» Doch auch Biruta hat auf ihrem Grundstück ein Schild aufgestellt. Mit den Verschlusskappen von Plastikflaschen hat sie einen Pfeil und drei Wörter daraufgenagelt: Taka uz Juru – da geht’s zum Meer. «Für die Touristen», sagt sie, «ich weiß ja, wo der Strand ist.»
An manchen Tagen stehen tatsächlich Fremde an ihrem Gartenzaun und blicken ungläubig auf das bunte Grundstück. Die meisten haben versehentlich die Abzweigung nach Nida genommen und sind die kilometerlange Schotterpiste gefahren, die hier ohne Ankündigung endet. Nun reiben sie sich verwundert die Augen, da sie so etwas nicht erwartet und noch nie gesehen haben. Man kann die Fragen in ihren Gesichtern lesen: Was um Himmels willen ist das? Was soll das? Wer wohnt denn hier? Und dann trauen sie sich doch, kommen näher und laufen staunend durch den bunt geschmückten Garten. Wie jetzt zwei Frauen und zwei Männer aus Riga. Sie sind die einzigen Besucher der letzten drei Tage. Sie kichern und fotografieren jedes Detail, jedes Stück Holz und sich gegenseitig. Biruta steht dabei und strahlt. Sie zeigt ihre Skulpturen, die drei Tütchen mit Bernstein und den ganzen Stolz ihrer Sammlung: Briefe, die ihr das Meer gebracht hat. «Flaschen mit Wörtern», wie sie in gebrochenem Deutsch sagt. 35 Botschaften, die an den Strand vor ihrer Haustür gespült wurden. Abgeschickt in Schweden, Polen, Litauen, Russland, den Niederlanden und Deutschland. Oder von Fähren und Segelbooten in die See geschmissen. Gestrandet in Nida, Lettland. Das Meer als Postbote.
Biruta hat alle Briefe sorgfältig in Klarsichthüllen gesteckt und in einer Mappe abgeheftet. Auf jedes Papier hat sie das Funddatum notiert. Post aus einer fremden Welt. Noch nie hat sie außerhalb Lettlands Urlaub gemacht. Noch nie hat sie einem der Absender eine Antwort geschrieben. Sie spricht kein Englisch und kaum Deutsch. Sie spricht Lettisch und Russisch. Doch manchmal lässt sie sich eine frisch eingetroffene Flaschenpost von den Gästen übersetzen, die ihren Garten besuchen. Manche der Flaschen trieben Jahre in der Ostsee, andere nur ein paar Tage.
Doch jede Nachricht erzählt die Geschichte eines oder mehrerer Menschen. Wie von Agnes und Aurelija aus Litauen zum Beispiel, die sich beide in einen Schweden namens Cobain verlieben, der sie per Anhalter mitgenommen hatte. Also wünschen sich die Mädchen noch mehr nette schwedische Männer in ihrer Heimatstadt Klaipėda. Am 28. April 2001 verschicken sie einen Liebesbrief ins Meer. Biruta findet ihn fast zwei Jahre später, am 7. Februar 2003.
Oder die damals 30-jährige Nico aus Stettin, die als Köchin auf einem polnischen Frachtschiff arbeitet und sich nach fernen Reisen sehnt, wie sie am 15. September 2004 schreibt. Dann wirft sie die Flasche zwei Seemeilen vor dem polnischen Seebad Leba ins Meer. Biruta sammelt Nicos Nachricht bereits sechs Tage später ein.
Oder Brigitte und Günther aus Laboe, die mit der Passagierfähre Gloria von Kiel nach Litauen in den Urlaub unterwegs sind.
Vidmantas aus der litauischen Kleinstadt Skuodas, der in seinem Gedicht vom Leben und von der Liebe erzählt. Es endet mit dem Satz: Und nun wünsch ich mir eine schöne Frau an meiner Seite.
Paulina aus der Nähe von Warschau, die sich auf einen gemeinsamen Urlaub am Meer mit ihrem Freund freut. Doch der muss arbeiten. Am Telefon gibt es Streit. Sie macht ihm Vorwürfe. Er schreit sie an. Sie schreibt: Ich hasse ihn. Doch nun gehe ich nach Hause, um mit ihm ein ernstes Wörtchen zu reden. Wieder einmal ist etwas schiefgelaufen in meinem Leben. Doch ich habe Hoffnung.
In dieser Flasche steckte auch ein zweiter Brief. Auf der Rückseite eines Horoskops notiert eine Freundin Paulinas am 9. Juli 2007: Nie habe ich mich einsamer gefühlt als vergangene Nacht. Vielleicht ist es lächerlich: Aber ich dachte, dass mir eine Flaschenpost irgendwie helfen könnte, dass ich nicht länger traurig bin. Solltest du ein netter Mann sein, schreib mir doch mal. Weronika
Auch Luftpost ist bei Birutas Briefen dabei: Der Ballon mit der Karte aus Kiel muss irgendwo in die Ostsee gestürzt und dann bis nach Nida getrieben sein: Achtung!, heißt es, der Verein Schüler helfen Leben startete einen Luftballonflugwettbewerb am Tag der Deutschen Einheit. Michi aus Heikendorf hätte den Preis für den am weitesten geflogenen Ballon sicher gewonnen, wenn Biruta geantwortet hätte. Oder die Flaschenpost von Jan aus dem Dorf Holm in Schleswig-Holstein, der drei Fragen hat: 1. Wie findest du Deutschland? 2. Wie heißt du? 3. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Bitte schicke eine Flaschenpost mit deinen Antworten an meine Adresse. Biruta entdeckte den Brief des damals 14-Jährigen am 8. September 2007. Jan hatte ihn gemeinsam mit einem Freund geschrieben und in den Sommerferien in die Ostsee geworfen.
Verfolgt man den Weg mancher Briefe zurück zu ihren Schreibern, zeigt sich, wie das Meer auf ungewöhnliche Weise Menschen verbinden kann. Wie bei Thomas, der in Sassnitz auf Rügen lebt. In seiner Nachricht schreibt er: Es ist Sturm aus westlicher Richtung. Das ist die Gelegenheit, mal wieder ein paar Flaschen auf die Reise zu schicken. Ich freue mich schon jetzt auf Antwort. Jedes Mal notiert er die Koordinaten und die Uhrzeit, wo und wann er diese ins Wasser wirft. Weit über 150 Botschaften hat er schon verschickt. Es fasziniert ihn, wer die Meerespost wann und wo findet. Und fast 30 Menschen aus sieben Ländern haben ihm bereits eine Antwort geschrieben, darunter Arne aus Schweden, Magda aus Polen, Darius aus Litauen, Lasse aus Dänemark oder Natalja aus Russland. Am 1. Januar 2007 bringt Thomas ein weiteres Stück Papier auf den Weg. Am 4. Februar wird es von Biruta rund 300 Seemeilen – fast 550 Kilometer – weiter östlich gefunden.
Und auch Muriel aus den Niederlanden startete mit ihrer Schulklasse ein Flaschenpostprojekt in der friesischen Kleinstadt Stiens. Die Kinder schrieben auf, wie sie sich eine bessere Welt vorstellen würden. Hielke notierte: Ich möchte, dass es weniger Umweltverschmutzung gibt. Und dass nie wieder Bomben und Terroristen kommen. Erik schrieb: Ich finde die Welt gut, aber sie könnte noch besser sein. Ein anderer Zettel liest sich wie eine Nachricht an den Weihnachtsmann: Ich wünsche mir Star Wars und Weltfrieden.
Und schnell stellt man sich vor, wie die Flasche aus Holland ihren Weg durch die Nordsee, durch Skagerrak und Kattegat, vielleicht an Kopenhagen oder Fehmarn vorbei, und weiter durch die halbe Ostsee bis an den Strand von Nida gefunden haben muss. Erst sehr viel später, in einigen Monaten, wird sich durch eine E-Mail der holländischen Lehrerin aufklären, dass sie im Hafen von Rotterdam einen russischen Kapitän gebeten hatte, die Nachrichten mitzunehmen und in die Ostsee zu werfen. Am 10. Dezember 2004 hatte Kapitän Denisenko Wort gehalten und die Flasche über Bord geschmissen. Zwei Wochen später fand Biruta sie bei ihrem Spaziergang an Heiligabend – Weihnachtspost mit den Wünschen und Träumen von Kindern.
Längst ist es wieder ruhig im Garten hinter der Düne. Keine Touristen mehr, die kichern. Keine Fotoapparate, die klicken. Was bleibt, sind die Einträge im Gästebuch. In eine der Bojen hat Biruta ein Loch gebohrt und Kasse daraufgeschrieben. Und nun schüttelt sie die Spenden der Besucher aus dem Plastikball und setzt sich vor ihr Haus auf eine Holzbank an einen Holztisch. Unter dem Tisch liegt ihr Hund und schläft. Er heißt Ekars, was so viel wie Haufen bedeutet. Hinter ihr an der Wand hängt ein Rettungsring mit dem Namen des Schiffes, von dem er geworfen wurde. Die Frachtfähre MS Petersburg lief 1985 in Wismar vom Stapel und kreuzte lange im Ostseeraum. Heute fährt sie im Schwarzen Meer. Ob der leuchtend orangefarbene Ring jemals ein Leben gerettet hat, wird nie jemand erfahren. Wo das Schild mit dem deutschen Hinweis Badestrand nur für Frauen gestanden hat, auch nicht. «Würde ich die Gegenstände nicht aufsammeln, würde es keiner tun und der Strand wäre in nur wenigen Tagen total verdreckt», sagt Biruta. «Mein Strand wird sauber bleiben!» Ihre Goldzähne blitzen in der Abendsonne. Die aus halben Bojen zusammengebauten Windräder quietschen. Bunte Plastikflaschen, die an Sträuchern blühen, klappern. Nur der Wind, eine Frau und das Meer – ein stilles Leben in Farbe.
In den Wind geschrieben
Warum kommen so viele Briefe an der lettischen Küste an? Gibt es Dauerwellen oder Ströme, die wie gewaltige Fließbänder funktionieren? Ein Besuch bei Frank Janssen, Ozeanograph und Experte für Meeresströmungen, der den Kräften der Ostsee auf der Spur ist.
Die Bernhard-Nocht-Straße in St. Pauli zählte schon immer zu den wirklich wichtigen Adressen der Hansestadt. Hier wird das Wetter gemacht, hier hat der Deutsche Wetterdienst seinen Sitz. Das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin ist gleich nebenan. Gegenüber hat es auch mal die Astra-Brauerei gegeben, bis das Bier Pleite machte und der Name verkauft werden musste. Und auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, kurz BSH, ist in der Parallelstraße der Reeperbahn zu finden und kaum zu übersehen. Der wuchtige Behördenbau aus rotbraunem Backstein hat Hunderte Fenster. Genauso viele Menschen arbeiten dort. Es werden Sturmfluten und Gezeiten vorhergesagt. Es werden Meere vermessen.
Wenn Frank Janssen aus dem Fenster seines Büros blickt, sieht er den Hafen und den Fluss. Das ist wichtig für diese Geschichte, in der es um das Fließen und Strömen geht. Die Aussicht ist schiffig. Doktor Janssen kann die voll beladenen Containerfrachter und Schlepper beobachten. Er kann sehen, wie die Elbe Dinge transportiert und Menschen in Bewegung setzt. Das Wasser will nicht stillhalten – und das ist sehr entscheidend für die Arbeit des schlanken Bart- und Brillenträgers mit den kurzen schwarzgrauen Haaren. Er ist Experte, wenn es um Meeresströmungen in der Nord- und Ostsee geht. Seit 2006 ist er beim BSH. Er trifft Vorhersagen, wie sich die Wassermassen bewegen werden. Er berechnet Driftwege von Gegenständen. Und nun soll er mir erklären, warum die Ostsee so beharrlich viel Flaschenpost an die lettische Küste trägt. Gibt es dort Ströme, die wie Förderbänder funktionieren? Er sagt: «So einfach ist es natürlich nicht. Es ist viel einfacher: Der Wind ist die treibende Kraft.»
Frank Janssen, geboren 1968, hält jetzt einen kleinen Vortrag über den Wind. Er spricht von «Windfaktor» und «Driftkörper». Er sagt: «Der Wind hat dreifachen Einfluss: Er macht die Wellen, er erzeugt die Oberflächenströmungen und dirigiert ganz wesentlich die Drift einer Flaschenpost, da sie mindestens zur Hälfte aus dem Wasser guckt. Natürlich gibt es auch in der Ostsee Strömungen und Wirbel, die sind aber lange nicht so gewaltig wie im Atlantischen oder Pazifischen Ozean.»
Im Jahresmittel, erklärt er, herrschen über der Ostsee West- oder Südwestwindlagen. Gerade im Herbst und im Winter brauen sich über dem Nordatlantik mächtige Winde zusammen, die über die Nordsee und weiter nach Osten ziehen. Deshalb ist der Schriftverkehr auch eher einseitig: Briefe aus Deutschland oder Dänemark haben viel größere Chancen, östlich gefunden zu werden als umgekehrt. Post aus Lettland oder Litauen wird meist an der eigenen Küste wieder angeschwemmt. Polen schreiben fast immer ins Baltikum oder an Menschen im Golf von Finnland. Finnen wiederum finden viele Wurfsendungen von Schweden. Und Schreiber aus Sankt Petersburg haben generell eher schlechte Karten, da es ihre Flaschen kaum aus dem Finnischen Meerbusen schaffen. «Unmöglich ist gar nichts», betont Frank Janssen, «die Wahrscheinlichkeit ist aber gering, dass etwas viele Jahre in der eher kleinen Ostsee treibt. Alles wird früher oder später wieder ans Ufer kommen.» Auch eine erst nach Jahren gefundene Flaschenpost wird vorher gestrandet, durch die Wellen eingegraben und mit der nächsten Sturmflut wieder ausgegraben worden sein, vermutet er. Doch kein Mensch weiß das so genau. Auch ein Experte für Meeresströmungen nicht. «Und genau das macht ja den Reiz und das Geheimnis aus. Der Weg einer Flaschenpost lässt sich nicht erklären.» Auch wenn er das als Wissenschaftler natürlich nicht so gerne sagt.
Seine Kollegen, die Meteorologen, sind die Sammler. Datensammler. Sie erforschen das Wetter und tragen eine Flut an Informationen zusammen. Frank Janssen ist der Detektiv. In seinem Computer wird die Ostsee zu einem Meer aus Zahlen, die es zu filtern und zu verdichten gilt. Er sucht das Wasser mit Wetterdaten und Windprognosen ab, spürt herrenlos treibende Container auf, die zu einer Gefahr für andere Schiffe werden könnten. Er braucht nur die Koordinaten, wo etwas ins Wasser gefallen ist, dann beginnt er zu ermitteln. Er kann den Seenotrettern sagen, wo sie suchen müssen, wenn ein Mensch vermisst wird, wenn nur noch wenig Zeit bleibt. Und mit seinen Strömungsmodellen kann er auch zurückverfolgen, wo und wann etwas ins Meer gelangt sein könnte. Das kann ein Ölteppich sein. Das können Chemikalien aus den Tanks von Schiffen sein. Das können auch Wasserleichen sein. Vor einigen Jahren wurden mal zwei tote Frauen angeschwemmt, eine an der Nordspitze Sylts, die andere an der Südküste der dänischen Nachbarinsel Rømø. Es waren zwei Schwestern aus Baden-Württemberg, 70 und 75 Jahre alt. Die Kleidung und das Gewicht hatten sie unterschiedlich treiben lassen. Frank Janssen hatte herausfinden können, dass beide am selben Ort auf Sylt zu exakt derselben Zeit ins Wasser gekommen sein mussten. Vermutlich hatten sie sich gemeinsam das Leben genommen.