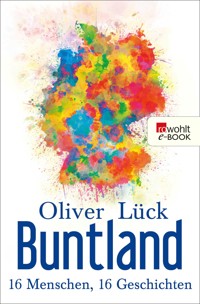9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
26 Länder, 26 Menschen – auf der Suche nach ungewöhnlichen Lebensgeschichten ist Oliver Lück mit seiner Hündin Locke durch halb Europa gefahren. 50000 Kilometer, 600 Tage, drei Blechschäden, eine Reifenpanne. Er hat gelernt, dass die Wodkagläser in Richtung Osten immer größer werden, bis man ihm kurz vor Russland ganze Flaschen vorsetzte. Er weiß jetzt, was Älä sää rääkää sitä kissaa heißt: Quäle diese Katze nicht. Und er hat verstanden, was die Länder Europas wirklich eint: benutzte Kondome an romantischen Plätzen. «Neues vom Nachbarn» ist ein überraschender Blick auf Europa und seine Bewohner. Eine Reise voller skurriler Erlebnisse und besonderer Begegnungen. Denn das Abenteuer sind nicht die Länder, sondern ihre Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Oliver Lück
Neues vom Nachbarn
26 Länder, 26 Menschen
Über dieses Buch
26 Länder, 26 Menschen – auf der Suche nach ungewöhnlichen Lebensgeschichten ist Oliver Lück mit seiner Hündin Locke durch halb Europa gefahren. 50000 Kilometer, 600 Tage, drei Blechschäden, eine Reifenpanne. Er hat gelernt, dass die Wodkagläser in Richtung Osten immer größer werden, bis man ihm kurz vor Russland ganze Flaschen vorsetzte. Er weiß jetzt, was Älä sää rääkää sitä kissaa heißt: Quäle diese Katze nicht. Und er hat verstanden, was die Länder Europas wirklich eint: benutzte Kondome an romantischen Plätzen. «Neues vom Nachbarn» ist ein überraschender Blick auf Europa und seine Bewohner. Eine Reise voller skurriler Erlebnisse und besonderer Begegnungen. Denn das Abenteuer sind nicht die Länder, sondern ihre Menschen.
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Mai 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
(Abbildung: © Oliver Lück)
Fotos im Innenteil © Oliver Lück
ISBN Buchausgabe 978-3-499-62841-2 (1. Auflage 2012)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-46361-5
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Abfahrt
Im Osten
1 Tschechien «Jede Fahrt verändert mich»
Kilometer 2194 Nachts allein im Schloss
2 Slowakei Zurück in die Zukunft
Kilometer 3627 bis 3722 Im toten Winkel
3 Polen Kein Ort für einen Audioguide
Kilometer 5363 Detektiv des Waldes
4 Litauen Im Rausch der Steine
Kilometer 5952 Wodka
5 Lettland Das Meer als Postbote
Kilometer 8104 Neues vom Nachbarn
6 Estland Im Himmel ohne Drogen
Im Norden
Kilometer 10854 Ochi in Oulu
7 Finnland Gott oder Gold
Kilometer 13823 Die Bucht der Trolle
8 Norwegen Das Naturtalent
Kilometer 17472 Locke
9 Schweden Leben nach dem Tod
Kilometer 18182 Ärzte, eine Axt und Arne
10 Dänemark Das Ufo ist gelandet
Kilometer 19261 Land in Sicht
Im Süden
11 Frankreich Im Namen der Schote
Kilometer 24658 Galicien
12 Portugal Falscher Figo
Kilometer 28006 Aussteigen
13 Spanien Der kleine Finger Gottes
Kilometer 32880 Engel am Wegesrand
14 Seborga Die Prinzenrolle
Kilometer 35018 Auf den Ätna
15 Italien Pizza ohne Pizzo
Kilometer 35966 Schlangenfest
16 San Marino Klein, aber fein
Kilometer 37354 Kondome des Grauens
17 Österreich Das Thal des Terminators
Kilometer 38261 Hund, Katze, Maus
18 Schweiz Allein unter Indern
Im Westen
Kilometer 40167 Entweder. Oder.
19 Deutschland Der Stammhalter
Kilometer 41688 Immer nie an Land
20 England Bananen für alle
Kilometer 44804 Schritt für Schritt
21 Schottland Into the Wild
Kilometer 46022 Die persönliche Note
22 Nordirland Jeden Tag Sonntag
Kilometer 46362 bis 48120 Ein Bier im Schwein
23 Irland Die fabelhafte Welt der Clare Murphy
Kilometer 48501 Mit Momo in Mekka
24 Wales Eine Prise Wales
Kilometer 49624 Einsteigen
25 Niederlande Immer an der Grenze
Kilometer 49971 Doel
26 Belgien Immer der Nase nach
Kilometer 50684 Blick zurück
Tafelteil 1
Tafelteil 2
Abfahrt
«Ein Buch braucht immer einen starken ersten Satz!» Das wird Marek in knapp 5000 Kilometern sagen. Und er wird es nicht bloß sagen, er wird es brüllen – in den Lärm seiner vollbesetzten Kneipe hinein. Marek ist Wirt in der Danziger Altstadt. Er ist ein kleiner, kompakter Mann, doch vieles an ihm ist auch riesig. Sein Kopf, seine Oberarme, sein Bauch. Vor allem aber seine Hände, die fest zupacken können und die so manchen seiner Sätze dadurch betonen, dass sie mit großer Wucht auf den glattgewischten Tresen klatschen. Es sind viele gute Sätze dabei. Man könnte glauben, Marek ist eine Art Kneipenphilosoph. Er sagt zum Beispiel: «Es muss nicht immer Indien sein, auch bei uns polnischen Nachbarn ist es schön.» Oder: «Wer zu Hause nicht zufrieden ist, wird auch auf Reisen nicht glücklich.» Oder eben auch: «Ein Buch braucht immer einen starken ersten Satz.» Klatsch. Danke, Marek, für diesen Ratschlag. Und danke für diesen ersten Satz.
1996 war das Jahr, in dem Rio Reiser starb. Ein Schaf namens Dolly kam zur Welt. Und ich kaufte mir mein erstes Auto, einen postgelben Bulli, Baujahr 1973. Ein Freund hatte mir schwarze Posthörner auf die Türen gemalt und auf die eine Seite Pest und auf die andere Rost gepinselt. Nach 85 Tagen endete die erste Tour durch Europa mit Kolbenfresser am Offenbacher Kreuz. Doch die Art und Weise, wie ich reisen wollte, die hatte ich gefunden. Viele Jahre und zwei VW-Busse später springt Locke in unseren blauen Bulli, Jahrgang 1991. Sie ist ein schwarz-brauner Hovawart und noch ein Welpe, als wir losfahren. Sie wird ausgewachsen sein, wenn wir wieder im Süden Schleswig-Holsteins ankommen werden.
Zwanzig Monate durch Europa: 50000 Kilometer, drei Blechschäden, eine Reifenpanne. Und wir werden ohne Hilfe aus dem Weltraum auskommen müssen: Wir haben kein Navi, dafür aber einen zweieinhalb Kilo schweren Straßenatlas. Der ADAC-Präsident Peter Meyer schreibt im Vorwort des über 1400 Seiten starken Werkes, dass mehr als sieben Millionen Menschen diesen «idealen Partner» und «unverzichtbaren Begleiter für unterwegs», den man sicher auch zur Selbstverteidigung oder als Wegfahrsperre einsetzen könnte, gekauft haben. «Ich wünsche Ihnen allzeit gute Fahrt!» Herzlichen Dank, Herr Meyer!
Unsere Ziele stehen ohnehin auf keiner Karte. Es soll eine Reise zu Menschen und ihren Geschichten werden – 26 Länder, 26 Menschen, 26 Geschichten. Darunter eine Lettin, die am Strand vor ihrer Haustür über 30 Flaschenpostbriefe gefunden hat, der beste Freund von Arnold Schwarzenegger und eine schwedische Biologin, die eine umweltfreundliche Alternative der Bestattung entwickelt hat. Wir besuchen den besten Fußballer der Welt, Lionel Messi, und eine mutige Sizilianerin, die seit Jahren gegen die Mafia kämpft. Wir treffen einen finnischen Goldsucher, den einzigen schwarzen Flößer Deutschlands und einen englischen Fußballfan, der einst im Affenkostüm als Maskottchen durch das Stadion hüpfte und heute Bürgermeister seiner Heimatstadt ist.
Und zwischendurch wird es immer wieder flüchtige Begegnungen mit nicht weniger interessanten Menschen geben, wie Marek aus Danzig oder Maria aus Logroño. Die bald 80-jährige Spanierin wohnt in einem kleinen Haus am Jakobsweg und sitzt täglich vor ihrer Tür unter einem knorrigen Feigenbaum. Dort stempelt sie die Pässe der vorbeiziehenden Pilger. Es sind Leute aus der ganzen Welt, die sich zu der Rentnerin in den Schatten setzen und ihr von großen Reisen und großen Träumen erzählen. Maria hört ihnen zu. Sie selbst hat ihre Heimat nie verlassen. Ob das nie langweilig wird, ist sie einmal gefragt worden. «Manchmal schon», hat sie geantwortet, «aber es liegt ja an mir, aus meiner Zeit etwas zu machen.» Ein einfacher und schöner Satz: Zeit ist das, was man aus ihr macht. Egal, wo man gerade ist. Und hier fängt die Reise an.
1Tschechien «Jede Fahrt verändert mich»
Aleš Kubíček hat sich durchs Leben getüftelt: Einst baute er den ersten Heißluftballon der damaligen ČSSR. Heute besitzt er die drittgrößte Ballonfabrik der Welt. Die Geschichte eines Mannes, der auf der Erde wohnt und am Himmel lebt.
Ein Heißluftballon sieht aus wie eine gigantische Glühbirne, als schwebte ein besonders guter Einfall am Himmel. Und die Menschen, die mit ihm fahren, sind immer winzig. Oben der prall gefüllte Luftball, darunter hängen die Zwerge in einem Körbchen und winken. Jeder kennt das Gefühl, wenn man so einen Ballon sieht. Für einen Moment lassen Menschen alles stehen und liegen. Dann haben sie den sehnsüchtigen Blick, den auch staunende Kinder haben, wenn sie alles um sich herum vergessen. Sie kippen ihre Köpfe in den Nacken und winken zurück. Und sie träumen. In Gedanken stehen auch sie nun in diesem Korb. Denn wer mit einem Ballon unterwegs ist, der hat es nicht eilig, der reist wie in der Vergangenheit. Wer mit einem Ballon fährt, der hat kein Ziel, da man nie weiß, wo der Wind einen hintragen wird. Viel Zeit und kein Ziel ist eine gute Mischung.
Aleš Kubíček steht auf der weitläufigen Wiese vor seinem Schloss. Die grauen, schwarz melierten Haare hat der Wind zerzaust. Den Vollbart hat er seit Tagen nicht gestutzt. Vielleicht hat er keine Zeit gehabt, vielleicht auch keine Lust. Der über 700 Jahre alte Renaissancebau ist in einem schlimmen Zustand. Die Fassade hat viele Löcher. Der Putz blättert großflächig von den Wänden. Das Mauerwerk ist feucht. Fast zwanzig Jahre hatte das wuchtige Herrenhaus leer gestanden. 2005 kaufte Aleš das verwahrloste Anwesen für wenig Geld. Nun muss es von Grund auf saniert werden. Seine Frau, sein Sohn, seine beiden Töchter und viele Freunde helfen dabei. Jedes Wochenende. Gerade klopfen sie mit Hämmern und Meißeln eine Wand heraus. Mit Schubkarren werden Schutt und Erde weggebracht. Ein Ende der Arbeit ist lange nicht in Sicht. «Noch ist alles ein schöner Traum», sagt Aleš, «eines Tages aber wird es ein Ballonschloss sein.» Ein Treffpunkt für Menschen, die seine Leidenschaft für das Reisen am Himmel teilen, wo Ballons gemietet und Piloten ausgebildet werden. Eine Art Luftschloss – nur wirklich.
Aleš, geboren 1955, ist ein angenehm ruhiger Mann. Er spricht leise. Er lacht leise. Seine Gesten sind unaufgeregt. Manchmal zeichnet er mit dem Zeigefinger Pläne in die Luft, wenn er etwas erklärt. Man glaubt, sehen zu können, dass er viel nachgedacht hat in seinem Leben. Seine Stirn zieren konzentrierte Falten – Denkfalten. Es gibt Leute, die sagen, dass Aleš ein Pionier der Luftfahrt ist, ein Erfinder. Er selber würde sich nie so nennen. «Ich habe ja nichts erfunden», sagt er, «sondern nur ein bisschen herumgetüftelt und unter schwierigen Bedingungen etwas konstruiert, was es bei uns noch nicht gab.» Aleš hat den ersten Heißluftballon der damaligen Tschechoslowakei gebaut.
Zwei Autobahnstunden sind es von Prag in Richtung Südosten, durch einen Landstrich mit Wäldern und sanften Hügeln, wo es viele Dörfer, viel Landwirtschaft und keine Städte gibt. Radešin hat 100 Einwohner, eine Kirche, das halbverfallene Schloss der Kubíčeks und sonst nicht viel. Klein und übersichtlich ist das Dorf im Osten Tschechiens. Manchmal sieht man stundenlang niemanden auf der Straße. Keine Kinder, die spielen. Keine Autos, die fahren. Die Gegend, sagt Aleš, sei ideal für das Ballonfahren. Man könne in jede Richtung starten und problemlos überall landen. An diesem Morgen aber blickt er skeptisch. Er wiegt den Kopf hin und her und zeigt auf einige Verwirbelungen am Himmel. Er beobachtet die Wolken und wie der Wind ihre Form verändert. Gerade wirken sie wie frisch toupiert. Sie hängen tief und haben es eilig. «Zu tief und zu eilig», sagt Aleš, «wir müssen bis zum Abend warten.» Das hatte er schon gestern gesagt. In all den Jahren hat er gelernt, geduldig zu sein. Es würde auch nichts bringen, nervös zu werden. Und so bleibt Zeit, etwas mehr über Aleš zu erfahren und darüber, wie das damals anfing mit der Ballonfahrt in der ČSSR.
Es war das Jahr 1979. Und es begann mit einer Frage: «Kannst du uns einen Heißluftballon bauen?» Aleš saß mit Freunden in einer Kneipe. «Nein, kann ich nicht», antwortete er damals, «aber ich kann es ja mal versuchen.» Er war Segelflieger, er wusste alles über die Gesetze der Thermik und über Aerodynamik, über Flügelprofile und Aufwindtheorien. Das alles hatte aber nicht viel mit Ballonfahren zu tun. Und es gab auch keine Baupläne oder Literatur darüber. Es gab noch nicht mal einen Ballon. Aleš war aber schon damals ein Bastler, ein Technikfreak. Er studierte Maschinenbau an der Militärakademie von Brno, der zweitgrößten Stadt des Landes. Er wollte Ingenieur werden. «Ich dachte, wenn es Roboter gibt, brauchen die Menschen nicht mehr zu arbeiten und werden zufriedener.» Er lacht und schlägt die Hände vors Gesicht. «Was für ein jugendlicher Irrtum.»
Die Idee mit dem Ballon schaffte es immerhin aus der Kneipe hinaus und war auch am nächsten Morgen nicht vergessen. Aleš und seine Freunde begannen mit den Planungen. Sie überlegten und rechneten. Erste Entwürfe wurden gezeichnet. Doch sie hatten Pech. Nur wenige Wochen später flohen zwei ostdeutsche Familien mit einem selbstgebauten Ballon über die Grenze nach Bayern. Acht Menschen in einem kleinen Korb – eine halbe Stunde durch die Nacht in ein neues Leben. Es war eine der spektakulärsten Republikfluchten aller Zeiten. Und auch das kommunistische Regime der ČSSR wurde jetzt nervös. Das wird uns nicht passieren, beschloss man. Die Bürger sollten kontrollierbar bleiben. Da der Wind aber nicht mal Kommunisten gehorcht, wurden Heißluftballone kurzerhand verboten, bevor es sie überhaupt gegeben hatte.
Mehr als vier Jahre musste Aleš warten. Erst 1983 bekam er eine Sondergenehmigung und durfte unter Aufsicht des Militärs mit dem Bau beginnen. Was keiner wusste: Im Verborgenen hatte er heimlich weiter konstruiert. Als Vorlage dienten Schwarzweißaufnahmen aus einem amerikanischen Magazin, in dem ein Ballon abgebildet war. «Es war nicht ganz ungefährlich», erzählt er, «wäre ich entdeckt worden, wäre ich im Gefängnis gelandet.» Mit 17 Zentimetern fing alles an. Der Miniballon sollte die physikalischen Eigenschaften testen. Das Propan wurde mit einem Bunsenbrenner entflammt. Das zweite Modell brachte es schon auf sechs Meter. Als Gondel diente ein Obstkorb. Flammenwerfer und Ventilatoren kamen zum Einsatz. Nach nicht wenigen Abstürzen und einigen weiteren Modellen, die der Wind davontrug, gab es die ersten erfolgreichen Flugversuche. Mit großem Interesse verfolgten jetzt auch tschechoslowakische Offiziere das Treiben der Ballonbauer. Und auch die Sowjets bekamen Wind von den Fortschritten in Brno. Doch nicht nur das: Irgendwann versorgte man die kleine Gruppe um Aleš mit Bauplänen und Zeichnungen von Heißluftballons aus Deutschland und den USA. Dokumente, die auf nicht ganz legalem Wege beschafft worden waren. «Spionagematerial», erinnert sich Aleš, «das war natürlich interessant für uns, wobei die Unterlagen auch nur das bestätigten, was wir schon herausgefunden hatten.»
Im Frühjahr 1983 bauten sie den ersten Prototyp. Die Ballonhülle nähten sie aus Fallschirmseide. Wochenlang saßen sie an den Nähmaschinen und fügten die Stoffbahnen zusammen. Viele Kilometer Garn wurden verbraucht. Nach drei Monaten waren sie so weit: Der erste Heißluftballon, fast dreißig Meter groß, war startklar. Das Einzige, was fehlte, war eine Starterlaubnis. Und wieder mussten sie warten. Nach ein paar Wochen aber war ihre Geduld am Ende. «Wir wollten nun endlich starten», erzählt Aleš. Mit dem Auto fuhren sie fast 500 Kilometer über die Grenze nach Ungarn, wo sie den Ballon heimlich testen wollten. Im Nachbarland waren die Auflagen nicht ganz so streng. Es war der 4. Juni 1983. Ein historisches Datum: Auf den Tag genau 200 Jahre zuvor hatten die Brüder Joseph und Jacques Montgolfier in der Nähe von Lyon den ersten Heißluftballon schweben lassen. «Diesen Tag konnten wir uns nicht entgehen lassen.» Aleš sagt, er habe damals keine Angst gehabt, dass etwas schiefgehen könnte. Er war sich sicher, alles durchdacht zu haben. «Ein bisschen Mut gehörte dazu», sagt er, «vor allem aber Neugier.» Startplatz war eine kleine Lichtung in einem Waldstück in der Nähe eines Dorfes. Zu zweit kletterten sie in die kleine Gondel. Dann kappten sie die Seile und hoben ab. Vielleicht ein paar hundert Meter hoch. Aleš kann nicht sagen, wie hoch sie damals kamen. Einen Höhenmesser hatten sie nicht. Als sie eine Stunde später landeten und mit vor Aufregung zitternden Knien aus dem Korb wankten, stand für Aleš längst fest, was er von nun an tun wollte. Für ihn hatte eine neue Geschichte begonnen: Er wollte Heißluftballons bauen.
Aleš war zum Geburtshelfer der tschechoslowakischen Ballonfahrt geworden. Bis zur Novemberrevolution und zur politischen Wende im Jahr 1989 fertigte er im Auftrag der Regierung dreißig weitere Ballons für den osteuropäischen Markt. Als der Kommunismus zusammenbrach, gründete er seine eigene Firma. Im ersten Jahr schaffte er fünf Stück, zu Hause in seiner Wohnung. Heute hat er eine Fabrik mit 27 Angestellten, die mehr als 100 Ballons im Jahr bauen. Was sich wenig anhört, ist viel – es gibt nur zwei Firmen auf der Welt, die mehr produzieren. Der aus Bambus geflochtene Korb, der Brenner, die hitzebeständige Hülle aus besonders elastischem, reißfestem Polyester – alles entsteht in Handarbeit. Jedes Modell ist ein Original. Und das dauert seine Zeit. Ein Ballon aus Brno kostet ab 20000 Euro aufwärts. Doch das Geschäft läuft gut. KubíčekBalloons exportiert in über dreißig Länder.
Am Abend haben sich die Wolken zu gemütlichen Sofakissen zusammengeschoben. Der Wind hat sich entspannt. Der Start wird vorbereitet. Knatternd bläst ein Ventilator kalte Luft in die Ballonhülle, die zu einem unruhig wabernden Luftsack wird. Gemächlich richtet er sich auf und wächst zu einer Halbkugel. Dreitausend Kubikmeter passen hinein. Gasbrenner spucken meterlange Flammen in die Öffnung. Der Druck in der Hülle ist bald so groß, dass man auf ihr stehen könnte. Die dreißig Meter hohe Kunststoffbirne zerrt an den straff gespannten Halteleinen. Sie will jetzt nach oben. Wir klettern in die Gondel. Noch zwei, drei kräftige Brennstöße, dann löst Aleš die Seile. Sanft heben wir ab. Der Blick wird weit, als würde man das Zoomobjektiv einer Kamera aufziehen. Die Menschen, das Schloss und das Dorf schrumpfen zu einer Landschaft, wie es sie in der Welt von Modelleisenbahnen gibt. Die gleichmäßigen Spurrinnen der Traktoren werden filigran gezeichnete Muster. Die Seen werden schwarzblaue Tintenkleckse. Die Autobahn, die Prag und Brno verbindet, wird zu einem dunkelgrauen Asphaltfluss.
Aleš lehnt am Korbrand und schaut hinunter. Manchmal zieht er an einem kleinen Hebel über seinem Kopf. Dann zerreißt das Fauchen der Gasbrenner die große Stille, und die Feuerzungen klingen wie wilde Tiere. Aleš ist kein Mann, der viel redet. Wenn er aber etwas sagt, sollte man auf jedes Wort achten. «Eigentlich», sagt er jetzt, «ist so ein Ballon nicht viel mehr als ein Haufen Stoff. Doch dann füllen wir ihn mit Luft, und das Feuer verändert die Luft. Es ist ein Spiel der Elemente. Denn die erhitzte Luft trägt uns, und wir verlassen eine Zeitlang die Erde. Der Ballon ist die Verbindung von Himmel und Erde, von oben und unten.» Er klingt jetzt weniger wie ein Ingenieur, sondern mehr wie ein Philosoph. «Jede Fahrt verändert den Blick», erzählt er weiter, «hier oben wird mir jedes Mal wieder bewusst, dass es etwas sehr viel Mächtigeres gibt, das ich nicht beeinflussen kann. Ich kann nur regeln, wie hoch ich fahre, und das auch nur, solange die Gasflaschen gefüllt sind. Alles andere bestimmt der Wind. Und dann komme ich zurück zur Erde, zurück in den Alltag. Doch nun bin ich an einer anderen Stelle, an einem Ort, an dem ich nie gewesen bin. Und ich treffe Menschen, denen ich nie begegnet bin. Jede Fahrt verändert mich.»
Der Höhenmesser zeigt 3200 Fuß. Aus fast tausend Metern ist die Gegend um Radešin ein kleinteiliges Mosaik aus hellgelben Rechtecken, dunkelgrünen Kuppen und grauen Bändern, aus schwarzen Löchern, silbrigen Fäden und roten Tupfern. Mehr als tausend Mal hat Aleš die Erde von oben gesehen. Er ist in Japan, China und den USA geflogen. Er ist über der Wüste von Katar, dem russischen Baikalsee und dem Amazonas in die Luft gegangen. Und überall kamen Menschen, manchmal ganze Dörfer gelaufen, um zu gucken, was da vom Himmel fällt. Einmal musste er in der Nähe von Brno in einer Schrebergartenkolonie landen. Es ging nicht anders, das Gas war alle. Und wie überall auf der Welt waren es auch dort sehr stolze Kleingärtner. Der Korb wurde noch mindestens 100 Meter über den Boden gezogen. Zäune wurden niedergerissen. Garten für Garten wurde verwüstet. Alešhinterließ eine Schneise der Zerstörung. Als er endlich zum Stehen kam, rechnete er mit dem Schlimmsten. Doch die Gartenfreunde waren alle sehr gut gelaunt und freuten sich über den unerwarteten Besuch: «Wie schön, dass du da bist! Das wird uns niemand glauben: Ein Ballon ist in unseren Gärten gelandet!»
Ein anderes Mal, in Georgien, waren die Bewohner eines Dorfes so begeistert über sein plötzliches Auftauchen, dass sie ihn zum Essen einluden. «Es gibt ein Festmahl», versprachen sie und legten eine Tischdecke unter einen Apfelbaum. Dann schüttelten sie einmal kräftig an den Ästen – fertig war das Essen. «Selten haben mir Äpfel so gut geschmeckt», sagt Aleš. Und überhaupt hatte er die interessantesten Begegnungen in Ländern und Regionen, wo die Leute sehr arm waren. Oft war es das erste Mal, dass diese Menschen einen Ballon sahen. «Man schwebt vom Himmel hinab und wird angestarrt, als wäre man ein Zauberer.»
So war es auch im Winter 1987. Im Auftrag des sowjetischen Staatsfernsehens sollte Aleš mitten in Tiflis landen, der heutigen georgischen Hauptstadt. Es war Heiligabend, er hatte einen Weihnachtsmann und ein Kamerateam an Bord. Sie sollten Geschenke verteilen. So war der Plan. Der Wind trug sie aber ganz woandershin, weit auf das Land hinaus, in die Berge. In einem winzigen Dorf gingen sie runter. «Wir landeten direkt vor einem kleinen Haus. Zwei Jungen kamen aufgeregt herausgelaufen. Sie hatten noch nie einen Ballon gesehen. Und nun kam der Weihnachtsmann am Heiligen Abend vom Himmel runter, kletterte direkt vor der Haustür aus einem bunten Luftballon und brachte ihnen Geschenke.» Das Fernsehen übertrug live. Für die Bewohner des Dorfes war das damals alles ein bisschen wie ein Wunder. Und Aleš hat heute noch die beiden Jungen vor Augen, wie sie mit offenen Mündern dastehen und kein Wort herausbringen. «Die glauben sicher heute noch an den Weihnachtsmann.»
Nach zwei Stunden zieht Aleš an einer roten Leine, die oben an der Hülle des Ballons ein kleines Fenster öffnet. Die heiße Luft kann gleichmäßig entweichen. Wir verlieren an Höhe und zoomen uns wieder heran an die Welt. Wir landen. Nach 28 Kilometern endet die Fahrt auf einem Acker mit hüfthohem Gras. Aleš klettert aus dem Korb. Er lächelt. Keine Schrebergärtner, kein Bauer, der sauer ist, dass man auf seinem Feld gelandet ist. Langsam und lautlos fällt der Ballon in sich zusammen. Aleš sagt: «Ich bin schon mit so vielen Menschen gefahren, und jeder hatte gute Laune danach. In ihnen wächst etwas, was keine Kopie irgendeiner Fernsehreklame ist. Sie werden ruhiger und wachsen in ihrer Persönlichkeit. Deshalb baue ich Heißluftballone, weil sie Menschen berühren und verändern.» Er sieht zufrieden aus, als er das sagt. Und da kommen auch schon die ersten Schaulustigen aus dem nächsten Ort gelaufen.
Kilometer 2194 Nachts allein im Schloss
Der Mann hält einen riesigen Schlüsselbund in der Hand. «Sie dürfen also bei uns im Schloss übernachten», sagt er und blickt skeptisch. Es ist sein Beruf, Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Er ist der Nachtwächter im Schloss von Bojnice, der größten Touristenattraktion der Slowakei. 900 Jahre sind die Grundmauern alt. 200000 Besucher kommen jedes Jahr. Hochzeiten können hier gefeiert werden. Hunde aber sind verboten – Locke wird im Bus schlafen müssen. «Über Nacht sollten auch Sie besser nicht bleiben», betont der sonst eher wortkarge Mann noch einmal, «viel zu gefährlich.» Dann verzieht er sich mit seiner Thermoskanne in das Kabuff mit den Kontrollmonitoren. «Und eines noch: Laufen Sie nicht im Schloss herum, ich kann Sie sehen. Und sollte etwas passieren, die Polizei ist in fünf Minuten da. Gute Nacht!»
Etwas passieren? Ich sitze im Ostflügel der Burg. Goldene Stühle, reich verzierte Tische und Spiegel, alles Rokoko. Nebenan der «Blaue Barocksalon», dahinter das «Renaissance-Schlafzimmer». Für die Nacht habe ich sieben Räume und zwei Badezimmer für mich. Einst hatten hier die Bediensteten geschlafen. Mitte der neunziger Jahre war dieser Teil für einen Besuch von Prinz Charles und Lady Diana aufwendig umgebaut worden. Einige Millionen slowakische Kronen hatte das gekostet. Gekommen war das Paar dann doch nicht. Zu viel Romantik für zwei Menschen, die kurz vor ihrer Trennung standen.
Es ist kühl, die mächtigen Mauern lassen tagsüber nicht viel Wärme durch. Viele, die hier arbeiten, sind oft erkältet. Eine junge Frau schaut mich unentwegt an. Sie hängt an der Wand und ist bleich wie der Tod. Kein schönes Gemälde. Ich frage mich, wer sie war, ob sie hier gelebt hat. Doch keiner ist mehr da, der mir antworten könnte. Eine schwere Stille hat sich über Bojnice gelegt, das mit seinen Zuckerbäckertürmchen den französischen Prunkbauten der Loire nachempfunden ist. Viele Märchenfilme sind hier gedreht worden, und einige Horrorstreifen auch. Ob ich denn keine Angst habe, hatte mich Erik Kližan gefragt, der Archivar des Schlosses. Den ganzen Tag über hatte er mir die düsteren Legenden und Schauergeschichten erzählt, die man seit Jahrhunderten über die einstigen Bewohner verbreitet. Wie die grausige Tragödie der Schlossherrin, die von ihrem eifersüchtigen Ehemann in den Selbstmord getrieben wurde. Mit ihrem Kind in den Armen soll sie sich vom höchsten der Türme gestürzt haben und nun in manchen Nächten ruhelos durch die Burg wandeln. «Legenden sind dafür da, dass man sie erzählt», hatte Erik gesagt, «hast du wirklich keine Angst?» – «Nein, wovor denn?», hatte ich gefragt. «Vielleicht vor der Stille, du wirst hier ganz alleine sein.»
Nun weiß ich, was er gemeint haben könnte. Die Kirchenglocke von Bojnice schlägt elfmal. Es muss an der Stille liegen, dass die wenigen Geräusche, die noch zu hören sind, nun eine neue Bedeutung bekommen. So wie der Tag den Touristen gehört, gehört die Nacht den Dohlen, die zu Hunderten zwischen den Zinnen und unter den Dächern des Schlosses nisten. Sie schreien wie die rostigen Scharniere von Türen, die man besser nicht öffnen sollte. Und wenn die alten Holzdielen knacken und ächzen, glaubt man, ganz deutlich Schritte zu hören. Oder der Wind, der im Schlosshof pfeift, dass es sich wie das Klagen aus der Hölle anhört. Es muss an der Stille liegen, dass ich nach kurzer Zeit meine, etwas tun zu müssen. Ich rede laut mit mir selbst, gehe in jedes der sieben Zimmer und schalte das Licht an. Ich werde mutig und betrete einen langen Flur. Die spärliche Lichtpfütze der Taschenlampe zeigt mir den Weg. Türen links, Türen rechts. Wie viele Zimmer das Schloss tatsächlich hat, weiß niemand so genau. Man hat sie nie gezählt, 300, schätzt man. Gemälde, Geweihe, Waffen an den Wänden. Der Gang ist breit, sicher sechs Meter hoch, und führt in einen kleinen Innenhof. Einst ritten hier die Adligen auf Pferden hindurch. Nun tanzen die Schatten knochiger Äste im fahlen Mondlicht auf den grauen Burgmauern und sehen aus wie Arme, die nach etwas greifen. Die Schatten suchen das Licht. Ich weiß nicht, wonach ich gerade suche.
Ich durchquere den Hof. Plötzlich ein Geräusch, das wie das Klappern vieler, schwerer Schlüssel klingt. Ich drücke mich an eine Wand und warte. Doch es bleibt ruhig. Ich schleiche weiter, steige einige Stufen nach unten und stehe vor einer riesigen Tür, der Eingang zur Familiengruft. Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren war der letzte Besitzer des Schlosses, der Graf Ján Frantisek Pálffy, gestorben und in einem Sarkophag aus rotem Marmor dort unten beigesetzt worden. Vor einigen Jahren war aus dem Schrein eine seltsame Flüssigkeit getropft. Niemand konnte dies erklären. Wissenschaftler kamen, untersuchten und blieben ratlos. Der Schlossdirektor ließ die Gruft für Besucher schließen. Slowakische Zeitungen schrieben von den Tränen des Grafen, der nicht glücklich darüber war, wie mit seinem Erbe umgegangen wurde. Das Schloss war um eine Attraktion reicher.
Ich drehe an dem wuchtigen Knauf der Tür. Abgesperrt. Wieder die Glocke der Kirche – zwölf Schläge. Und ich stehe alleine vor einer Gruft – falsche Zeit, falscher Ort. Nun ist es nicht mehr wichtig, ob die Geschichten, die mir der Archivar erzählt hat, erfunden sind, denn nun klingen sie wie die Wahrheit. Wie die Gerüchte um Zuzana Podhradská, die weiße Frau, die im 15. Jahrhundert vom damaligen Schlossverwalter entführt wurde, wenige Tage später starb und in den Mauern der Burg begraben sein soll. Nacht für Nacht soll auch sie in einem weißen Leichengewand durch das Schloss schleichen. Und dann ist da ja noch die Sache mit der Fußspur eines Mädchens, die Arbeiter erst vor wenigen Wochen in frischem Zement entdeckt haben. Die könne man nicht anzweifeln, hatte Erik gesagt und mich in einen entlegenen Winkel des Schlosses geführt. Dort sah ich den Abdruck: Er hatte sechs Zehen.
Und nun fühlt sich mein Magen an, als würde sich ein spitzer Finger hineinbohren. Ich drehe um, verlasse den Hof und bin wieder im Gang. Ganz am Ende sehe ich Licht, eine Tür steht offen. Hatte ich sie nicht zugemacht? Ich weiß es nicht mehr, will jetzt nur zurück in eines meiner sieben Zimmer. Ich laufe den Flur hinunter, der kurze Weg dauert eine Ewigkeit. Ich schiebe die schwere Eichentür ein Stückchen weiter auf und lausche. Nichts. Ich gucke in den Spiegel, gehe noch einmal durch alle Räume und warte, dass etwas passiert. Doch es passiert nichts. Keine weiße Frau. Nur die Frau an der Wand, die mich beharrlich anstarrt. Erst als der Morgen den Dingen wieder Konturen verleiht, der Frühnebel die Hügel und Wiesen in Watte hüllt, nicke ich in meinem über 300 Jahre alten Bett, das jede meiner Bewegungen mit einem schrillen Kreischen begleitet, kurz ein.
Wieder die Glocke. Sechs Schläge. Der Nachtwächter hat Feierabend und geht. In drei Stunden werden die ersten Besucher vor dem Tor stehen. Die Führungen durch das Schloss werden beginnen. Der Tag in Bojnice wird wieder den Touristen gehören. Die Nächte aber – das weiß ich jetzt – werden für immer den Legenden bleiben.
2 Slowakei Zurück in die Zukunft
Záhradné ist ein Ort wie viele in der Ostslowakei. Eine Kneipe, viele Arbeitslose, keine Perspektive – die Jugend verlässt die Heimat. Jozef Hromják aber hat den anderen Weg gewählt: Der junge Mann ist zurückgekehrt. Und nun blüht sein Heimatdorf wieder auf.
Dies ist die Geschichte eines Traumes. Der Traum spielt in einem Garten. Und der Garten liegt in Záhradné, einem kleinen Dorf in der östlichen Slowakei. Ein junger Mann sitzt in diesem Garten im Schatten eines Pflaumenbaumes. Er trägt einen Dreitagebart und lange Haare, die er zu einem Zopf gebunden hat. Er steht auf und blickt sich um, dann sagt er: «Das hätte ich nie für möglich gehalten, der Traum ist wahr geworden.»
Im Garten stehen bunt bemalte Tische und Stühle. Kinder schaukeln. Auf dem Rasen döst ein Pärchen auf einer Decke. Ein Hund jagt eine Katze. Und neben dem Komposthaufen sitzen drei Alte auf einer Mauer und trinken Wodka. Einer von ihnen wippt mit dem Fuß im Takt zu Jim Morrisons Gesang: «Come on baby, light my fire». Im ehemaligen Kuhstall feiert eine Familie die Erstkommunion ihrer Tochter. Auf dem Tisch stehen selbstgebackener Apfelkuchen und selbstgebrannter Birnenschnaps. Jemand spielt ein altes slowakisches Volkslied auf dem Akkordeon. An der Hauswand hängt ein riesiger Kopf aus Pappmaché mit Segelohren und Knollennase, der derartig wahnsinnig grinst, dass es ansteckend ist. Auf einer kleinen Holztafel am Gartenzaun hat Jozef Hromják, der junge Mann mit dem Zopf, die Öffnungszeiten gepinselt: ZMLAK steht da in geschwungener, roter Schrift. Und darunter: Mittwoch bis Sonntag 15 bis 23 Uhr. ZMLAK? Es hat bislang noch jeder verwundert nachgefragt, was das denn bitte schön heißen soll, erzählt Jozef, den alle nur «Peppo» nennen. Und jedes Mal hat er es bereitwillig und auch ein bisschen stolz erklärt: Živé Múzeum L’udovej Architektúry a Kultúry – das lebendige Museum für Architektur und Volkskultur.
ZMLAK und sein Garten sind wie eine bunte Oase, die so gar nicht in den grauen Alltag des kleinen Ortes passen will. Denn Záhradné ist kein schönes Dorf. 1000 Menschen, zwei Kirchen, eine Kneipe, ein Fußballplatz, der Friedhof am Ortsrand und jeder Vierte arbeitslos. Gibt es Neuigkeiten, verbreiten sie sich hier schnell. Doch der Schaukasten am Gemeindehaus für die Aushänge ist leer. Am Ufer des Ternianka, des Flusses, der sich quer durch das Dorf schlängelt, knien drei Frauen und schlagen Bettlaken und Handtücher auf die Steine. Von ihnen unbeachtet wankt ein Mann über die Brücke. Er geht, als würden ihm seine Beine nicht gehorchen wollen. Vorsichtig setzt er einen Fuß vor den anderen wie auf den Planken eines Schiffes bei starkem Seegang. Er wünscht sich lautstark den Kommunismus zurück. «Sloboda», brabbelt er. Freiheit. Er versteht die Welt nicht mehr, und die Welt versteht ihn nicht mehr. Am Nachmittag sitzen die alten Mütterchen und Väterchen wie jeden Tag auf den Holzbänken vor ihren Häusern und warten, dass etwas passiert. Doch es passiert nicht viel. Ein ewiger Gleichlauf. Wer in Záhradné jung ist, geht fort. Nach Tschechien, nach Westeuropa oder noch weiter. Hauptsache, weg. Richtung Arbeit, Richtung Geld. Zurück bleiben die Alten, der Ort wird immer älter.
Die Gegend zählt zum Scharoscher Bergland, das zum westlichen Teil der Karpaten gehört, des massiven Gebirgszugs, der sich durch halb Südosteuropa erstreckt. Záhradné nistet in einem weiten Tal. Nördlich kommt schon bald die polnische Grenze, wo heute noch Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg vor sich hin rosten. Im Süden ist Prešov, die drittgrößte Stadt des Landes mit ihren 90000 Menschen, keine 15 Kilometer entfernt. Dort ist Peppo 1980 geboren. Und dennoch liegt Záhradné so abgeschieden zwischen bewaldeten Hügeln und Weizenfeldern, als hätte man es vergessen. Für die wenigen Touristen, die in den warmen Monaten auf Fahrrädern hier unterwegs sind, ist das Dorf nicht mehr als eine Durchgangsstation. Warum also ausgerechnet hier ein Museum? Peppo überlegt nicht lange: «Weil es meine Heimat ist und ich nicht zusehen will, wie meine Heimat stirbt.»
Die meisten seiner Freunde und auch zwei seiner drei Schwestern leben längst in größeren Städten wie Prešov, Bratislava oder München. Es ist eine Generation der Auswanderer. «Die Jüngeren sind auf der Suche nach einer Identität, es fehlen die Vorbilder, die sie glauben anderswo zu finden.» Auch Peppo ging auf die Suche. In Prešov lernte er Koch, arbeitete zwei Jahre in einem Dreisternehotel in Zürich, zwei weitere in einem Fünfsternehotel in Prag. Er lernte viel und lebte gut. Sein Bankkonto war so voll wie nie. Doch das war es nicht, was er wollte. «Es war die falsche Richtung», sagt er, «manchmal muss man erst gehen, um zu verstehen, was die Heimat einem bedeutet.» Als seine Schwester Maruška ihn anrief und von einem Bauernhaus erzählte, das verkauft werden sollte, kam er zurück. 2005 war das. Eine alte Frau war gestorben. Ihre Kinder hatten das Grundstück mit dem Haus geerbt, es aber nicht behalten wollen.
Gemeinsam mit seinem Freund Milan Pavel, einem Architekten und Restaurateur, kaufte Peppo die baufällige Kate. In weniger als vier Monaten renovierten sie alles mit viel Holz, Natursteinen und warmen Farben. Einen Raum haben sie so belassen, wie die Menschen des Dorfes vor 100 Jahren lebten, mit traditionellen Möbeln und vielen Gegenständen des Alltags. Ein kleines Volkskundemuseum, einzigartig für diese Region. Im Garten können wahre Schätze besichtigt werden. Ein antiker Kinderwagen, ein Butterfass, ein Bienenkorb, Spinnräder, Webstühle und landwirtschaftliche Maschinen. Ein Sammelsurium der Geschichte. Und regelmäßig bringen Menschen noch mehr Dinge aus vergangenen Zeiten, die sie in Kellern und auf Dachböden gefunden haben. «Diese Kultur und das Wissen darüber würden sonst verschwinden, so bleiben sie am Leben», hofft Peppo, «hier die Kultur, die wir nicht vergessen sollten, und dort die Kultur, die wir selber machen.» Künstler stellen ihre Bilder und Skulpturen aus, Konzerte oder Lesungen finden statt. Immer häufiger kommen Leute von außerhalb vorbei, da sie von dem kleinen, ungewöhnlichen Garten im Dorf nördlich von Prešov gehört haben. Menschen aus den umliegenden Ortschaften, Studenten aus der Stadt und sogar mehr und mehr Touristen.
«Es geht hier aber nicht um Geld», sagt Peppo, «es geht um ein gutes Gefühl, um ein Lächeln.» Es ist ihm wichtig, das zu betonen, und es sind die vielen kleinen Momente, die ihm genau das zeigen. Wenn Großeltern mit ihren Enkeln zum Eisessen kommen und den Kleinen die Werkzeuge erklären, mit denen sie früher selber noch gearbeitet haben. Wenn er in seiner Küche etwas Traditionelles wie Bryndza, ein pikanter Frischkäse aus Schafsmilch, mit etwas Neuem kombiniert und Leute aus dem Dorf, die noch nie Olivenöl gegessen haben, erstaunt feststellen: «Was war denn das? Das war ja lecker!» Oder wenn dieser eine Mann, den er vorher gar nicht gekannt hat, nun jeden Monat einmal vorbeischaut, um den Rasen zu mähen. Er will nichts dafür haben. Er kommt einfach gerne, da ihm die Atmosphäre gefällt. Meist sitzen Peppo und der Mann dann noch gemeinsam auf einer der Bänke. Es riecht nach frisch gemähtem Gras, und der Mann erzählt von früher. Früher, das war die Zeit vor 1989, die Zeit des Ostblocks. Alles war reguliert, alles verstaatlicht, alle sollten gleich sein. Was früher in der Sowjetunion Kolchose hieß, war in der ehemaligen Tschechoslowakei die örtliche Družstvo, einer der landwirtschaftlichen Gemeinschafts- und Staatsbetriebe, einst der ganze Stolz des kommunistischen Regimes. In Záhradné war sie nicht ganz so groß wie anderswo, nur etwa 20 Menschen arbeiteten hier. Vielen wurde in den sechziger und siebziger Jahren eine Stelle in den Fabriken von Prešov zugewiesen, wo Kleidung am Fließband produziert und Maschinen gebaut wurden. Als die Sanfte Revolution den Sozialismus zusammenbrechen ließ, war Peppo gerade neun geworden. Die Družstvo machte Konkurs. Viele Fabriken mussten schließen. Die Zeiten, als alle Arbeit hatten und alle arbeiten mussten, waren vorbei. Was nach jahrzehntelanger Kommandoplanwirtschaft blieb, war ein kollektiver Brei in den Köpfen der Menschen. Und nun stand die Demokratie vor der Tür. «Den Älteren ist die Individualität bis heute fremd», sagt Peppo, «sie haben es nie gelernt.»
In kurzer Zeit hat sich damals viel verändert, vielleicht zu viel und zu schnell. Nach der Wende verließen viele das Land. 1993 folgte die Trennung von Tschechien. 2004 verschoben sich die Grenzen der EU, als die Slowakei Mitglied wurde. Doch wie viel Veränderung verträgt ein Land in nicht einmal 20 Jahren? Heute kann man schnell das Gefühl bekommen, dass hinter Bratislava nicht mehr viel kommt. Die Hauptstadt liegt an der Grenze zu Ungarn und Österreich, viel weiter westlich geht es nicht mehr. In Richtung Osten beginnt das Hinterland. Und die Ostslowakei ist das Hinterland vom Hinterland. Hier liegen manchmal nur wenige hundert Meter zwischen aufgeräumten Wohnsiedlungen und den verdreckten Elendsvierteln der Roma, die manche «Vorhölle» nennen, da in den Slums Armut und Kriminalität den Alltag bestimmen und fast niemand Arbeit hat. Dort, wo diese zwei Welten aufeinanderprallen, ist die Slowakei ein zerrissenes Land. In Záhradné aber haben nie Roma gelebt, hier hat es schon damals keine Arbeit gegeben, die Menschen von außerhalb hätte anlocken können, was einige Dorfbewohner heute als Glück bezeichnen.
Als Peppo durch das Dorf läuft, stoppt er kurz an einem Gartenzaun. Auf dem Grundstück steht ein verbeulter, roter Lada, daneben verrostet ein brauner Škoda. Beiden Autos fehlen die Reifen. Im Škoda sitzt ein Junge mit einem Mondgesicht hinter dem Steuer, auf der Motorhaube ein großer schwarzer Hund. Der Junge reißt wild am Lenkrad herum, dazu brummt er und lässt die Lippen vibrieren. «Wohin fährst du?», fragt Peppo. Der Junge steckt seinen Kopf durch das geöffnete Seitenfenster. «Nach Bratislava, zu meinem Bruder!» – «Kennst du den Weg?» – «Den kennt doch jeder!», antwortet der vielleicht Zehnjährige. «Na dann, gute Fahrt! Nachher noch eine Limo bei mir im Garten?» – «Ja klar, bis später!»
Im Garten von ZMLAK feiern Jugendliche gerade ihre bestandene Abiturprüfung. Sie hätten auch in Prešov den Abend verbringen können, dort sind sie zur Schule gegangen. «Wir wollen Peppo und seine Ideen unterstützen», sagt eine der jungen Frauen, «Záhradné ist unser Heimatdorf, verstehst du?» Am Tisch nebenan hört ein Mann mit. Er ruft: «Das, was du sagst, macht mich glücklich – auch ohne Zähne.» Dann lacht er, und man kann sehen, was er meint. Und dann lachen alle und sitzen bis spät in den Abend zusammen. Und auch der Junge mit dem Mondgesicht kommt noch auf eine Limonade vorbei und bringt seine Eltern mit. «Das Dorf ist wieder aufgewacht, es lebt wieder», sagt Peppo, «es ist wie ein Aufbruch.» Wohin? «Man wird sehen.» In wenigen Wochen wird er Vater. Es wird ein großes Gartenfest geben. Jeder wird kommen dürfen. Es wird selbstgebackenen Apfelkuchen geben und den selbstgeräucherten Schinken seines Schwiegervaters. Und Záhradné hat mit ZMLAK eine kleine Attraktion, die den Ort besonders macht und aufblühen lässt – wobei schon der Name des Dorfes eine Besonderheit ist: Záhradné heißt übersetzt Garten.
Kilometer 3627 bis 3722 Im toten Winkel
Der Polizist tritt an das geöffnete Seitenfenster. Mit Zeige- und Mittelfinger tippt er flüchtig an den Schirm seiner Dienstmütze. In gebrochenem Deutsch sagt er: «Guten Tag. Fahren 40 zu schnell, mein Kollege hat geblitzt.» Ich bin überrascht. «Dann müsste ich ja 90 im Ort gefahren sein.» Der Beamte nickt: «Ja, 90.» Vor uns stehen noch zwei Autos, den Kennzeichen nach aus Österreich und Deutschland. Ich frage, ob er mir die Aufnahme zeigen könne. Er überlegt. «Warten Sie!» Er geht zu seinem Wagen, spricht in ein Funkgerät, kommt zurück. Er sagt: «30 zu schnell.» Wieder bin ich überrascht. «Sagten Sie eben nicht 40?» – «Nein, 30.» Ich bin schon häufiger angehalten worden mit meinem Bus. Manchmal wurde ich von den Männern mit den Mützen mehrmals im Monat aus dem Verkehr gezogen, aber so skrupellos wie dieser Freund und Helfer ist noch nie einer gewesen. «Höchstens 10», sage ich. Er: «25.» Ich: «15.» Wie beim Kuhhandel. Schließlich er wieder: «20! Zahlen bar?» Dass ich keine slowakischen Kronen dabeihabe, will er mir nicht glauben. «Sind Sie sicher?» Ich bin mir sicher. Jetzt wird er unruhig. «Und Euro?» Euro habe ich, das sage ich ihm aber nicht. Er ist verärgert. Genervt reicht er mir einen Überweisungsschein, den ich nie ausfüllen werde. Dass dieser Tag der vielleicht ungewöhnlichste der gesamten Reise wird, ist mir in diesem Moment noch nicht klar. Ich kann ja nicht wissen, dass diese Begegnung erst der Anfang gewesen sein sollte.
Vier Stunden später. Ein einsamer Feldweg irgendwo in der östlichsten Ostslowakei. Wir haben uns verfahren. Ich will umdrehen, lege den Rückwärtsgang ein und setze zurück. Plötzlich ein Ruck, dazu ein Knall, als ob wir gegen etwas Großes gefahren sind. Ein Schrei. Im Rückspiegel sehe ich einen Motorradfahrer, der mit seiner Maschine zur Seite kippt. Ich springe aus dem Bus, Locke begrüßt schwanzwedelnd den in Schwarz gekleideten Mann am Boden. Ein Hüne mit Helm – wie hatte ich den bloß übersehen können? Er flucht, seine Stimme überschlägt sich. Was er schreit, verstehe ich nicht. Dann steht er auf, wuchtet das Motorrad hoch und klopft sich den Staub vom Leder. Passiert ist ihm nichts, nur ein Rückspiegel hat beim Sturz einige Kratzer abbekommen. Erleichtert atme ich durch. Der Mann auch. Locke bellt. Ich krame eine Flasche Wein hervor, halte sie ihm zusammen mit einem 50-Euro-Schein hin und zeige auf den Spiegel. «Okay?» Seine finstere Miene klart auf. Jetzt lächelt er sogar. Er nimmt das Geld und die Flasche, steigt auf seine Maschine, winkt zum Abschied und fährt davon. Zurück bleibt eine Staubwolke und der Gedanke, dass Geld alle Probleme lösen kann. Aus irgendeinem Grund möchte ich aber bis heute nicht glauben, dass er sich einen neuen Spiegel gekauft hat.
Drei Stunden später. Auf diesem Tag muss ein Fluch liegen. Wir stehen am Straßenrand in Nová Sedlica, einem weltabgewandten Dorf in einem toten Winkel am Rande EU-Europas. Die Ostwand, wie manche Slowaken die Grenze nennen, die ihr Land von der Ukraine trennt, steht keine drei Kilometer von hier. In nördlicher Richtung sind es fünf Kilometer bis nach Polen. Und wir haben das nächste Problem: Bei einem Ausweichmanöver sind wir über ein abgesägtes Straßenschild gefahren, das uns den Reifen aufgeschlitzt hat. Vielleicht, denke ich, ist das alles bloß ein Test und jemand hat diesen Tag von vorne bis hinten geplant, um meine Grenzen auszuloten. Der korrupte Polizist und der Motorradhüne – beides Statisten. Auch der Fahrer des Autos, dem wir Platz machen mussten, ist bestellt worden. Er hatte mich so geschickt abgedrängt, dass ich über den scharfkantigen Metallstumpen fahren musste. Und nun steht plötzlich ein Mann vor mir. Er hebt die Hand zum Gruß und sagt: «Hat kaputt, was?» Er wirkt vergnügt. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll, deute wechselweise auf den Reifen und das abgesägte Schild. Er kommt näher, klopft mir auf die Schulter. Dann kniet er auch schon vor dem Bus und setzt den Wagenheber an.
Pavel ist ein sehr dünner und schon jetzt, am späten Nachmittag, sehr betrunkener Mann. Er ist aber auch kräftig wie ein Pferd, und er schnauft auch so. Nach zehn Minuten ist der Reifen gewechselt. «Ukrajina», ruft Pavel und deutet nach Osten. «Pol’sko», sagt er und zeigt nach Norden. «Európa dort» – er blickt nach Westen. Dazu muss man wissen, dass mit Pavels linkem Auge etwas nicht in Ordnung ist. Es scheint orientierungslos in seinem Schädel umherzurollen, das andere starrt dafür umso zielstrebiger. Er hat einen Blick, der nicht von dieser Welt ist. Ein Bier hat er sich trotzdem verdient. Ich reiche ihm eine Flasche und öffne mir die nächste. Prost, Pavel!
Viel später auf dieser Reise wird es noch zwei weitere Blechschäden geben. Auf der Kanareninsel La Palma werden wir an einer Ampel mit dem Kleinwagen einer Frau zusammenstoßen. Sie wird total begeistert sein, dass ich ihr als Entschuldigung eine Flasche Wein in die Hand drücke. Und im Zwergstaat San Marino werden wir rückwärts gegen einen Baum fahren. Aber es gibt sie eben manchmal, diese Tage, an denen seltsame Dinge geschehen, an denen man ohne Not gegen Bäume oder Motorräder über den Haufen fährt. Und am Ende des Tages fragt man sich, ob das wirklich so passiert oder nicht doch alles bloß ein Traum gewesen ist.
3 Polen Kein Ort für einen Audioguide
Jacek Lech ist in Oświęcim geboren und aufgewachsen. Dort arbeitet er als Guide für Touristen. Er führt ein normales Leben an einem unnormalen Ort. Denn die Welt kennt Oświęcim unter einem anderen Namen.
Was der Name seiner Heimatstadt für Gefühle auslösen kann, hat Jacek Lech schon oft erlebt: Die Menschen erschrecken. Sie hören den Namen und zucken zusammen. Manche verstummen, es schnürt ihnen die Kehle zu. Andere reißen überrascht die Augen auf und fragen: Echt? Da bist du geboren? Wie kann man da denn leben? Betroffene Blicke. Betretenes Schweigen. Das war schon früher so, wenn er mit seiner Fußballmannschaft unterwegs war oder ins Ferienlager an die Ostsee fuhr. Und das ist heute noch so, wenn er nach seiner Heimat gefragt wird. Jacek sagt, er hat gelernt, mit den Reaktionen zu leben, wenn er antwortet: «Ich komme aus Oświęcim.» Denn die Stadt in Südpolen hatte früher mal einen deutschen Namen: Auschwitz.
Die Hölle auf Erden, der größte Massenmord der Geschichte – das ist es, was die Welt zur Kenntnis genommen hat und was die Stadt, die nur fünf Jahre lang Auschwitz hieß und als Oświęcim eine über acht Jahrhunderte zurückreichende Geschichte hat, zu einem der wichtigsten Touristenziele des Landes macht. «Es gibt die Gedenkstätte und es gibt die Stadt», muss Jacek dann erst einmal erklären. Selbst viele Polen wissen das nicht. Rund eine Million Besucher kommen jedes Jahr nach Auschwitz, von Oświęcim sehen sie nicht viel. Viele der 40000 Bewohner glauben, dass die Geschichte noch immer zu große Schatten auf die kleine Stadt wirft. Sie fühlen sich als Verlierer der Geschichte. Sie sagen, ihre Stadt hätte keine Chance auf Entwicklung mit dieser Vergangenheit. «Ich glaube das nicht», sagt Jacek, «zumindest im Alltag ist davon nicht viel zu spüren. Für die Menschen hier ist es schon lange kein Widerspruch mehr, am Abend auf dem Weg in die Disco am Lagerzaun vorbeizulaufen. Wir wissen, dass dies kein normaler Ort werden wird, dennoch müssen wir versuchen, ein normales Leben zu führen.» Vielleicht hätte Oświęcim ohne den Zweiten Weltkrieg heute ein anderes Gesicht und wäre für hervorragende Liköre, sein Schloss oder die schönen Kirchen bekannt. Doch so wie auch Hiroshima, Tschernobyl oder Srebrenica Orte sind, an denen das Grauen wohnt, sollte es hier nicht anders kommen.
Die Menschen aus Oświęcim sind froh über ihren Fluss, der sie zumindest räumlich von der Vergangenheit trennt. Die Sola, ein Nebenarm der Weichsel, teilt die Stadt in einen großen Teil rechts vom Ufer und einen kleineren links. Linksseitig liegt das ehemalige Konzentrationslager, das sogenannte Stammlager. Die Sola fließt unmittelbar daran vorbei. Kurz bevor sie allerdings die wuchtigen, aus roten Ziegelsteinen gebauten Baracken und die Stacheldrahtzäune erreicht, macht sie einen Bogen. Sie entfernt sich wieder. Es sieht so aus, als wüsste das Wasser, dass dort Schreckliches geschehen ist. Es gibt Menschen, die sagen, dass Wasser ein Gedächtnis hat. An diesem Ort möchte man das glauben. Denn erst dort, wo der Lagerkomplex endet, ändert auch der Fluss wieder seinen Lauf und macht den Bogen zurück, ehe er einen Kilometer hinter der Stadt in die Weichsel mündet.
Jacek lebt auf beiden Seiten des Flusses, in beiden Städten: Er ist 1971 in Oświęcim geboren, dort ist er aufgewachsen, dort wohnt er heute. In Auschwitz, der Gedenkstätte, arbeitet er als Touristenführer, auch wenn man das an diesem Ort nicht so nennen möchte. Jacek ist Geschichtswissenschaftler. In seinem kurzärmeligen karierten Hemd, mit seiner Brille, seinem aufrechten Gang und den dünnen weißen Armen sieht er aus wie ein Einserschüler. Er spricht perfekt Englisch und Schwedisch. Auch sein Deutsch ist beinahe akzentfrei, nur manchmal rollt das R ein wenig zu weit. Seit 2001 führt er Besucher durch das Stammlager und zeigt ihnen auch das einstige Vernichtungslager Birkenau drei Kilometer außerhalb der Stadt.
Als Junge fuhr Jacek oft mit dem Fahrrad an den meterhohen Zäunen und Wachtürmen in Birkenau vorbei, wenn er auf dem Weg zum Baggersee war. Doch erst mit zwölf traute er sich mit Freunden zum ersten Mal auf das Gelände. «Wir wussten nicht, was dort geschehen war. Dass etwas Grausames passiert sein musste, spürten wir aber sofort. Der Stacheldraht, die Baracken, die Ausmaße, die Gleise, die hier endeten. Und vor allem diese Stille. Die ganze Atmosphäre war gespenstisch. Später spielten wir auch in den verlassenen Bunkern und sahen uns die zerstörten Gaskammern und Krematorien an. Wir wussten ja nichts darüber, für uns waren das bloß Ruinen.»
Erst in der Schule bekam Jacek einen ersten Hintergrund. Bis 1989 aber hatte es in Polen kaum Details zum Holocaust gegeben. Man hatte geglaubt, dass die meisten der Opfer Polen gewesen waren. Die Ohnmacht war groß, als nach der Kapitulation des Kommunismus die ersten Bücher erschienen und erstmals die Zahl der in Auschwitz ermordeten Menschen genannt wurde. Eineinhalb Millionen. Man wusste nun auch, dass die meisten Opfer Juden aus ganz Europa und etwa zehn Prozent Polen darunter waren. Durch die öffentliche Diskussion, die nun begann, fing auch Jacek an, sich für die Geschichte seiner Heimatstadt zu interessieren. Zu Hause saßen sie oft am Tisch und diskutierten. Jeder erzählte, was er wusste. Sein Onkel war Tischler und im KZ ein sogenannter Zivilarbeiter gewesen. Fast täglich musste er im Stammlager Reparaturen erledigen. Wenn er am Morgen durch das Lagertor trat, wusste er nicht, ob er den Tag überleben würde. «Er hat schreckliche Dinge gesehen», sagt Jacek, «die Menschen aus Oświęcim