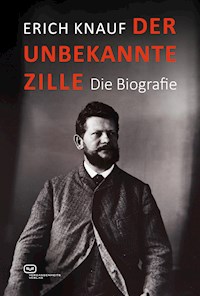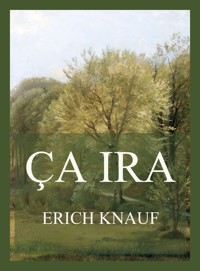
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Europa im Umbruch – ein Kontinent in der Krise. In seinem vielschichtigen Roman "Ça-ira!" wirft Erich Knauf einen schonungslosen Blick auf die gesellschaftlichen Verwerfungen des 21. Jahrhunderts. Durch ein kaleidoskopisches Erzählgeflecht verschiedener Stimmen und Schicksale entstehen eindringliche Porträts von Menschen, die zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Aufbruch und Zusammenbruch navigieren. Knaufs provokanter Stil legt die Widersprüche einer entfremdeten Welt bloß und verleiht den Entrechteten eine Stimme. Der Soziologe und Autor verbindet literarische Kraft mit politischem Bewusstsein – entstanden ist ein Roman, der nicht nur unterhält, sondern zum Nachdenken über unsere Rolle in einer zerrissenen Gesellschaft herausfordert. Ein leidenschaftlicher Appell an das Gewissen unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ça ira!
Reportage-Roman aus dem Kapp-Putsch
ERICH KNAUF
Ça ira! Erich Knauf
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682185
Quelle: http://digital.bib-bvb.de/view/bvb_mets/viewer.0.6.5.jsp?folder_id=0&dvs=1739300950393~979&pid=17888179&locale=de&usePid1=true&usePid2=true
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
I. Kamerad Wunderlich. 1
II · Das Schlachtenpotpourri6
III. Schnecken. 11
IV. Simson und der Löwe. 15
V. Das Meisterstück. 20
VI. Eine rote Abendwolke. 25
VII. Guten Morgen, Herr Rittmeister31
VIII. Der Panzerzug. 36
IX. Schüsse in der Nacht41
X. Siebzehn Portionen und eine Leiche. 47
XI. Der Feldherrnhügel52
XII. Pflug und Furche. 57
XIII. Das Puppchen. 63
XIV. Auf freier Strecke halt69
XV. Dem Manne kann geholfen werden!75
XVI. Der Himmel hängt voller Geigen. 79
XVII. Ein Luftkurort85
XVIII. Die rote Lotte. 89
XIX. Eine Nacht ohne Schlaf97
XX. Der Kompass102
XXI. Marschmelodie. 107
XXII. Alles aussteigen!112
I. Kamerad Wunderlich
Am liebsten ist es mir, wenn ich allein im Coupé sitze. Der kleine Klapptisch am Fensterplatz der dritten Schnellzugsklasse erleichtert das Lesen und Schreiben, und beides hilft über die vielen Reisen hinweg, die der Beruf mit sich bringt.
Der strenge Winter hat mir diese ungestörte Fahrteinsamkeit oft verschafft. So saß ich also wieder einmal an der dick vereisten Fensterscheibe, hatte ein Abteil für mich allein, packte mich fest in meinen Mantel und schrieb. Das zu besprechende Buch lag neben mir, und ich hatte gerade den richtigen Anfang zu einer längeren Rezension gefunden, als der Zug langsam in die Station einlief. Ich hoffte im Stillen, dass der zugezogene Türvorhang mir helfen möchte, mein Coupé für mich reserviert zu halten, zumal ich dann zwei Stunden bis zur nächsten Station Ruhe gehabt hätte. Der Zug hielt kurz, Türen klappten, Stimmen verloren sich in der strengen Kälte des frühen Morgens, und dann setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Schon glaubte ich, für zwei Stunden nur dem rhythmischen Takt der Räder, dem gleichmäßigen Sausen und meiner Arbeit anzugehören, als ein auf dem Wagengang herumtappender Mann die Tür meines Abteils aufriss, brummig grüßte und sich in die Ecke mir gegenübersetzte. Er versuchte einzuschlafen, und ich wünschte ihm heimlich einen guten Erfolg. Aber plötzlich sah ich, wie er mich mit halb zugekniffenen Augen musterte. Ich spürte deutlich, wie er sich Gedanken über mich machte; es mochte ihm wohl seltsam vorkommen, dass ihm einer gegenübersaß, der vor sich hinstarrte, manchmal auf die eisbedeckte Scheibe, und dann dem schwankenden Wagen zum Trotz wieder etliche Zeilen hinkritzelte.
Diese Art, mir zuzusehen, störte mich. Der Mann mochte in meinem Alter sein, war breitschultrig und kräftig gebaut, machte aber trotzdem den Eindruck großer Lebhaftigkeit und eines beinahe heftigen Temperaments. Das Gesicht wäre fast kindlich gewesen, wenn nicht ein bitter gezeichneter Mund und ein energisch betontes Kinn diesen Eindruck gestört hätten.
Dieses Gesicht hatte ich doch schon gesehen?
Eine Weile saßen wir uns gegenüber. Wahrscheinlich kramten wir beide in unseren Erinnerungen, denn mein Gegenüber richtete sich schließlich auf: »Wir, entschuldigen Sie, kennen uns doch?« Und dann stellte es sich heraus: Wir waren Kameraden aus dem Felde. Richtig! Die Uniform und die Spuren des Hungers damals, und die inzwischen vergangenen Jahre! Sonst hätte ich doch den Karl Wunderlich sofort erkennen müssen.
Wenn ich alles, was ich im Kriege erlebt habe, aus dem Gedächtnis gestrichen hätte, eines werde ich nie vergessen:
Wir lagen vor Verdun auf Höhe 304, rechts vom Toten Mann, und die Stellung war so bekleckert, dass der Offizier vom Graben fast nie bis zu unserem Maschinengewehr kam. Eigentlich hätten wir dort Doppelposten stellen müssen. Aber dann hätten wir überhaupt nie mehr schlafen können. Ich hatte meine zwei Stunden Wache geschoben, war zuletzt aber, ohne es zu wollen, eingeschlafen, und als mich Wunderlich ablöste, hatte ich die kleine Bastion aus Sandsäcken, unseren geringen Schutz, durch das schläfrige Anlehnen nach dem kaum zwanzig Meter entfernten französischen Sappenkopf zu eingeworfen. Bevor ich die Augen richtig aufgebracht hatte, war Karl rausgeklettert, um die Sandsäcke wieder aufzuschichten, ehe der dicke Morgennebel durchsichtig wurde. Wie er den letzten Sack aufhob und mir zureichte, sah ich, wie durch dünnes Milchglas, drüben Kopf und Brust eines Franzosen um die Schulterwehr kommen, und in diesem Augenblick sah Karl den Franzmann auch. Er drehte sich in seiner kauernden Stellung langsam und wie geistesabwesend um und starrte dem Sappenposten ins Gesicht, dann sprang er mit einem Satz zu mir herein und war ganz ohne Atem und ohne einen Tropfen Blut im Gesicht. Nach einer Weile riskierten wir ein Auge, und sieh da, unser Freund, der vorhin Karl wie einen Hund hätte abschießen können, spähte gleichfalls um die Ecke und drohte uns lächelnd und mit erhobenem Finger. Er war ein Mann, dem man die vierzig Jahre und den Familienvater ansah, und er machte ein Gesicht, als wollte er sagen: Na, ihr Bengels, passt mal besser auf; das nächste Mal passiert was ...
Himmel! Wir beide waren ganz aus dem Häuschen! Auf einmal hatte Karl sein Päckchen Tabak – er war Nichtraucher und schon deshalb bei jeder Gewehrbedienung sehr beliebt – aus der Rocktasche heraus und warf es dem Franzosen zu. Es blieb aber im Draht hängen, und der Blaukittel konnte es nicht erreichen, auch mit dem aufgepflanzten Bajonett nicht, und allzu weit wollte er sich wohl auch nicht vorwagen. Er wusste ja nicht, ob wir nicht doch Halunken wären. Ehe ich zugreifen konnte, und ich hätte ihn natürlich zurückgehalten, war Karl raus, setzte über den Drahtverhau weg – Menschenskind, es war schon allerhand hell geworden! – und langte dem erschrockenen Franzosen das Päckchen Tabak hin. Dann rollte er wieder zu mir herein, lachte und drückte mich, als wenn ich ein Mädel und der Krieg aus wäre ...
Der war aber noch nicht aus. Wir lagen noch viele Wochen auf Höhe 304. Es war jetzt auszuhalten. Wir bekamen dort den schönsten Waffenstillstand. Und das war ganz einfach zugegangen: Wie ich am nächsten Morgen wieder von Wunderlich abgelöst wurde, schaute drüben unser Franzose wieder um die Ecke. Diesmal ging Karl gleich hinüber, und er bekam dafür Schokolade und Ölsardinen. Auch eine französische Zeitung, in der etwas über einen revolutionären Aufstand in Deutschland geschwindelt wurde, von dem damals ja noch keine Rede sein konnte. Am nächsten Morgen warteten drei Franzosen auf ihren Tabak, und so ging das weiter, bis der schönste Tauschhandel im Gange war. Karl übertrieb die Sache so sehr, dass er manchmal in den französischen Gräben spazieren ging und von der Grabenbesatzung drüben versteckt werden musste, wenn ein französischer Offizier kontrollieren kam. Unsere Offiziere taten, als wüssten sie von nichts, denn es war ihnen damals recht lieb, dass uns die Franzosen an dieser Stelle in Ruhe ließen. Unsere Stellung war nämlich sowieso nicht viel wert. Wir hingen auf dem Bergrücken wie angeklebt, und es brauchte tatsächlich nur einmal gründlich zu regnen und uns die ganze Herrlichkeit wegzuschwemmen. Karl war schließlich nicht mehr der Einzige, der zu den Franzosen hinüberlief und Lebensmittel gegen Tabak einhandelte. Es war ja nun auch keine Kunst mehr. Die friedliche Nachbarschaft ging so weit, dass in den Nächten Franzosen und Deutsche zusammen einen gemeinsamen Drahtverhau bauten, was ja bei der geringen Entfernung der Gräben voneinander eigentlich auch das richtige war. Die Franzosen hielten die Pfähle, wir klopften. Oft wurde dabei sogar geraucht. Den Drahtverhau nicht zu verstärken, sondern völlig wegzuräumen, auf diesen Gedanken kam keiner, so weit war es wohl damals noch nicht.
Ich vergesse die Nacht nicht, in der ich und Karl nach einer kurzen Ruhezeit wieder in unseren Graben kamen und dort erfuhren, dass Befehl gegeben war, morgen früh, wenn die Franzosen wieder ahnungslos aus ihren Gräben auftauchten, um mit den Deutschen zu plaudern und Geschäfte zu machen, auf sie zu schießen. Der Drahtverhau war nämlich fertig geworden, in den ruhigen Nächten hatten wir genug Stollenbretter und Maschinengewehrmunition heranschaffen können, und nun sollte der glorreiche Krieg wieder weitergehen. Karl lief wie ein Verrückter von Posten zu Posten, aber alle gaben dieselbe Antwort. Sie zuckten die Achseln, wurden bleich und wortkarg, Befehl sei Befehl, und man könne ja nichts machen, wenn der Leutnant danebenstünde. Da stieg Wunderlich aus dem Graben und ging zu den Franzosen hinüber, um es ihnen zu erzählen und sie zu warnen, und so kam es, dass wir am anderen Morgen nicht auf ahnungslose und schutzlose Menschen zu schießen brauchten, mit denen wir uns in den letzten Wochen so gut vertragen und verbrüdert hatten. Mit dem Waffenstillstand war es natürlich aus, zumal unsere Artillerie den französischen Graben, aus Versehen dabei auch den unseren, mit schwerem Feuer belegte.
... So trifft man sich also wieder! Wir hatten uns seit 1916 nicht gesehen. Karl war den Essenholern zugeteilt und bei einem Feuerüberfall verwundet worden, hatte sich bis nach Deutschland durchgeschlängelt und kam dann zu einem anderen Truppenteil. Ich erfuhr jetzt, dass er es sogar bis zum Unteroffizier gebracht hatte – acht Wochen vor Kriegsende. Der alte Rebell und Meuterer – Unteroffizier!
»Da staunste! Weißt du, am meisten habe ich mich selbst damals gewundert. Der Alte, der trotz seiner Verwundung und der Länge der Zeit beim Leutnant hängengeblieben war, weil er öfter den Mund auftat als es dem Stab lieb war, unser Alter also, mit dem man ein Wort reden konnte, fragte mich nach der Beförderung: ›Na, Wunderlich, was denken Sie sich nun eigentlich, dass Sie Unteroffizier geworden sind?‹ Ich grinste ihn an: ›Was ich denke? ... Ich denke, der Krieg ist für Deutschland verloren.‹ Er tat, als ob er nicht recht verstünde. ›Wieso?‹ Ich guckte ihn scharf an: ›Wenn die Auswahl so klein ist, dass ich an die Reihe komme, dann ist bald Feierabend.‹ Und machte kehrt.«
Das sah ihm ähnlich. Lachend erinnerte ich mich mancher Nuss, die er den Vorgesetzten zu knacken gegeben hatte. Wir kamen dann auf meine Angelegenheiten zu sprechen. Viel war da nicht zu erzählen. Wunderlich griff nach dem Buch, über das ich zu schreiben begonnen hatte.
»Ein Revolutionsroman? Taugt er was?«
Ich schob die Schultern hoch. So schnell und kurz war auf diese Frage nicht zu antworten. Der verpatzte Ausgang der Revolution hatte auch dieses Buch in Klagen und Anklagen enden lassen. Die Arbeiter wurden beschuldigt, den Führer, den Helden des Romans, im Stich gelassen und dem Mob ausgeliefert zu haben ...
»Weißt du«, unterbrach mich mein Freund, »viel scheint der Roman nicht wert zu sein. Held der Erzählung, wenn ich das schon höre! Und – Mob, womöglich gar Janhagel ... Wir sollten uns hüten, dieses Wort in den Mund zu nehmen, wenigstens nicht so, als wollten wir es ausspucken. Schließlich wissen wir ja, welche sozialen Missstände den – Mob erst schaffen. Und was nennt man nicht alles Mob? Gehört jeder unbequeme rebellische Tollkopf, der aus der Reihe tanzt, zum Janhagel? Wer war es, der auf allen Barrikaden gekämpft hat? Wer hat in jeder Revolution sein Blut vergossen? Wer schritt zur Tat, während die anderen glaubten, schlichten zu können, wo nur die Tat entscheiden kann? Und wurde nicht die Mütze des Pariser Vorstadtpöbels die Standarte der größten Revolution? Die Sansculotten waren sicherlich keine auserlesene Gesellschaft, sie rochen nicht so gut wie die Zierpuppen der Aristokratie, aber sie legten Bresche in die Festungen des Absolutismus. Glaube mir, nichts verletzt mich mehr als die Überheblichkeit, mit der heute oft auch von Proletariern, die sich etwas über den geistigen Durchschnitt emporgearbeitet haben, über alle anderen geurteilt wird. Ich werde auch in den Versammlungen, die ich besuche, oft das Gefühl nicht los, dass sich zwischen Führer und Masse eine Entfremdung einschiebt. Manchmal kommt es mir vor, als wolle man nicht eine Versammlung mit Stellungnahme und Aussprache, sondern als wäre es eine Vorstellung der Person und der Privatsache des Herrn Referenten – Redner klingt auch schon nicht aristokratisch genug.«
Karl war in Glut geraten: »Gehört jeder aus Instinkt und Not regierungsfeindliche Arbeiter, jeder nicht mit uns marschierende Feind der herrschenden Gesellschaftsordnung zum Mob? Ich weiß, was du einwenden willst. Ich spreche nicht von dem Mob, der stiehlt und käuflich ist. Aber ich weiß auch, dass die Geschichte des Sozialismus eine Periode kennt, wo der Rote mit der Ludenmütze, dem roten Halstuch und der Schnapsflasche in der zerrissenen Rocktasche dargestellt wurde. Und diese Periode war die schlechteste nicht! Ich kenne schlechtere und du auch! Die Masse, die der Klassengegner so gern Mob nennt, um sie verächtlich zu machen, ist wahrhaft revolutionär. Sie ist bereit, anzugreifen, Opfer zu bringen ... Das ist keine Phrase, glaube es mir ...«
Er warf mir das Buch, in dem er geblättert hatte, auf den Klapptisch: »Die Dichter haben nichts erlebt. Das ist es. Das Leben schreibt die besten und die spannendsten Romane. Ich denke manchmal, ich müsste etwas von dem, was ich erlebt habe, niederschreiben. Aber ... ich weiß nicht, vielleicht würde es ein Loblied auf den – Janhagel, was meinst du?«
Ich schwieg, da ich merkte, dass er jetzt anfangen wird, zu erzählen. Er saß mir gebückt gegenüber und blickte starr auf das dick vereiste Fenster. Der Zug flog krachend über die Weichen einer Station und wiegte sich dann wieder in der brausenden Melodie. Und mein Freund begann seine Erzählung.
II. Das Schlachtenpotpourri
Wie gegenwärtig mir das alles wieder ist! Es ist mir, als höre ich die Glocke wieder, die zum Mittagessen rief. Das Portal der Vorhalle flog auf, und Heinrich, der Spaßvogel der Schule, stand mit halberhobenen Fäusten, die den Revolveranschlag markieren sollten, auf der Schwelle und brüllte: »Hände hoch!«
Ein verdammter Spaß!
Von den Hungrigen und Eiligen, die bereits vor dem Ausgabefenster der Küche standen – es war Sonntag, und das Internat der Schule erlaubte den Ausgang –, fuhren etliche herum. Gestern war Reichswehr n die Stadt eingerückt, hatte die seit Monaten leerstehende Kaserne, das Rathaus, das Ministerium, die Bahnhöfe, die Post, das Volkshaus, die Volksblattdruckerei und die Betriebe des Konsumvereins besetzt, und es war nicht ausgeschlossen, dass die Bajonette auch vor der »Eremitage« aufmarschierten, um der in dem früheren herzoglichen Parkschloss untergebrachten sozialistischen Volkshochschule für Mitteldeutschland eine Lektion über das Thema »Macht und Recht« zu geben. Zweiundvierzig Genossen waren wir. Die meisten waren seit dem Kriegsende nie wieder richtig in die Arbeit hineingekommen, und sie mussten sich das Schulgeld zusammenfechten. Viel kostete es ja nicht. Aber wir versprachen uns sehr viel von dieser Schule. Der Krieg hatte uns doch aus allem herausgebracht Mein Vater war Parteisekretär in dem Bezirk, der eigentlich diese Schule trug, und so kam ich im letzten Augenblick – ich hatte mich sehr spät gemeldet – noch in den ersten Kursus, der vier Monate dauern sollte. Er war kaum mehr als eine Pleite. Aber ich will der Reihe nach erzählen.
Ich habe sehr oft an diese Zeit gedacht. Daher erinnere ich mich genau an viele Einzelheiten. Es kann sein, dass die Erinnerung manches anders geformt hat. Aber ich halte mich an die Dinge, die ich selbst erlebt habe ...
Der über seine Narrenspossen fröhlich Grinsende, der nur zur Mahlzeit von seinem heimlichen Stadtbummel zurückgekehrt war, schob sich unter den Andrang am Ausgabefenster und klopfte mir auf die Schulter:
»Du, Wunderlich, deinen Vater haben sie verhaftet.«
Als ob das zu melden ein tolles Vergnügen wäre. Ich habe wohl ein erschrockenes Gesicht gemacht, denn dem anderen flog plötzlich das letzte Lächeln fort:
»Ja. Ich hörte es. Jetzt eben.«
Eine Weile stand ich unschlüssig. Der Atem stieß mir an die zusammengepressten Lippen. Und dann ging ich aus dem Schweigen der Gruppe durch die Halle, hinauf in die Wohnetage.
Trotz der offenen Fenster stand der Geruch von Betten im Schlafsaal. Draußen war März, die Wälder auf den Hügeln hatten noch die schweigsamen Farben des Winters, und der Fluss lag schmal in der struppigen Einfassung der Uferbäume. Auf der Landstraße ging ein einsamer Mann langsam der Ferne zu, die nicht viel mehr war als eine blasse Ahnung von schöngeschwungenen Bergen.
Es saß sich so gut an diesen Fenstern, ein Buch auf dem Sockel. Und es saß sich gut in den Lehrsälen, in den früheren Gesellschaftsräumen des kleinen und längst vergessenen Schlosses, das erst im Kriege wieder als Lazarett Dienst tat, bis es schließlich von der Revolutionsregierung als Hochschule eingerichtet wurde, in deren Schulbänke und Internat wir eingerückt waren, ein wenig lächelnd und verlegen. Noch keine zwei Monate bestand die Schule, und es waren allerhand Kinderkrankheiten durchzumachen. Die Theorie eines neuen Schulsystems verlor fast täglich eine von ihren schillernden Schwanzfedern. Schülerrat und Lehrerrat lieferten sich lebhafte Kanonaden, und alles in dem Bewusstsein, dass mit jeder eine neue Epoche der Weltgeschichte beginnt. Und manchmal schien es, als ob weder die richtigen Lehrer noch die richtigen Schüler beieinander wären.
Trotzdem stürzte das Ende der Schule – denn das bedeutete der Putsch – überraschend herein. Ich ertappte mich dabei, wie ich vor meinem Wandschrank stand und in das Durcheinander der Kleider und Geräte und meiner Gedanken starrte. Ich zog mich schnell an, schloss ab und stieg die breite Treppe hinab. Die Tür zum Lehrsaal stand offen, die große Karte für die erste Unterrichtsstunde am Montag – Geopolitik – hing bereits hinter dem Katheder, alles war menschenleer, und unten in der Halle bewegte sich das Geräusch des gemeinsamen Mittagessens.
Von einem der dicht besetzten Tische erhob sich Morgenstern, mein Nachbar auf der Schulbank:
»Du willst in die Stadt? Willst wohl mit verhaftet werden?«
»Was denn!« antwortete ich. »Mich kennt keiner. Ich habe doch noch keine Rolle gespielt.«
Ich ging dann über den knirschenden Kies des Gartenweges, durch die zum Schloss gehörige Meierei, und erst auf der Chaussee schlug ich ein lebhaftes Tempo an. Die breite, sonst so laute Straße war auffällig still. An der Endstation der Straßenbahn erfuhr ich, dass noch kein einziger Wagen gefahren wurde.
Die Stadt war noch ruhiger als sonst. Fahrzeuge schien es überhaupt nicht zu geben. Es war, als wäre die Zeit um einige Jahrzehnte zurückgedreht worden und als ob die Industrie noch nicht in diese kleinbürgerliche Residenzstadt, in diese gute Stube des früheren Herzogtums, eingebrochen wäre. Und wahrhaftig! Ein besonders tüchtiger Bäckermeister war gerade dabei, sein altes, doch sichtlich gut erhaltenes Firmenschild »Hoflieferant« wieder aufzuhängen – heute am Sonntag. Besondere Situationen rechtfertigen eben besondere Maßnahmen.
Überall war Feiertagsstimmung und ungetrübte Beschaulichkeit. Es hat nie einen Krieg und eine Revolution gegeben. Der alte Herzog saß auf seinem Schloss über der Stadt wie ein Feuerwächter. So war es, und so sollte es ewig bleiben. Gestern ein Putsch, eine gestürzte Regierung? Wer hätte gedacht, dass die Wiederherstellung gesitteter Zustände eine so spielend einfache Sache ist!
Wie von einem Spuk genarrt ging ich durch die Stadt. Alles kam mir wie Kulisse vor. Und jetzt spielte auch die Musik! Ich bog um die Marktecke und hätte fast laut gelacht. Platzmusik! Auf dem Marktplatz, am alten Simsonbrunnen, stand der Kreis der musizierenden Soldaten. Die Reichswehr hatte wohl selbst nicht damit gerechnet, dass sie innerhalb der ersten vierundzwanzig Stunden ihrer ersten weltgeschichtlichen Leistung Sonntagsmarktmusik zu stellen hätte; die Musikanten mussten erst aus der Kaserne geholt werden, weshalb das Freikonzert mit einer Stunde Verspätung begann. Umso dichter war die Zuschauermenge geworden. Alle Bürgersteige waren besetzt, die Sechzehnjährigen trugen ihre Pubertät spazieren, die hellgrünen Mützen des Gymnasiums pendelten durch das Spalier der sonntäglichen Trachtenschau, ganz nahe um die Musikanten standen die Liebhaber des lauten Schalles, und der schneidige Dirigent tat ihnen den Gefallen: aus dem fröhlich glänzenden Metall holte er mit Eleganz Schlachtgebraus und Donnerhall.
Ein Drahtverhau aus durcheinandergeworfenen spanischen Reitern grenzte einen schmalen Streifen vor dem Rathaus ab. Zwei Maschinengewehre standen dahinter, den Patronengurt im Gebiss. Aber die Bedienungsmannschaften plauderten über den Drahtzaun herüber mit unternehmungslustigen Mädchen und ließen sich von einigen Fabrikantensöhnen, die an diesem Tage ihre Leutnantsuniformen wieder ausgepackt hatten, Zigaretten schenken und spendeten den wiederauferstandenen Offizieren und Rittern des Eisernen Kreuzes mindestens erster Klasse dafür das lang entbehrte Vergnügen, mit zusammengeschlagenen Stiefelabsätzen gegrüßt zu werden.
»Mensch, was machst denn du hier?«
Ein Genosse aus der Partei, ein Hilfsarbeiter aus der Volksblattdruckerei, schaute um sich, als ob ein Dutzend Spitzel in der Nähe wäre.
»Du willst dich wohl auch wegschnappen lassen?«
Ich wehrte ab und fragte, ob denn nichts unternommen würde. Er zuckte die Achseln und winkte mit dem Kopfe nach der Gruppe der neu aufgebügelten Offiziere hinüber:
»Der Lange dort, Meschke junior, feine Marke, war draußen mein Kompanieführer, schiss in die Hosen bei jeder Granate, auch wenn es eine von uns war. Und jetzt ... sowas von Heldentum! – Was meinste? Morgen? Generalstreik oder so. Wird nicht viel werden. Mit unseren Proleten hier kannste doch sowieso keinen Blumentopp gewinnen.«
Rauschend erhob sich die Musik. Das Schlachtenpotpourri erreichte seine größte Klangfülle. Walküren und der alte Blücher, Lützows wilde verwegene Jagd und alle Schlachtengötter der deutschen Geschichte vereinigten sich zu einer schmetternden Attacke, und dann riss der Kapellmeister die Kurve herum zum »Niederländischen Dankgebet«. Ich sehe ihn noch, wie er, im Finale schwelgend, hinaufblickte nach der Rathausuhr, die mit gleichgültiger Ruhe die erste Stunde des Nachmittags anzeigte und ihm mit ihren dumpfen Schlägen die letzte musikalische Szene umschmiss ...
Auch in den Arbeitervierteln schlief die sonntägliche Langeweile. Der langsam hin und her gehende Posten am Haupteingang des ausgestorbenen Volkshauses trug sein Gewehr lässig über die Schulter gehängt. Er machte den Eindruck eines Mannes, der soeben gut gegessen hat und nun froh ist, sich etwas Bewegung verschaffen zu können. Im Zustand der Verdauung denkt niemand an Feindseligkeiten.
Verzweifelt und verwirrt stieg ich die Treppen zur Wohnung meiner Eltern hinan. Die blankgescheuerten Steinstufen waren von vielen Stiefeln beschmutzt, und das Schild an der Tür war zerbrochen. Die kleinen Porzellanbrocken lagen auf der Schwelle.
Meine Mutter öffnete mir. Ihr Gesicht war etwas blasser und straffer als sonst, und ich fragte rasch:
»Der Vater? Verhaftet?«
Ein seltsames Licht trat in die Augen meiner Mutter:
»Noch nicht.«
Fünf Minuten vor dem Eintreffen der Sölden war der Vater gegangen. Die Kerle hatten die Wohnung durchsucht, hatten ein altes Bild – eine symbolisch aufgeputzte Freiheitsgöttin neben einem Amboss und vor einer volksumjubelten großartig aufgehenden Sonne – mit einem Kolbenhieb zerstört, das war alles.
Ich musste lachen. Das Bild hatte mich schon immer gestört.
Erst sollte ich es nicht erfahren, wo mein Vater Zuflucht gesucht hatte. Aber nach einer halben Stunde klopfte ich an die Tür eines Genossen, der in der inneren Stadt wohnt. Erschrockene Gesichter missbilligten meinen Auftritt.
Mein Vater blickte groß auf. Sein Antlitz war beherrscht, nur die Augen brannten. Ich erfuhr, dass es sehr einfach war, sich zu verstecken. Kein Mensch hielt ihn auf. Die Soldaten waren sämtlich ortsfremd.
»Wie sieht es in der Stadt aus?«
»Platzmusik und Spaziergänger«, schimpfte ich los. »Nicht einmal die Ruhe vor dem Sturm, eher die Ruhe nach dem Essen.«
»Es ist eben Sonntag«, gab er mir zur Antwort und ließ eine Bemerkung fallen, dass morgen wohl mehr los wäre. Ich erfuhr aber nichts weiter. Als ich mich aufregte: »Wenn wir nur wollten! Diese Suppengarde! Ob von denen einer im Felde war? Du müsstest bloß sehen, wie die ihre Maschinengewehre aufgestellt haben«, zog mich mein Vater zu sich hin, und ich musste ihm versprechen, »keine Geschichten« zu machen und wieder in die Schule zu gehen.
Dann war ich wieder draußen. Die Straße hatte sich belebt. Spaziergänger gingen die Soldaten angucken. Aber der vor einer Stunde noch so friedliche Marktplatz sah jetzt anders aus. Die Neugierigen drängten sich an den Ecken der Zugangsstraßen. Der Platz war leergefegt. Maschinengewehre kauerten sprungbereit. Posten standen in ihren Mänteln steif und klumpig unter dem schlechtsitzenden Stahlhelm. Mitten in der Marktstraße war ein Pfahl ins Pflaster gerammt, der herausgenommene Stein lag noch daneben, und der Pfahl trug eine schief beschriebene Pappe:
»Wer weitergeht, wird erschossen!«
»Du, was ist denn da auf einmal los?« Mir ist es, als höre ich die aufgeregte und doch halb amüsierte Stimme im Zuschauerspalier jetzt noch. »Das sieht ja aus, als ob es noch etwas gibt.«
»Klar.« Die antwortende Stimme konstatierte das mit ruhiger Bestimmtheit. »Dicke Luft!«
III. Schnecken
Die erste Unterrichtsstunde der Woche war vorüber. Es war eine verrückte Stunde. Ein Lehrer, der wie ein aufgezogener Kreisel um das Katheder tanzte, und eine Klasse, die vor sich hinstarrte und darauf wartete, dass einer aufstand und losschrie: Das ist doch Unfug, dass wir hier sitzen und so tun, als ob wir auf dem Mond wären!
Aber es schrie keiner los. Eine Schulordnung bleibt bestehen, und wenn die Welt einstürzt. Fenster öffnen, aus den Bänken heraustreten, der Vorturner der Klasse übernimmt das Kommando, Atemübungen! So, und nun kann die zweite Stunde beginnen. Es war Viertel nach neun Uhr. Dr. Schilling betrat den Lehrsaal.