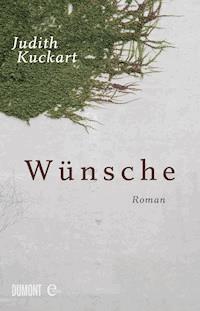10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rieke studiert Theologie und bereitet sich bei Sorgentelefon e. V. auf die Gemeindearbeit vor. Wanda sammelt für ein DDR-Museum Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden: »Das Gestern will im Heute nicht aufhören zu sprechen.« Für Matthias, der auf dem Bau arbeitet, ist das Dasein an sich eine rätselhafte Aufgabe: Während der Ausbildung bei Sorgentelefon e. V. hat er die schöne Emilia kennengelernt. Die traurige Buchhalterin Marianne, der pensionierte Redakteur Lorentz und die 80-jährige heitere Ich-Erzählerin von Schrey, die nicht weiß, ob sie eine verhinderte Pianistin oder eine verhinderte Terroristin ist, gehören ebenfalls in die Sorgentelefon-Gruppe. Alle sieben – so unterschiedlich ihre Leben verliefen – erfahren, dass Zuhören den Anrufenden in einer schlaflosen Nacht das Gefühl von Ausweglosigkeit nehmen kann – und mit dem Zuhören auch eigene Lebenserfahrungen einen unerwarteten Sinn bekommen. Ein unsichtbares Netz zwischen Rand und Mitte der Gesellschaft entsteht, das Lebensgeschichten aus dem Dunkel des Unerzählten fischt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rieke studiert Theologie und bereitet sich bei Sorgentelefon e.V. auf die Gemeindearbeit vor. Wanda sammelt für ein DDR-Museum Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden: »Das Gestern will im Heute nicht aufhören zu sprechen.« Für Matthias, der auf dem Bau arbeitet, ist das Dasein an sich eine rätselhafte Aufgabe: Während der Ausbildung bei Sorgentelefon e.V. hat er die schöne Emilia kennengelernt. Die traurige Buchhalterin Marianne, der pensionierte Redakteur Lorentz und die 80-jährige heitere Ich-Erzählerin von Schrey, die nicht weiß, ob sie eine verhinderte Pianistin oder eine verhinderte Terroristin ist, gehören ebenfalls in die Sorgentelefon-Gruppe. Alle sieben – so unterschiedlich ihre Leben verliefen – erfahren, dass Zuhören den Anrufenden in einer schlaflosen Nacht das Gefühl von Ausweglosigkeit nehmen kann – und mit dem Zuhören auch eigene Lebenserfahrungen einen unerwarteten Sinn bekommen. Ein unsichtbares Netz zwischen Rand und Mitte der Gesellschaft entsteht, das Lebensgeschichten aus dem Dunkel des Unerzählten fischt.
© Burkhard Peter
Judith Kuckart, geboren 1959 in Schwelm (Westfalen), lebt als Schriftstellerin und Regisseurin in Berlin. Sie veröffentlichte bei DuMont den Roman ›Lenas Liebe‹ (2002), der 2012 verfilmt wurde, den Erzählband ›Die Autorenwitwe‹ (2003), die Neuausgabe ihres Romans ›Der Bibliothekar‹ (2004) sowie die Romane ›Kaiserstraße‹ (2006), ›Die Verdächtige‹ (2008), ›Wünsche‹ (2013), ›Dass man durch Belgien muss auf dem Weg zum Glück‹ (2015) und ›Kein Sturm, nur Wetter‹ (2019). Judith Kuckart wurde mit zahlreichen Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet.
www.judithkuckart.de
Judith Kuckart
Café der Unsichtbaren
Roman
Von Judith Kuckart sind bei DuMont außerdem erschienen:
Der Bibliothekar
Lenas Liebe
Die Autorenwitwe
Dorfschönheit
Kaiserstraße
Die Verdächtige
Wünsche
Dass man durch Belgien muss auf dem Weg zum Glück
Kein Sturm, nur Wetter
eBook 2022
© 2022 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Magdalena Russocka / Trevillion Images
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7136-0
www.dumont-buchverlag.de
GRÜNDONNERSTAG
Die Wohnung, in der er ab jetzt wohnen würde, hatte er über eine befreundete Maklerin bekommen. Sie war leer. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Bett, aber Raufasertapete. Daran änderte sich auch nichts, als er mit Rad, Helm, Rucksack und drei Plastiktüten einzog.
Bleibst du heute allein hier?, fragte die Maklerin.
Ja.
Wie willst du denn die Nacht verbringen?
Ich habe einen Schlafsack und einen Wasserkocher dabei.
Wenn du willst, kannst du mit zu mir kommen.
Nein.
Die Maklerin ging kurz nach acht. Sie war so alt wie er, also zu alt für ihn. Er rollte seinen Schlafsack aus, legte sich hin und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Seit Jahren arbeitete er auf Baustellen, schaffte schweres Material von da nach dort oder ganz fort. Er war stiller als die Kollegen und redete nicht gern über Frauen oder Politik. Er rauchte auch nicht. In den Pausen saß er meistens allein. Im Sommer verlieh er manchmal seine Sonnencreme. Er war nicht klüger als die anderen, nur trauriger.
Matthias’ Großvater hatte mit seinen zwei Brüdern ein kleines Bauunternehmen gegründet. Sechs Tage die Woche hatten sie bei jedem Wetter mit Schaufeln Putz an die Wände von neuen und alten Häusern geschmissen und dabei weiße Unterhemden getragen, mal mit, mal ohne was drüber. Meistens standen sie auf ihrem Gerüst im Freien, nur manchmal fertigten sie in der Werkstatt unten im Haus, das ihnen nicht gehörte, eine Deckenrosette für das Wohnzimmer einer Kinobesitzerin oder Ballettlehrerin an. Sie bekamen Kinder, eins davon war sein Vater gewesen, der früh starb. Matthias hatte das Sterbezimmer, kaum dass der Tote hinausgetragen worden war, mit einer selbst gebastelten Lochbildkamera fotografiert. Sah man einem Zimmer an, dass dort soeben jemand gestorben war? Auf den fünf Bildern, die er so machte, waren weiße Schatten und Geister zu sehen gewesen, wegen der langen Belichtungszeiten.
Matthias schlief auf seinem Schlafsack ein.
Später klingelte Emilia. Sie ging durch den leeren Raum, der danach anders aussah. Sie stellte sich ans Fenster, um an den Farbspuren herumzuknibbeln, die beim letzten Anstrich auf die Scheibe geraten waren. Sie stand da, als würde sie eigenen Erinnerungen an seine neue Wohnung nachhängen. Er trat hinter sie, drehte sie zu sich und hob sie auf das Fensterbrett. Als er über ihre Schulter nach draußen schaute, fiel ihm eine ebenfalls leere Wohnung in einem alten Film ein. Vor den Fenstern dort hatte Paris gelegen. Innen war die Leere des Zimmers geteilt gewesen in Orange und ein Anthrazit, das verdunstete. In diesem Setting vom Letzten Tango hatten ein Mann und eine Frau einander berührt, hatte er sich wüst an ihr vergriffen. Als der Film ins Kino kam, war Emilia noch nicht geboren und Matthias – gerade mal fünf – der unberechenbaren Liebe seiner Mutter ausgesetzt gewesen. Zwanzig Jahre später hatte er in einer Spätvorstellung den Letzten Tango neben einer Frau angeschaut, die beim Kauf der Eintrittskarte dicht vor ihm in der Schlange gestanden hatte. Gemeinsam verließen sie das Kino vor dem Ende des Films und waren danach eine Zeit lang zusammen, bis sie aufgehört hatte, für zwei zu kochen.
Warum bist du hier, Emilia?, fragte Matthias eine halbe Stunde später. Sie saßen auf seinem Schlafsack. Schön kam sie ihm vor, vor allem im Profil. Ihre Wimpern waren lang und schwarz und hart wie Fliegenbeine. In der Ferne fuhr die S-Bahn vorbei. Magst du leere Wohnungen mit Mann?
Emilia umkreiste mit einer Hand sein linkes Knie, das nach einem Arbeitsunfall wie ein dickes, unförmiges Gesicht aussah und traurig zu ihnen aufschaute.
Ich bin wegen dieses Oh-ohh von neulich hier, sagte sie.
Wie bitte?
Du hast mich angeschaut und gesagt: Oh-ohh, Emilia, genauso habe ich auch vor vielen Jahren dagesessen und geredet.
Du bist hier, nur weil ich Oh-ohh gesagt habe?
Ja, es war so zärtlich, und es war so gleichgültig.
Eigentlich hätte sie lieber was mit Katzen und Kindern gemacht statt mit Geld, hatte Emilia bei dem ersten Treffen gesagt, bei dem sich jeder einzeln allen anderen im Stuhlkreis vorgestellt hatte. Das war vor über vier Jahren gewesen. Oh-ohh, hatte er bereits damals gedacht, als sie an dem Samstagvormittag einer Gruppe von Fremden so verlegen aus ihrem Leben erzählte, um sich am Ende des Tages selbstsicher ans Steuer eines teuren schwarzen Autos zu setzen.
Gehört meinem Chef! Sieben davon hat er in seiner Tiefgarage, sagte sie, alle mit der gleichen glitzernden Wunderdeko am Innenspiegel und Heiligenbildchen über den Lüftungsschlitzen – ja, woran der wohl glaubt, weiß ich auch nicht.
Sie hatte gelacht, sie lachte immer, wenn sie etwas erklärte.
In guter Stimmung war Matthias an jenem Februarsamstag zum ersten Treffen des Stuhlkreises gegangen. Auf dem Weg von der U-Bahn zum Haus neben der Kirche war er an Spätis, Imbissen und einem Sozialkaufhaus vorbeigekommen, das auf zwei Ständern vor der Tür Trachtenmode verkaufte. Einen Moment lang schaute er sich im Nieselregen dicke Strickjacken mit Norwegermuster an. Auch ohne sie zu berühren, wusste er, sie kratzten. An jenem Februarwochenende, das für immer nach nasser Wolle riechen würde, hatte er offen und gern von sich und seiner Mutter erzählt: Sie hat mich regelmäßig um den Tisch gejagt, bevor sie mich verprügelte, Tatsache, mit einem Absatzschuh in der Hand hat sie mich vor sich hergetrieben – und so ist dann alles gekommen.
Matthias’ Blick in die Runde war an Emilia hängen geblieben.
Bist du danach Schuhfetischist geworden?, wollte sie wissen.
Alle lachten, auch er. So ein Stuhlkreis kann auch ein Zuhause sein, hatte er damals gedacht.
Gegen drei stand er in seiner leeren Wohnung noch einmal auf. Statt einer Flasche Bier öffnete er das Fenster. Zu seinem sechsten Geburtstag vor neununddreißig Jahren hatte er sich ein Gewehr gewünscht. Nein, sagte die Mutter und schlug ein Fahrrad vor. Man einigte sich auf eine Gitarre, so wie beim kleinen Elvis Presley. Woher kam der Gedanke jetzt, und wer brauchte den? Zusammengerollt wie ein Hase im Schnee schlief er wenige Minuten später wieder ein, während draußen bei den S-Bahn-Gleisen einer von diesen nachtaktiven Vögeln sang.
Nein, Sie stören nicht, gar nicht, dafür sitze ich ja hier am Telefon, sagte Rieke, während auch bei ihr eine Nachtigall sang, aber vor einem anderen Fenster und in einem östlicheren Teil von Berlin. Es sang folglich eine andere Nachtigall als die bei Matthias, doch war es hier wie dort die Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag.
Mögen Sie nicht einfach erzählen, was los ist?
Sie sind sehr freundlich, danke.
Da nicht für, sagte Rieke in Dienstzimmer 2.
Es ist ganz schwer auszusprechen. Ihre Kollegen haben gesagt, ich soll anrufen, wenn es wieder losgeht.
Was geht los?
Ich bin pädophil.
Pädophil schrieb Rieke mit ratlosen Großbuchstaben in ihr rosa Heft und glaubte, draußen auf dem Flur ein Geräusch gehört zu haben. Ganz still war es plötzlich an beiden Enden der Leitung geworden. Es war eine Stille, die sie hören konnte, bis der Anrufer sanft fragte: Wollen Sie jetzt noch mit mir sprechen?
Aber ja, sicher.
Kennen Sie mich nicht? Ich habe schon oft angerufen. Ihre Kolleginnen kennen mich, und Sie sind wohl neu?
Das ist doch egal, oder?
Aber Sie sind jung.
Auch das ist egal.
Aber es ist so schwer.
Weil ich so jung bin?
Wieder wurde es still, bis Rieke leise sagte: Hallo, sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da und hoffe, ich störe wirklich nicht, denn ich habe so oft schon angerufen, deswegen müssten Sie mich eigentlich kennen. Der Drang wird seit zwei Tagen wieder größer.
Rieke schaute auf das Plakat dem Schreibtisch gegenüber. Darauf gab sich eine Herbstlandschaft einem Sonnenuntergang hin, der tröstlich sein sollte.
Eine Ihrer Kolleginnen, sagte der Anrufer, hat einen Zettel an den Bildschirm geheftet, der Ratschläge gibt, wie man mit mir reden soll, wenn ich mich wieder melde. Der Stimme nach ist diese Kollegin eine sehr alte Dame. Kann nur von Schrey gewesen sein, dachte Rieke. Von Schrey war bald achtzig und bekannt für ihre gelben Klebezettel. ACHTUNG! HEUTE WIEDER DER TRAURIGE GÄRTNER! Oder: VORSICHT, DER OPERETTENLIEBHABER! Oder: WIEDERHOLT IN DER NACHTSCHICHT VON SAMSTAG AUF SONNTAG: DER SCHAUSPIELER MIT DER PLASTIKTÜTE. Die kryptischen Nachrichten der von Schrey klebten regelmäßig am Bildschirmrahmen und gaben Tipps für den Umgang mit Daueranrufern, die von Erschöpfung, Aufgewühltsein, Hoffnungslosigkeit oder einer Plastiktüte reden wollten, die sie sich im Lauf der Nacht über den Kopf ziehen würden. Bei Riekes erstem Nachtdienst hatte die Kollegin von Schrey neben ihr gesessen.
Nicht schlecht, gar nicht schlecht für den Anfang, Kind, hatte sie gesagt, als Rieke nach vier Stunden und fünf Anrufern ein letztes Mal auflegte. Was einmal von dieser Frau übrig bleiben würde?
Mir – ihr Lächeln, dachte Rieke, während jetzt der Anrufer am anderen Ende der Leitung sich räusperte: Wissen Sie, dass das eine Krankheit ist?
Ja, sagte Rieke.
Das bleibt bis zu meinem Tod so, wussten Sie das auch?
Waren Sie schon beim Arzt?
Ich hatte einen Arzt in einem großen Hospital, wo es auch einen schönen Park gab, und der verstand mich. Verstehen Sie mich auch?
Wo ist er jetzt, der Arzt?
Tot.
Ach, sagte Rieke, das tut mir leid.
Mir auch.
Aber das Klinikum gibt es doch noch, oder? Dort werden Sie jemand anderen finden, zu dem Sie gehen können.
Aber wenn man sich nicht kennt …
Wen kennt man schon?, sagte Rieke. Sie hätte schreien, sie hätte singen mögen, aber fragte stattdessen: Was ist denn jetzt mit dem Klinikum? Es ist doch eine Krankheit, das sagten Sie selber, und wenn einer Krebs hat, hat er auch ein Anrecht auf Hilfe.
Richtig, ich muss dringend mit jemandem sprechen.
Ich höre Ihnen zu.
Wieder folgte Schweigen, folgte eine gespannte Stille, die sich mehr und mehr auf einen möglichen Sinn hin ausbreitete, ohne deswegen zugänglicher zu werden. Rieke wurde das Gefühl nicht los, sie säße ziemlich harmlos und blöd am Telefon, mit gespitzten Ohren, deren Ränder sich vor Anstrengung oder Scham langsam rosa einfärbten.
Hallo, fragte sie leise, sind Sie noch da?
Ja, haben Sie vielen Dank und eine gute Nacht Ihnen, flüsterte der Anrufer.
Geht es jetzt besser?
Ja.
Dann schlafen Sie gut.
Sie auch, erwiderte der Mann am anderen Ende der Leitung, und hoffentlich bleiben Sie so nett. Man weiß ja nie, wer heute noch anruft.
Das Gespräch hatte keine zehn Minuten gedauert, und drei Stunden Dienst blieben für Rieke noch. An dessen Ende würde sie in diesen Bus um 3.03Uhr steigen, der an der nächsten Straßenecke abfuhr. Während er an seinem Perlenarmband spielte, hatte der Psycho-Ausbilder beim Sorgentelefon gleich zu Anfang vorausgesagt: Vor allem die Nächte sind so, Leute, es gibt nichts, warum die Menschen nicht anrufen!
Rieke stand auf und öffnete in Dienstzimmer 2, zweiter Stock Hinterhaus, beide Fensterflügel. Vielleicht würde so überraschend eine gute Nachricht eintreffen – oder ein lieber Besuch? Sie schaute zum Vorderhaus. Nur ein einzelnes Fenster im Stock gegenüber war erleuchtet. Mit hängenden Armen stand dort ein junger Mann im hässlichen Streulicht seiner Deckenlampe. Jetzt schaute er zu ihr, und kurz dachte sie, er winkt. Aber das tat er nicht. Er war einfach nur – so wie sie – allein. Anfang des Jahres hatte sie ihn dort mit diesem amerikanischen Kühlschrank einziehen sehen, der seitdem wie ein unhandlicher Freund oder wie ein riesiger weißer Hase neben ihm stand. Ein Hase, an den er sich manchmal anlehnte, wenn er aus dem Fenster blickte und nichts an ihm verriet, was er eigentlich sah. Manchmal telefonierte er auch dort drüben, wenn sie telefonierte, und einige Male hatte auch er gelacht, wenn sie gerade lachte. Also waren sie doch miteinander verbunden, ohne wirklich verbunden zu sein? Was für einen Eindruck sie wohl von dort drüben aus betrachtet machte? Den eines Mädchens, das einmal Frau und am Ende hauptamtliche Geschäftsführerin hier bei Sorgentelefon e.V. werden würde, obgleich sie immer von einer Stelle als Pfarrerin mit altem Haus und altem Birnbaum dazu geträumt hatte, das mit seiner karminroten Fassade und einer Familie dahinter sehr eigenständig im Schatten einer Kirche stand?
Sie würde heiraten?
Nein, würde sie nicht.
Keine drei Stunden später packte sie ihr rosa Heft in den Rucksack und löschte das Licht am Schreibtisch. Ob jemand – wenn auch verspätet – für die Schicht von 3.00Uhr bis 7.00Uhr kam, hatte sie im Dienstplan nicht nachgeschaut. Sie ließ die zwei Neonröhren im Flur brennen und rannte die Treppe hinunter, während sie sich eine blaue Arbeitsjacke um die Hüften knotete. An ein Haus musste sie dabei denken in jener Straße am Stadtrand, in der sie mit Mutter und Bruder gewohnt hatte, nachdem der Vater, der Herr Pfarrer, mit seiner Gemeindehelferin durchgebrannt war. Hinter dem Haus floss ein Kanal. Die Bäume an seinen Ufern sahen bei hohem Wasser wie Damen aus, die ihre Röcke raffen. Das Haus, nur wenige Schritte vom Wasser entfernt, war feucht gewesen, wie alle Häuser dort. Putz bröckelte von den Außenwänden. Die Scheiben waren zerbrochen und einige Fenster mit Pappe verklebt. Im Garten stand ein Nussbaum, Metallrohre lagen herum. Dazwischen wuchs, was wollte, auch Rhabarber, und ganz hinten beim Zaun ein Johannisbeerstrauch. In dem Haus wohnte als Nachbar ein Mann, den man nie sah. Nur einmal hatte Rieke ihn beim Briefkasten getroffen, in Trainingshosen und einem karierten Hemd, das über dem Bauch spannte. In der Nacht darauf träumte sie, er hätte sich zu ihr umgedreht, hätte lange Wimpern gehabt, die schrumpeligen Lider eines Elefanten und auch diesen klugen, flehenden Tierblick. Sie solle ihn küssen, hatte er gesagt. Küssen!, wiederholte Rieke jetzt und ließ die letzten vier Treppenstufen im Sprung hinter sich. Kurz vor drei: Etwas an diesem Moment oder der plötzlichen Bewegung kam ihr vertraut vor. Genauso war es schon einmal gewesen. Nichts hörte auf, wenn es vorbei war. Eine Sache erlebte man nicht nur einmal. Man erlebte die Dinge, wenn sie geschahen, und jedes Mal, wenn einen etwas daran erinnerte, erlebte man sie wieder. Der Elefantenmann in Trainingshosen damals und dieser Sprung auf einer nächtlichen Hinterhaustreppe jetzt sollten etwas miteinander zu tun haben? Alles hing mit allem zusammen? Das glaubt dir doch kein Mensch, Rieke, sagte sich Rieke und griff nach den geknoteten Ärmeln der blauen Arbeitsjacke vor ihrem Bauch. Die hatte ihre Mutter mit siebzehn von einem Dorfmarkt in Frankreich mitgebracht, um ihren langen Lavendelsommer in einen drohenden deutschen Herbst hinüberzuretten. Mein Gott! Rieke zog die kleine Tür zum Hinterhof auf. Jetzt wollte auch diese alte Jacke aus dem Jahr 77 mit der seltsam flirrenden Nacht da draußen vor der Tür etwas zu tun haben.
Gleich nach dem höflichen Pädophilen hatte eine bittere Betti angerufen, ihren Namen mehrfach genannt und ihre Arbeitslosigkeit, Armut, Schlaflosigkeit sowie eine drohende Obdachlosigkeit am Telefon entfaltet und wieder neu gefaltet, ohne dass Rieke eine Lösung eingefallen wäre. Aber eine Beziehung hatten sie zueinander gehabt, Betti und sie, für eine knappe halbe Stunde. Rieke hatte gelauscht, nicht einfach nur zugehört. Sie hatte wie in Bettis Mundhöhle gesessen. Soll ich wohl nach Köln zurückziehen, solange ich noch ganz schick bin?, hatte die alte Kölnerin nach Betti wissen wollen. Die Frage klang, als sei die Entscheidung längst gefallen. Kurz war das Gespräch gewesen, in dem Rieke ständig wiederholt hatte: Nur zu, nur zu, tun Sie, was Ihre innere Stimme Ihnen sagt!
Jetzt lief Rieke durch den Hinterhof und schaute hoch zur zweiten Etage des Vorderhauses, wo unter hässlichem Streulicht der Kühlschrank allein in der Küche stand. Mein Gott, manche Dienste waren öde wie dieses Licht da oben. Andere gaben Einblicke in Welten, in denen sie nie sein würde, oder in Leben, die sie nie würde führen mögen. Ich komme einfach nicht raus aus diesem Gefühl der Gefühllosigkeit, wiederholte an manchen Tagen ein Anrufer nach dem nächsten, sodass Rieke versucht war, allen eine gemeinschaftliche Sammelklage vorzuschlagen. Denn dieser chronische Kummer konnte nicht nur mit den Anrufenden zusammenhängen. Wer sonst war noch schuld? Irgendjemanden musste es geben, der all diese Unglücklichen in den gleichen Regenmantel gesteckt hatte, an dem das Leben so schmerzlich abperlte. War das so? War diese Gesellschaft so? Ein Tusch! Dhada-tata! Kurz vor Dienstschluss hatte sich noch ein Daueranrufer gemeldet, mit genau diesem Dhada-tata. Unser Operettenliebhaber nannten ihn alle. Wahrscheinlich lebte er in einem Nest, in dem es nur Kopfsteinpflaster und nicht einmal eine Bäckerei gab.
Hey, ich will Ihnen mal wieder was erzählen.
Ganz Ohr!
Das Ende meiner Ausbildung, junge Frau, fiel mit dem Ende dessen zusammen, wofür ich ausgebildet worden bin.
Was war das genau?
Stellmacher. Wissen Sie, was das ist? Sind Sie eigentlich aus dem Osten oder aus dem Westen, junge Frau?
Norden, hatte Rieke geantwortet, ich bin aus dem Norden.
Norden, so wie ich? Das hätte ich nicht gedacht. Sind Sie dann auch mit einer Schwalbe zur Arbeit gefahren? Das hat bei uns sogar der Bürgermeister gemacht. Wissen Sie überhaupt, was eine Schwalbe ist?
Ich weiß, was eine Schwalbe und auch was ein Bürgermeister ist. Aber wissen Sie, ob Sie heute Nacht die richtige Nummer gewählt haben?
Wieso?
Das hier ist keine Quizsendung.
Stimmung!, hatte da der ehemalige Stellmacher aus seinem Nest irgendwo im Norden gerufen, Stimmung, es muss getanzt werden!
Keine Viertelstunde später hatte er ihr mit chronischer Begeisterungsfähigkeit alles über den letzten Operettenbesuch in der Stadthalle des Nachbarorts erzählt und die Habanera angestimmt: Dhada-tata-dhadhadah-tata-dhadhadah-tata-dhadhadhatha … – mit dem Bus bin ich hin, tata!
Carmen ist aber keine Operette, hatte Rieke gesagt und gedacht, dass eigentlich alles, was sie während ihrer Dienste hörte, vertont werden müsste. So bekämen diese Geschichten am Ende einen musikalischen Sinn, so wie auch die schlimmsten Katastrophen beim Erzählen einen Sinn bekamen.
Rieke lief an den vier Parkplätzen im Hinterhof vorbei, von denen zwei für Sorgentelefon e.V. reserviert waren. Auf einem stand eine schmuddelige, senffarbene Couchgarnitur aus Cord. Die drei anderen waren leer, leer wie ihr Leben damals, am Ende jener Phase, in der sie sich an Schauspielschulen beworben hatte, bis sie nach dem sechsten Vorsprechen aufgab. Auch das nur eine Phase, Hase, hatte sie sich später gesagt, nachdem sie die letzte Absage verdaut und so offensichtlich kein echtes Talent hatte oder nur das eines Holzpferds.
Also studierte sie jetzt Theologie.
Vor dem Durchgang zum automatischen Tor, das auf eine nächtliche Straße führte, schaute sie noch einmal hoch zum Kühlschrank im zweiten Stock. Dort, im Fenster, brannte kein Licht mehr, aber eine einzelne zerfetzte Wolke zog am Himmel entlang, zog unerhört weit oben und Lichtjahre entfernt vorbei, diese Wolke. Sie sagte, hör zu Rieke, deine Zukunft existiert bereits, und deine Vergangenheit ist noch da. Nichts verschwindet, nichts. Die Dinge passieren nicht nacheinander und auch nicht zufällig, Rieke, die Dinge hätten nicht anders laufen können, auch die traurige Sache mit der Schauspielschule nicht. Die Dinge, Rieke, sind gefüllt mit Ereignissen, die unabänderlich und also Gott sind. Rieke griff in ihren Rucksack, um sicher zu sein, ihr rosa Heft dabeizuhaben. Es war eine alltägliche, nervöse Geste, die sie von sich kannte, doch jetzt kam sie ihr fremd vor, so als hätte irgendwer da oben aus dem nächtlichen Himmel nach dem Grund ihrer Geburt gefragt, und sie da unten im Hinterhof suchte nach der Antwort in einem Rucksack.
Die Nacht draußen auf der Straße war mild und der Mond rund. In den verwaisten Gängen des Getränkemarkts rechts vom automatischen Tor brannte blaues Notlicht. Zwei kleine Gabelstapler tanzten dort während der Öffnungszeiten zwischen den Regalen, aber nie ein Mensch. Rieke durchquerte die Durchfahrt und stemmte das Tor zur Straße auf. Der Nachtbus war noch nicht in Sicht und auch sonst kein Verkehr. Aber auf dem Mittelstreifen zwischen den Fahrbahnen, wo mehrere Autos unter der Hochbahn parkten, stand jemand, ließ ein Streichholz aufflammen und neigte den Kopf, um seine Zigarette anzuzünden. Er trug eine Kapuze und war deswegen zu dieser Stunde alterslos, solange er sich kaum bewegte. Die Flamme grub ein rotes Loch in die Dunkelheit.
Moin, sagte Rieke laut, ohne zu wissen, warum.
Der Stimme nach kam die Antwort von einem jungen Mann.
Vier Jahre zuvor
Eine Emilia, die neben mir saß und beim Sprechen ein Bonbon von der einen Backe in die andere schob, eine Rieke in räudiger Trachtenjacke mit Norwegermuster, ein Matthias, der sein Knie massierte, weil es offenbar schmerzte, und das Perlenarmband des Ausbildungsleiters waren mir in jenem Stuhlkreis vor vier Jahren als Erstes aufgefallen. Ein Stuhl war noch frei gewesen. Ich war eindeutig die Älteste in der Runde, die an jenem verregneten Februarsamstag die Ausbildung bei Sorgentelefon e.V. begonnen und sich von Anfang an geduzt hatten. Gerade, als ich mich vorstellen und meinen Namen von Schrey deutlicher wiederholen wollte, betrat eine Person den Raum. Da stand sie. Die anderen saßen. Sie war zu spät gekommen und hatte ein Katzengesicht.
Wie lange dauern eigentlich die Nachtdienste?, fragte ich, während sie zu dem freien Stuhl ging.
Meine Frage war wie aus der Luft gegriffen, aber die Antwort wichtig. Ich leide an Schlaflosigkeit und suchte damals schon nach einer Aufgabe, die meinen Nächten den Abgrund nehmen und eine Tiefe geben.
Früher waren es acht, jetzt sind es zweimal vier Stunden Nachtschicht, sagte der Ausbilder, während die Frau mit dem Katzengesicht einen feuchten Wintermantel über die Rückenlehne ihres Stuhls hängte. Sie hieß Wanda, erfuhr ich später. Der Ausbildungsleiter war mittlerweile aufgestanden und schrieb etwas, das wie eine Regel klang, an eine Wandtafel aus dem letzten Jahrtausend. Als er sich wieder umdrehte, sah er an Wanda vorbei zur Tür, die sie hatte offen stehen lassen.
Vergangenes Jahr, sagte er, hatten wir eine Frau im Team, die meldete sich während der Nachtschichten regelmäßig für eine Stunde ab. Als wir nachfragten, meinte sie: Ich muss auf meine Gesundheit achten, ich muss zwischendurch mal kurz schlafen. Wer, fragte der Ausbilder und sah weg von der Tür und zurück zur Runde, wer kann wissen, wie viele Menschen in genau der Stunde angerufen und schließlich die Warteschleife verlassen haben, um sich umzubringen?
Nur Gott, nur Gott kann dies wissen, der liebe Gott, sagte die Emilia neben mir und bückte sich nach dem Becher mit dem Logo Sorgentelefon unter ihrem Stuhl.
Übrigens, beten hilft!
Es folgte ein Augenaufschlag, der war blau, so blau. Ich konnte die Augen dieser Frau hören. In ein paar Wochen würde genau diese Emilia beim Thema Selbstmord lachend in die Runde schauen und versichern, also damit habe sie gar nichts am Hut, doch beneide sie manchmal die, die tot seien. Auf den ersten Blick war sie ein Mädchen, auf den zweiten eine Irritation und auf den dritten eine Frau um die vierzig. In ihrem Dekolleté wohnten die Brüste dicht beieinander. Der Querbalken eines Strasskreuzes bohrte sich ins weiche, weiße Fleisch.
Beten! Gott, du kannst tatsächlich beten? Wanda fuhr sich mit der Hand ins Katzengesicht.
Du etwa nicht, wo kommst du denn her, etwa aus dem Osten?, fragte Emilia zurück.
Ein jeder Augenblick hat seine Biografie, hätte ich – von Schrey – als Älteste in der Runde da energisch klarstellen sollen, und Beten kommt in manchen Leben einfach nicht vor. Jede Situation hat eine Geschichte, Leute, hätte ich sagen sollen, eine, die man kennen muss, um das Woher und Wieso eines jeden Menschen zu verstehen. Aber da meldete sich bereits die alte Puppe namens Marianne, die bislang wenig gesagt hatte, um Wanda auf ihre Art in Schutz zu nehmen.
Ist Gott eigentlich lieb?, fragte sie in den Raum hinein, ohne irgendwen genauer anzuschauen.
Die Frage nach Gott ließ sich in der Mitte des Stuhlkreises nieder und blieb dort hocken, während der Ausbildungsleiter weiterredete. Man sollte sich, sagte er, darüber im Klaren sein, dass nachts bei den Diensten alles anders sei als am Tag. Nicht selten müsse man bei einem Gespräch durchhalten bis zum Morgengrauen, vor allem wenn die Leute arm, alt, abgehängt und aus dem Osten seien. Seinem Durchhaltesatz fügte er ein leises Genau hinzu, bevor er sich wieder zur Tafel drehte. Breitbeinig und mit dem Rücken zur Gruppe stand er da, um weitere Regeln mit Kreide anzuschreiben und dabei sein Perlenarmband auf dem behaarten Unterarm etwas höher rutschen zu lassen. Ich musste an einen Vogel denken, der ungeniert vor aller Augen in einer Pfütze badet.
Was noch?
Niemand antwortete.
Genau, sagte er, man muss jede Person in ihrer Beklopptheit akzeptieren, muss akzeptieren, dass Frauen grundsätzlich das Kind mehr schützen als den Mann und dass sie vom Ehebruch rascher erzählen als von der missratenen Tochter.
Stimmt das?, fragte ich.
Ja, sagte Emilia, das stimmt. Es ist immer peinlicher, das Kind geschlagen zu haben, als vom Mann geschlagen zu werden.
Ich, sagte ich, ich weiß nicht – aber hielt inne.
Wer von Ihnen hat noch mal Kinder? Sie, oder?, fragte der Ausbildungsleiter in mein Zögern hinein und sah Emilia an. Sie nickte, zärtlich irgendwie.
Zwei!
Genau.
Ich auch! Ein älterer Mann und promovierter Physiker, der seinen Nachnamen bei der Vorstellung weggemurmelt hatte, hielt flüchtig den Zeigefinger hoch und schlug die Beine auf eine Art übereinander, als gäbe es nichts auf der Welt, das er noch nicht kannte. Der, dachte ich damals, der hat vielleicht Kinder, aber die mag er nicht. Der mag nur seine Enkel, falls er welche hat. Bis vor Kurzem hatte er, der Dr.Lorentz hieß, bei der Landesschau Wir im Saarland gearbeitet. Jetzt war er in Rente und wohnte endlich in Berlin, auf der Karl-Marx-Allee, früher Stalinallee. Die Straße deiner Träume, oder?, hatte Emilia ihn vorhin gefragt, aber eigentlich zu Matthias hinüber geredet, dessen Halsmuskeln eine Kontur und antrainierte Stabilität zeigten wie bei einem Boxer. Manche wohnen eben gern denkmalgeschützt, hatte er gemurmelt und Emilia zugelächelt.
Ach ihr, ihr werdet euch ineinander verlieben, wusste ich da bereits.
Auf die Kinderfrage hat dann Matthias seinerseits kleinlaut geantwortet, er sei auch ein Vater. Ich bin Mutter einer Tochter, setzte die alte Puppe Marianne nach, aber wir haben nicht mehr so viel Kontakt. Rieke, deren Züge noch ihren Ausdruck suchten, war die Jüngste in der Runde, zuckte unter ihrer räudigen Trachtenjacke mit den Schultern und wurde rot. Rasch schauten alle Wanda an. Ich habe auch keine Kinder, sagte sie, und will auch keine mehr.
Und du, Frau von Schrey?, fragte Matthias.
Ich?
Allein hatte ich später während einer Kaffeepause im Kreis der leeren Stühle gesessen und mir vorgestellt, was wir, also Wanda, Rieke, Emilia, was Matthias, Marianne und der promovierte Physiker Lorentz am Abend dieses ersten Ausbildungstags daheim wohl machen würden.
Rieke sah ich an einer theologischen Semesterarbeit sitzen. Grundlage dafür, stellte ich mir vor, ist das schmale Buch eines Syrers namens Lukian, das von der Gier der Menschen nach Ruhm und Reichtum handelt. Gut einhundertfünfzig Jahre nach Christus hatte dieser Lukian, geboren irgendwo zwischen Euphrat und Tigris, Gespräche von fiktiven und real existierenden Personen aufgeschrieben. Ein guter Ansatz, fand ich, und nickte Riekes leerem Stuhl zu. Denn was ist schon fiktiv und was ist real existierend, mein Kind, wo bitte soll da der Unterschied sein? Die Auslegung dieser Totengespräche des Lukian, die auch bei mir daheim im Bücherregal stehen, würde sicher mehr eine literarische als eine theologische Herausforderung für die kleine, aber kritische Rieke sein. Nach einem vernieselten Februartag wie diesem – so dachte ich – könnte sie ein Motto von Walter Benjamin dem ersten Kapitel voranstellen: Warum nicht vertrauen auf eine neue Armut, die uns dahin bringt, von vorn zu beginnen …
Dr.Lorentz wird möglicherweise Hemden bügeln – stellte ich mir mit Blick auf seinen Stuhl vor – und dabei aus dem Fenster in eine Häuserflucht schauen. An deren Ende zeichnet sich elegant, kühl und scharf die Kulisse eines neuen Berlins ab. Wie in Shanghai, wird er einen Vergleich suchen, weil er schon mal in Shanghai war. Kurz vor Mitternacht aber wird er glauben, in Chicago zu sein. Denn auch dort war er schon. Was solche abstrakten Formen, die Häuser in der Dunkelheit annahmen, doch mit einem wie Lorentz machten …
Wanda, so dachte ich, könnte auf dem Sofa liegen, mit den Zehen knacken, Tee trinken und abwarten, bis in ihrer Einbildung das Ikeapolster unter ihrem Hintern salzig und feucht wie das Holz von Schiffen riecht, auf denen sie lange zur See gefahren ist. Als Einzige hat sie sich dort sonntags an Deck die Nägel gefeilt. Die anderen schauten ihr dabei zu, waren Männer und drehten Zigaretten mit einer gewissen Unschärfe im Blick. Denn jenseits der Reling zerfiel ihnen allen rasch die Wirklichkeit zwischen Himmel und Wasser, bis keiner, egal, ob Mann oder Frau, noch wusste, welcher Wochentag eigentlich war.
Marianne wird wahrscheinlich in einer kleinen Wohnung vor dem Spiegel stehen und wieder einmal feststellen, dass sie schon längst nicht mehr aussieht wie eine von diesen Kindfrauen auf den Covern zerlesener Taschenbuchkrimis. Trotzdem, so wird sie sich sagen, werde ich eines Tages noch einmal glücklich sein. In der Nacht wird dieser Wunsch eine potenzielle Handlung werden, denn sie wird von einem Hund träumen, der gänzlich schwarz und eigentlich mehr Schattenriss als Hund ist. Er wird sich neben sie legen, die Schnauze an ihren Arm drücken und so verharren in einer reglosen Bezogenheit zu ihr.
Matthias jedoch wird zu viel trinken, wie in den Jahren zuvor und denen danach auch. Wieder und wieder wird er den Zollstock in die Ecke seiner heruntergekommenen Hausmeisterwohnung werfen, in der er im Moment noch, aber in ein paar Jahren nicht mehr wohnt, während hinter der Wand ein Fahrstuhl auf und ab schabt, der zu den Luxusappartements der Schönen und Reichen über ihm führt. Wir arbeiten hier nicht laut, aber beharrlich und unsichtbar an der Basis der Gesellschaft, wird er die Worte des Ausbildungsleiters wie ein Mantra wiederholen, bevor er den Zollstock etwas schwunglos und zum letzten Mal in die Ecke schmeißt.
Ich schmeiß auch bald meinen Job hin, wird die schöne Emilia sagen, als hätte sie auf Kilometerferne den armen Zollstock gegen Matthias’ Wand fliegen hören. Ich bin es leid, alten Damen die Schrottpapiere meiner Bank zu verkaufen, wenn sie mich fragen, wie sie ihr Erspartes für die Enkel anlegen sollen!, wird sie zu ihrer Mutter sagen, die spät noch aus Litauen angerufen haben wird, wo sie in einem kleinen Fachwerkhaus im deutschen Stil und nah der Ostsee wohnt.
Und ich?
Als Letzte hatte ich an jenem Februarsamstag vor vier Jahren den Stuhlkreis verlassen, um den anderen zur Kaffeepause in die Küche zu folgen. Der Kreis blieb allein zurück, aber meine letzte Bewegung war noch da in der Spanne zwischen Stuhl und Stuhl. Manchmal nehmen mir solche Gedanken ein wenig die Angst, auch die Angst vor dem Tod.
Zwei Jahre später – wieder an so einem vernieselten Februarsamstag – war die Ausbildung beendet. Doch trafen sich alle nicht im Stuhlkreis, sondern in Cottbus an der Grenze zu Polen. Aus anderen Städten kamen andere Kurse. Zu fünft waren sie mit einem Gruppenticket im Regionalzug aus Berlin angereist. Auf der kurzen Fahrt gab es Kaffee aus der Thermoskanne, den Marianne mitgebracht hatte. Wanda war diesmal pünktlich gewesen, Emilia hingegen nicht dabei. Matthias machte auf dem Weg vom Bahnhof zum Beauftragungsgottesdienst Fotos, auf denen sie fehlte. Die Beschriftung der Busse, die Regenwasser bis auf die Gehsteige spritzten, war zweisprachig, und die Kirche, in der die Zeremonie stattfand, von einer Hässlichkeit, die einmal als modern durchgegangen sein musste. Allen wurde am Altar eine orangene Rose und – wie ein Schulzeugnis – die Beauftragungsurkunde überreicht. Lorentz kam mit dem Auto zum Termin und brachte eine Kollegin von früher auf dem Beifahrersitz sowie ein Blech Windbeutel auf der Rückbank mit. In einer Rauchpause vor der Sakristei schimpfte diese Kollegin mit fränkischem R auf die DDR, bis Wanda sie stehen ließ und in den Klubraum zum Kuchenbüfett ging. Wandas Mutter war Ende der Siebziger ein Mädchen mit Pony und harten Muskeln an Oberarmen und Beinen und Lehrling im Bewehrungsbau gewesen. Sie hatte Stahl für Plattenbauten genietet, am Rand von Cottbus, wo Ort und Rand nur schwer voneinander zu unterscheiden waren. Im Lehrlingsheim hatte sie gewohnt, war kollektiv nach der Arbeit erschöpft, kollektiv gegen 18Uhr wiedererweckt und allzeit bereit gewesen, in den nächsten Klub zu ziehen. Mit achtzehn wurde sie schwanger.
Du bist ein Produkt des Kollektivs, Wanda, sagte die Mutter gern.
Ja, Mutti, und du bist für mich die DDR!
Früher als alle verschwand Wanda mit Rose und Urkunde wieder Richtung Bahnhof Cottbus. Sollten die anderen doch zu viert mit dem Fünferticket fahren oder sich jemanden suchen, der an so einem Tag besser drauf war als sie. Sie ging durch eine Dunkelheit, die ihr besonders auf der Brücke über den Gleisen polnisch-sozialistisch vorkam. So war das früher auch gewesen, aber früher, wann war das gewesen? Etwas fügte sich in dem kalten Nieselregen von Cottbus gefühlt zusammen, ohne dass sie eine Sprache dafür hätte finden können. Sie hasste diese Momente, in denen ihr klar wurde, wie lächerlich ähnlich sich doch Erinnern und Vergessen waren. Wanda war geboren in einer Zeit, als die DDR nicht mehr ganz DDR war, aber sie fühlte sich noch immer wie ein Kind von dort – so wenigstens hatte sie sich beim ersten Treffen ihrer Ausbildungsgruppe beschrieben. Zonenkind also, hatte Lorentz diagnostiziert, aber an Wanda vorbeigeschaut. Wanda war seinem Blick gefolgt. Eine Frau im Vorderhaus hatte gerade ihre Gardine vorziehen wollen. Sie hielt inne, als hätte sie Lorentz’ oder Wandas Blick bemerkt. Das Zimmer in ihrem Rücken war lang und schmal und die Tapete düster. Wer glaubt denn heutzutage noch an Tapeten, hatte Wanda gedacht, und wer sagt noch das Wort Zone mit einem so dunklen Zungenschlag wie Lorentz, als müsste er ständig ein Damals im Jetzt und ein Dort im Hier beschwören? Zone, dachte sie, dieses Wort löst doch eigentlich nur noch Vorstellungen von öligen Regenbändern aus, die durch das undichte Dach einer verlassenen Maschinenhalle fallen.
Ja, bin ich denn ein Zonenkind, nur weil ich in der Kindheit zu viel über asbestverseuchten Dämmestrich gelaufen bin und meine Haare, wenn ich sie lange nicht gewaschen habe, wie Moskau im Winter riechen?, hatte Wanda Lorentz gefragt. Weder er noch die anderen verstanden, was sie meinte. Okay, sagte sie in den Stuhlkreis hinein, dann mache ich mal weiter mit meiner realen und irgendwie auch sozialistischen Biografie. Ich habe also Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin gelernt und bin ab 2002 als Unteroffizierin für die Marine zur See gefahren. Jetzt arbeite ich im Depot eines DDR-Museums, Punkt! Danke, hatte der Ausbilder mit dem Frauenarmband gesagt und in die Runde geschaut.
Ich betone nochmals, dass wir alles, was hier gesagt wird, mit Anteilnahme, Akzeptanz, Wertfreiheit, Partnerschaftlichkeit und wohlwollender Neugier aufnehmen! Wir praktizieren hier aneinander, was wir später dienstlich auch am Telefon praktizieren werden.
Sonst noch was? Wo bleibt der Humor?
Wanda hatte sich plötzlich schläfrig gefühlt.
Am Bahnhof Cottbus nahm sie den Regionalzug zurück nach Berlin. Zwei dicke Mädchen, die ihre schmutzigen Socken zärtlich gegen die Schienbeine ihrer dicken Mutter drückten, schauten im Internet Fußball.
Fresst nicht die ganze Zeit dieses Vogelfutter, ermahnte sie die Mutter und zeigte auf die Tüte zwischen den beiden.
Das ist kein Vogelfutter!
Aha, sagte die Mutter.
Aha, echoten die Mädchen und gingen zu zweit auf ihren schmutzigen Socken ins schmutzige Regionalzugklo. Als sie vierhändig die Tür geöffnet hatten, zog eine Duftwolke Marke rosa Billigkaugummi durch den Waggon.