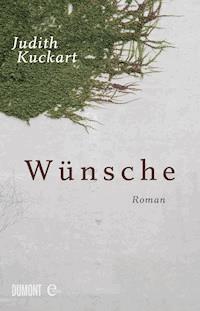9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Leo Böwe im Spätherbst 1957 durch die Frankfurter Kaiserstraße geht, hört er vom Mord an der Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt. Der Name setzt sich in seinem Kopf fest wie der Name einer Geliebten, der er nie begegnet ist. Zehn Jahre später hat Böwe eine Tochter, Jule, die beiden haben es nicht leicht miteinander. Als Jule im Fernsehen den erschossenen Benno Ohnesorg sieht, beschließt sie: »Papi, wenn ich groß bin, erschieße ich dich auch.« Durch fünf Jahrzehnte begleitet Judith Kuckarts großer Roman das Leben von Leo und Jule Böwe. ›Kaiserstraße‹ ist ein Fotoalbum in Worten; in fünf Stationen verfolgt es die Entwicklung zweier gegensätzlicher Helden und markiert zugleich fünf Wendepunkte in der Geschichte der Republik: 1957, 1967, 1977, 1989, 1999. Und wie das Land sich verändert, verändern sich auch seine Bewohner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Als Leo Böwe im Spätherbst 1957 durch die Frankfurter Kaiserstraße geht, hört er vom Mord an der Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt. Der Name setzt sich in seinem Kopf fest wie der Name einer Geliebten, der er nie begegnet ist. Böwe ist im Begriff, eine Stelle als Vertreter für Waschmaschinen anzutreten, er lernt die Regeln des Geschäfts: »Der Verkauf beginnt, wenn der Käufer Nein sagt.« Zehn Jahre später hat Böwe eine Tochter, Jule, die beiden haben es nicht leicht miteinander. Als Jule im Fernsehen den erschossenen Benno Ohnesorg sieht, beschließt sie: »Papi, wenn ich groß bin, erschieße ich dich auch.«
Durch fünf Jahrzehnte begleitet Judith Kuckarts großer Roman das Leben von Leo und Jule Böwe. ›Kaiserstraße‹ ist ein Fotoalbum in Worten; in fünf Stationen verfolgt es die Entwicklung zweier gegensätzlicher Helden und markiert zugleich fünf Wendepunkte in der Geschichte der Republik: 1957, 1967, 1977, 1989, 1999. Und wie das Land sich verändert, verändern sich auch seine Bewohner. Es ist eine brüchige Karriere – denn verkaufen lässt sich vieles, Waschmaschinen ebenso wie Ideen, Werte und Politik. Verkaufen kann man am Ende auch sich selbst.
© Burkhard Peter
Judith Kuckart, geboren 1959 in Schwelm (Westfalen), lebt als Autorin und Regisseurin in Berlin und Zürich. Sie veröffentlichte bei DuMont den Roman ›Lenas Liebe‹ (2002), der 2012 verfilmt wurde, den Erzählband ›Die Autorenwitwe‹ (2003), die Neuausgabe ihres Romans ›Der Bibliothekar‹ (2004) sowie die Romane ›Die Verdächtige‹ (2008), ›Wünsche‹ (2013), ›Dass man durch Belgien muss auf dem Weg zum Glück‹ (2015) und ›Kein Sturm, nur Wetter‹ (2019). Judith Kuckart wurde mit zahlreichen Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet.
Judith Kuckart
Kaiserstraße
Roman
Von Judith Kuckart sind bei DuMont außerdem erschienen:
Lenas Liebe
Die Autorenwitwe
Der Bibliothekar
Die Verdächtige
Wünsche
Dass man durch Belgien muss auf dem Weg zum Glück
Kein Sturm, nur Wetter
eBook 2021
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
© 2006 DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Coverabbildung: © ullstein bild
Satz: Verlagsgruppe Random House
Gesetzt aus der Life, der Myriad Pro, der Minion Pro und der Varna
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7104-9
www.dumont-buchverlag.de
Ein Roman ist ein Spiegel, der sich auf einer großen Straße fortbewegt.
Die ersten Mieter waren Ende 1955 eingezogen. Unter ihnen eine junge, alleinstehende Frau mit Hund. Sie war zweiundzwanzig, als sie einzog, und vierundzwanzig, als ihre Leiche aus dem Haus getragen wurde. Einen Spätherbsttag lang hatte sie Möbel hinaufbringen lassen. Die Einrichtung wurde von den Vorstellungen eines Mannes mit viel Geld bestimmt. Er mietete das Appartement, richtete es ein, für sie, die keinen besonderen Geschmack hatte, aber extravagante Einfälle. Der Wohnung sollte man ansehen, wie teuer die Einrichtung war, wünschte sie sich. Nein, sagte er und ließ das Möbelhaus machen.
Die Kunden der jungen Frau fühlten sich von der neuen Wohnung verstanden, sie fühlten sich verstanden vom sachlichen Geschirr und von der Bambuswand hinter der Couch, von den farbigen Stoffen, Grünpflanzen und der Essnische aus ungestrichenem Holz bis hin zu den drei großen Stehlampen, die Inseln aus warmem Licht in den kühlen Raum warfen und ihn zu einem Ort flüchtiger Gewissheit machten, zu einem festen, hellen Boden unter den Füßen. Auch die blaue Couch gehörte dazu, auf der die junge Frau am ersten November 1957 erwürgt aufgefunden wurde, die Unterschenkel lagen im rechten Winkel auf der Sitzfläche, der Rumpf auf dem Teppich davor. Der Rock war hoch- und ein Pantoffel vom Fuß gerutscht. Eine Leiche mit aufgedunsenem Gesicht in Stufenstellung, eine Position, die der Arzt bei Rückenschmerzen empfiehlt. Aber die Liebe? Aber der Tod? Als sie noch lebte, hatte die junge Frau ein bleiches Gesicht und schielte ein wenig. Sie hatte das Gesicht, das man von ihr verlangte, und einen unbeschwerten Umgang mit Gefühlen, als könne sogar die Trostlosigkeit, egal welcher Begegnung, sie befriedigen.
Neunzehnhundertsiebenundfünfzig
Die Straßenbahn quälte sich hörbar die leichte Steigung hinauf und hielt vor dem Haus. Es war kurz nach halb sieben am Abend. Die Dachwohnung lag im fünften Stock, und Leo Böwe hörte durch das geschlossene Schlafzimmerfenster, wie die sieben Türen der Bahn sich öffneten, stillhielten und wieder schlossen. Die Bahn fuhr weiter, Richtung Friedhof, Richtung Tankstelle, Richtung Stadtgrenze, dann in die nächste, größere Stadt, Wuppertal. Leo Böwe zog seinen abgenutzten Rucksack aus der Ecke des Kleiderschranks hervor und warf ihn auf das neue Ehebett. Aluminiumgeschirr und eine Wasserflasche schlugen aneinander. Die Tagesdecke gab unter dem Gewicht nach. Über die Kuhle im Plumeau würde Liz sich ärgern.
Als Liz nach der Trauung mit Böwe aus der Kirche getreten war, fiel Regen. Die Trauzeugen warfen Geld und Bonbons. Mädchen mit Pagenkopf und Jungen mit ausrasiertem Nacken stießen sich die Ellenbogen in die Seiten, während sie sich bückten, und das Paar lachte. Er lachte auf den regennassen Boden, und sie in sein abwesendes Gesicht hinein. Er sah klug aus, sie glücklich. Die Hochzeitsgesellschaft in ihrem Rücken schaute ernst und bleich und leer, als sei dieser Moment kein gemeinsamer zwischen ihnen und dem Paar.
Leo zwanzig, Liz neunzehn. Auf der nassen Straße raffte sie ihr Brautkleid seitlich und hatte so auf dem Weg zum geliehenen Auto ein großes S im Körper, ein unsichtbares Gewicht auf der rechten Hüfte. Leo trug seinen Zylinder in der Hand. Kurz vor dem Leihauto hakte er bei Liz unter. Jemand machte noch ein Foto. Es war der erste Mai 1956. Auf dem Foto waren das geliehene Auto schwarz, die Nelken dunkelgrau, und der Regen hatte seine eigene Farbe, die man nur in der Bewegung sehen konnte.
Böwe setzte sich auf das Bett, neben den Militärrucksack mit den zwei geschlossenen Gürtelschnallen. In dem Moment ging die Schlafzimmertür auf.
Sie hatte einen kleinen Koffer in der Hand.
Wo hast du den her?
Gekauft, sagte sie, setzte sich auf den hellblauen Wäschepuff, hob den Koffer auf ihren Schoß, öffnete den Reißverschluss, holte zwei Bierflaschen und den Rest vom Einkauf heraus.
Was ist denn das?
Das hier? Käse, sagte Liz.
Und das Köfferchen?
Pfeffer und Salz, sagte sie.
Bitte?
So heißt das Muster.
Sie fuhr mit der Hand über den schwarz und weiß gesprenkelten Stoff, hielt inne, stierte vor sich hin und stand dann doch auf. Sie biss das Preisschild mit den Zähnen ab und fing an zu packen: drei Tage, zwei Nächte, kein Pullover, aber Unterhemd und Jackett. Sie hielt dabei den Kopf geneigt, und er sah die wunderbare Linie ihres Halses und das auf Kinnlänge stumpf abgeschnittene blauschwarze Haar.
Ist das echt, hatte er sie gefragt, als sie sich das erste Mal begegnet waren.
Nee, ist die Karnevalsperücke meiner Tante, hatte Liz gesagt. Das war in der Tanzstunde vor ein paar Jahren. Sie machte gern Sprüche. Er mochte sie dafür. Sie waren dann Komplizen und nicht von hier.
Es war keine glanzvolle Hochzeit gewesen. Ein hässlicher Trauzeuge hatte einen großen schwarzen Schirm über das Paar gehalten, als sie aus der Kirche kamen, obwohl der Regen fein und fröhlich gewesen war, und später hatte der gleiche Trauzeuge Akkordeon in der engen Wohnung von Liz’ Eltern gespielt, kaum, dass sie zur Tür hereinkamen. Eine Wohnung, eng wie eine Fischbüchse und voller Menschen, in den zerknitterten, aber hart aufgebügelten Sonntagskleidern armer Leute.
Quetschkommode, hatte Liz abfällig gesagt, obwohl die Akkordeonmusik allen Spaß machte.
Das Viertel, in dem sie aufgewachsen war, lag nah am Wald und weit weg von jeder Schule und noch weiter weg vom Bahnhof. Die Häuser waren bunt gestrichen, um über ihre Hässlichkeit hinwegzutäuschen. Papageienviertel, sagten die Leute aus dem besseren Teil der Stadt. Liz’ Leben im Papageienviertel war ihr, wenn sie sich morgens in einer Emailleschüssel mit kaltem Wasser auf dem Flur wusch, vorgekommen wie etwas, das vorbei ist, bevor es anfängt. Selbst für die Hochzeit hatten sie sich keine Pracht ausleihen können. Braten, Soße, Kartoffeln und Gemüse lagen vorgekocht unter dicken Plumeaus im Bett der Eltern. Zum Tanzen war es in der Wohnung zu eng. Man schunkelte. Man schloss abends gegen zehn alle Fenster, und im Zimmer explodierte die Hitze. Man schunkelte noch immer und sang: Wir kommen alle, alle in den Himmel, bis Leo und Liz endlich im Nachbarzimmer zu Bett gingen. Es war Liz’ Mädchenzimmer, wo sie sich bis gestern noch mit der jüngeren Schwester die Klappcouch geteilt hatte. Liz und Leo hörten die Gäste auf der anderen Seite der Tür reden, hörten sie nach jedem lauten Lachen zu ihnen hinüberlauschen. Dann schunkelten sie drüben weiter und sangen: Der schönste Platz ist immer, immer an der Theke, sangen sie und zogen daraus nach einem weiteren Schnaps messerscharf den Schluss: Ja, an der Theke, da ist der schönste Platz! Leo flüsterte Liz zu, dass diese Gäste dumm seien und dass Dummheit für Dumme offensichtlich unterhaltsam sei. Liz verstand den Satz nicht. So fing es an. So hatte es angefangen. Unter der Tür fiel ein schmaler Streifen Licht hindurch. Leo erinnerte sich, dass er so ein Licht als Kind beruhigend gefunden hatte. Jetzt gar nicht mehr. Jetzt störte ihn das Zeichen der Anwesenheit anderer. Es roch nach Zigaretten. Wie aus der Hölle riecht es, flüsterte Liz. Sie waren beide noch Jungfrau. Er sagte zu ihr, lass uns noch warten, jetzt, wo wir schon so lange gewartet haben. So waren sie aneinander, ja sehr aneinander gedrückt eingeschlafen, sie auf dem Bauch, die Füße entenhaft ausgedreht. Er lag auf der Seite, eine Hand auf ihrem Hintern, eine zwischen seinen Beinen. Auf dem kleinen Tischchen, wo Liz und die Schwester früher Schularbeiten gemacht hatten, lag ein Obstmesser. An das Obstmesser dachte er noch oft, danach.
Eine dreieckige Zeltplane, eine eingerollte graue Militärdecke, die nach feuchter Wolle roch, auch wenn sie trocken war, eine Alufeldflasche, Alugeschirr, Löffel und Gabel, alles einklappbar, ein dünnes, rotes Handtuch, Unterhose, Socken, Windbluse, eine Tafel Blockschokolade und ein Rest Quäkerspeise aus amerikanischen Beständen. Liz schlief, Leo nicht. Es war fünf Uhr in der Frühe, und er erinnerte sich an den Inhalt seines alten Rucksacks. Früher war Böwe Pfadfinder gewesen. Morgen würde sein Sonderauftrag in Frankfurt beginnen. Das neue Pfeffer-und-Salz-Köfferchen stand bereits gepackt am Fußende vom Ehebett. Was in dem Rucksack war, das hatte nicht mehr hinein gepasst. Das von früher, das ging nicht mehr.
Was machst du da, fragte Liz misstrauisch. Sie war wach geworden und drehte ihm ihr Gesicht zu. Was machst du, was wühlst du so herum?
Ich erinnere mich, sagte Böwe.
So’n Quatsch, sagte sie. Er suchte ihre Hand unter der Bettdecke.
Kannst du dich besser erinnern, wenn du dich bewegst? fragte Liz, während sie ihm auswich.
Ja. Er fand ihre Hand und hielt sie fest, während er im Dunkeln in das Weiße ihrer Augen sah. Ein heller Fleck am Anfang eines Traums.
So’n Quatsch, sagte sie wieder, schlaf weiter. Sie zog ihre Hand aus seiner und legte sie ihm über die Augen.
Sie nannten ihn den kleinen Böwe, auch wenn er eins siebenundachtzig groß war. Gewisse Blicke von Männern machten ihn unsicher wie ein gewisses Lächeln bei Frauen auch. Vier Monate vor dem Abitur hatte er das Gymnasium mit einem ausgezeichneten Zeugnis verlassen, obwohl er sich während des Unterrichts, da hinten in seiner letzten Bank, meistens zu schade dafür gewesen war, die Hand aus dem Gesicht zu nehmen und in die Luft zu strecken, wenn er etwas wusste. An einem Märzmorgen hatte er sich sein Zeugnis im Sekretariat abgeholt, während in allen Klassenzimmern der Unterricht lief. Das war vor drei Jahren. Er hatte die Stimmen der Lehrer durch die Türen hindurch gehört, als er, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinunterrannte, den Geruch von alten Äpfeln und Putzmitteln in der Nase, den er seit neun Jahren kannte, wie die Nägel im Flur auch, die im bröckelnden Putz noch immer die Kleiderhaken ersetzten. Er rechnete seinen Notendurchschnitt aus: eins Komma vier. Sogar in Sport und Zeichnen hatte er eine Eins. Mit der Hand hatte der Direktor unter das Zeugnis geschrieben, Böwe sei intelligent, außerordentlich sportlich, loyal, begeisterungsfähig, aber unruhig.
Warum gehen Sie ausgerechnet jetzt? Haben Sie nur noch Ihren Fußball im Kopf?
Böwe schüttelte den Kopf Sie sind ein guter Fußballer, Böwe. Wollen Sie vielleicht versuchen, hochklassig zu spielen? Es würde zu Ihnen passen, Böwe. Fußball kommt von innen heraus. Viel Bauch, viel Gefühl, viel Leidenschaft. Rahn! Walter! Wollen Sie nicht spielen wie die? Und dann noch mit Abitur?
Böwe schüttelte den Kopf.
Also, welche Gründe gibt es dann?
Böwe sah aus dem Fenster. Seine Klasse spielte unten auf dem Sportplatz im roten Sand Fußball. Er sah Schorsch Szymanski rennen, einen Verband am Knie, unter dem sicher nichts anderes als ein gesundes Knie war. Szymanski rempelte, spuckte, rempelte weiter, und der Sportlehrer, bei dem sie auch Französisch hatten, ließ die Trillerpfeife unbenutzt vor dem Bauch baumeln. Wie letzte Woche. Letzte Woche war Böwe noch mitgerannt, hatte sich angeboten, nach jeder Chance Ausschau gehalten, trotz der Erkältung. Szymanski hatte gerempelt mit der Regelmäßigkeit einer Kuckucksuhr. Dann ein schöner weiter Pass auf Böwe, Böwe schießt, der Ball wird abgewehrt, aber rollt ihm wieder entgegen. Zwei Gegenspieler, einer ist Szymanski, stürzen sich mit ihm auf den Ball. Böwe muss den Ball nehmen, wie er kommt, erwischt ihn weder direkt mit der Spitze noch voll mit dem Spann, aber fetzt ihn, so gut es geht, mit gestrecktem Bein in die linke Torecke, während sein rechter Arm ausschlägt und Szymanski in den Bauch trifft. Ein Pfiff, der Lehrer will das Tor nicht anerkennen, zeigt auf Szymanski am Boden, der so tut, als bekomme er gerade ein Kind.
Weil ich ihn am Hemd gezupft habe, Herr Lehrer, fragt Böwe da ruhig. Herr Lehrer, Sie bescheißen uns. Böwe, sagt da der Lehrer, Sie haben hier gar nichts zu melden. Wer hier arm ist und ein Stipendium für das Schulgeld kriegt, hat gar nichts zu melden, gar nichts, Böwe, verstanden? Böwe hebt die Hand und sieht in dem Moment seine Mutter in der Fabrik am Fließband stehen, im blauen Nylonkittel, wie sie die Ränder von Babywannen aus Plastik glättet. Er hält mit der Ohrfeige auf halbem Weg inne, leitet die Bewegung um, nimmt die Hand als Blende vor die Augen und tut so, als störe ihn nur die Sonne. Er kneift den Mund dabei zusammen, dann kurz den Hintern und geht. Hey Boss, ruft der Torwart seiner Mannschaft noch hinter ihm her, hey Boss, was ist?
Böwe ging sich anziehen, dann nach Hause, setzte mit der Hand, die hatte schlagen wollen, ein Schreiben auf an das Ministerium für Schule und Erziehung und tippte es vorn im Lebensmittelladen fehlerfrei mit zwei Fingern ab. Er legte es der Mutter am frühen Abend hinten in der Ladenwohnung, die sie gemietet hatten, vor. Sie hatte geweint und dann unterschrieben.
Böwe, ich habe Sie nach dem Grund gefragt, sagte der Direktor.
Herzensgründe, sagte Böwe und hatte das Gesicht, das er in zwanzig Jahren einmal haben würde, wenn er mit der Wahrheit log.
Ein Mädchen also?, hatte der Direktor gesagt.
Ja, ein Mädchen. Jedes intime Geheimnis war ihm als Vorwand recht, und es gibt Sekunden, da lernt einer, was ein anderer in Jahren nicht lernt.
Da kann ich Ihnen nur einen Rat geben. Hängen Sie Ihre Hose nur da auf, wo Sie auch Ihren Hut aufhängen würden, hatte der Direktor gesagt.
Böwe wurde Waschmaschinenvertreter.
Am Tag, nachdem Böwe die Schule verlassen hatte, stellte er sich bei Fritz und Franz Locke als Lehrling vor. Lockes Waschmaschinen- und metallverarbeitende Fabrik. Schnell hatte er die Regeln gelernt, die ein Waschmaschinenvertreter brauchte, um über die Türschwelle zu kommen.
1. Verkauf ist eine persönliche Beziehung zwischen zwei Menschen.
2. Mit Humor kommt man am weitesten.
3. Was man zu verschenken vorgibt, verwandelt sich in Gewinn.
4. Die Anliegen des Kunden haben immer Vorrang: Wichtiger ist es, sein Wohlwollen zu gewinnen, als den Verkauf abzuschließen.
5. Für einen Misserfolg mag es Gründe geben, aber keine Entschuldigungen.
6. Jeder Kunde muss seine Neins loswerden, bevor er ja sagen kann. Also: Alle Fragen, auf die er mit Nein antworten kann, zuerst stellen, damit er die Neins los wird, um dann das wirkungsvollste Wörtchen des Verkaufs dagegen zu setzen: Warum.
7. Wer schnell überlegt, kann befehlen. Wer zögert, muss gehorchen.
8. Der Verkauf beginnt, wenn der Käufer nein sagt.
Böwe entwickelte sich im Kielwasser eines älteren Vertreters, der ihn anlernte, rasch zu einer Art geheimem Verführer, sobald er vor fremden Türen stand. Er lernte im richtigen Moment des Verkaufsgesprächs zu fragen: Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Sind Sie eigentlich aus dem Badischen? Ja, ja, Ihr Tonfall hat so etwas Südliches. Meistens saß er da schon am Küchentisch einer einsamen Hausfrau, trank ein Glas Wasser oder einen Kaffee, lobte irgendwelche trockenen Kekse und schob mit dem Satz die Packung beiseite, um Platz für seine Prospekte zu haben. Verkauf, begriff er schnell, war eine Bindung zwischen zwei Menschen, von denen der eine, der Verkäufer, die Ideen haben musste, von denen der andere, der Käufer, glaubte, es seien seine.
Es war ein sonniger, klarer Oktobertag, der Himmel wie gefegt, wie an einem nördlichen Meer. Böwe war noch nie am Meer gewesen.
Mein kleiner Böwe, rief Franz Locke vom Schreibtisch aus, mein kleiner Böwe, ich habe eine Aufgabe für Sie, die ich nur Ihnen zutraue. Sie sind mein Mann! Böwe lächelte und las wieder einmal den eingerahmten Spruch hinterm Schreibtisch des Chefs:
Es gilt den Wohlstand moralisch zu bewältigen.
Fehlte da nicht irgendwo ein Komma?
Fritz und Franz Locke waren Zwillinge und ziemlich klein gewachsen. In einen Krieg hätten sie nur übereinander gestellt ziehen dürfen. Nach dem letzten Krieg aber hatten sie es allen anderen gezeigt. Beide fuhren sie einen großen Mercedes, weil sie auch Mercedes-Benz belieferten. Fritz fuhr einen weißen, Franz einen rauchblauen, und die Ledersitze in beiden Wagen waren grau. Franz war der Misstrauischere von beiden und Böwes Chef im Verkauf. Fritz, für den Einkauf zuständig, war entspannter und hatte die schönere Frau. Die Stadt hatte fünf Waschmaschinenfabriken, aber nur ein Gymnasium. Böwe hatte sich vor zwei Jahren die kleinste, aber exklusivste Fabrik ausgesucht. Adolf Hitler war vor einem Jahr amtlich für tot erklärt worden, und Böwe wählte im September dieses Jahres Adenauer. Denn Adenauer hatte im September ’57 die letzten Kriegsgefangenen aus Russland frei bekommen. Da hatten ihn viele gewählt. Böwes Chefs auch.
Mein kleiner Böwe, ein Sonderauftrag!, sagte Franz Locke. Ich sage nur: Corelli & Co. Wir müssen deren Pleite für uns nutzen. Sie werden das für uns tun.
Franz Locke musterte ihn. Ein Auge war gerührt, eins böse. Die Schreibtischbeine hatten vier Löwentatzen, die ihre Holzkrallen in den Teppich gruben. Unter dem Tisch standen die Füße des Chefs zwischen den Tatzen eng beieinander, zwei winzige Füße in blank geputzten schwarzen Männerschuhen. Das sah Böwe, als dem Chef ein Bleistift hinunterfiel, er sich danach bückte und länger als nötig auf dem Boden herumkroch. Am liebsten wäre Leo Böwe, zweiundzwanzig, kaufmännischer Lehrling, sportlich, aber mit Untergewicht, für immer unter dem Schreibtisch seines Chefs sitzen geblieben. So war das bei ihm. Vor der Situation zu viel Angst, in der Situation zu unerschrocken.
Das Gespräch dauerte über eine Stunde, und Böwe schlug nicht einmal die Beine übereinander. Er dachte an die afrikanische Maske daheim an der Bambuswand, wenn ihm die Fragen zu kompliziert wurden, und verschanzte sich hinter deren Zügen.
Es sei eine große Herausforderung und ein Abenteuer, sagte der Chef, und eine delikate Angelegenheit. Er solle in Kürze immer donnerstags für die Firma Locke nach Frankfurt fahren. Er und sein Bruder Fritz hätten die Vertreter der Konkursfirma Corelli & Co für den eigenen Verkauf im Rhein-Main-Gebiet übernommen, und Böwe solle dieser Hand voll Männer immer freitags in einem eigens dafür angemieteten Büro die beachtliche Provision von 25 Prozent je abgeschlossenem Kaufvertrag ausbezahlen. Er werde mit dem Zug und viel Bargeld nach Frankfurt reisen, bis samstags dort bleiben, im Hotel am Berg untergebracht sein und von ihm, Franz, oder seinem Bruder Fritz mit dem Auto abgeholt werden. Und wegen des vielen Bargelds brauche Böwe sich keine Sorgen zu machen. Er habe doch sicher noch einen Brustbeutel von früher, als er mit seinen Pfadfindern auf Tour gegangen sei.
Das Büro liegt übrigens in der Nähe der Kaiserstraße, falls Ihnen das etwas sagt.
Es sagte Böwe nichts, aber er nickte und gab noch immer vor, die Maske zu sein. Dahinter begann er zu träumen. Er war seit über einem Jahr verheiratet, aber noch nie in Frankfurt gewesen.
Es war Mittagszeit. Böwe trödelte auf dem grünen Linoleum zwischen den Büros herum. Am Ende des Gangs war ein Fenster, und hinter dem Fenster lag der LKW-Parkplatz, dann kam das Fabriktor, dann die Straße, und jenseits der Straße zeichnete sich ein ziegelroter Eisenbahnviadukt gegen ein Blau ab, das man an einem Tag wie heute wirklich Himmel nennen konnte. Böwe lehnte kurz die Stirn gegen die Scheibe. Von hier aus gesehen schien es da draußen warm zu sein. Altweibersommer.
Er ging die Treppe hinunter zum Ausgang des Bürotrakts und kam parterre am Tor der Maschinenhalle vorbei. In gleichmäßigen Abständen wurde auf der anderen Seite des Tors Metall aus Metall geschnitten, um einmal Waschmaschine zu sein. Das tat in den Ohren weh wie ein Schrei. Er ging zur Pforte, um Mahlzeit! zu rufen, oder Bin-gleichwieder-da! Der Stuhl des Pförtners war leer, aber das Radio spielte den Kriminaltango vom vergangenen Jahr. Hazy Osterwald. Böwe lächelte und ging weiter. Er hatte ein nettes, scharfes Gesicht und breite Schultern, die beim Gehen ganz ruhig blieben, während er hinaus auf den LKW-Parkplatz ging, in eine Oktobersonne, die längst nicht mehr wärmte.
Er hatte nicht einmal einen Koffer, um nach Frankfurt zu fahren.
Du hast heute Nacht geschrien im Traum, sagte Liz, als sie sich unter der Tür im Nachthemd von ihm verabschiedete.
Wovon er geträumt hatte? Er schaute auf ihr rosa Nylonnachthemd, und in dem Moment glitt der Traum an dem Stoff ab. Es war kalt im Hausflur. Er küsste sie auf die Nase, nahm sein Pfeffer-und-Salz-Köfferchen und fuhr mit der Straßenbahn ins Büro. Mittags aß er aus einem Henkelmann Grünkohl mit Mettwurst, arbeitete bis zum frühen Nachmittag weiter, holte gegen zwei Uhr seine 20000 Mark bei Franz Locke im Büro ab, schob die Scheine unter dessen Augen ehrfürchtig in den Brustbeutel, nahm sein Köfferchen und ging. Der Weg zum Bahnhof führte am Rand der Stadt an den Gleisen entlang. Die Sonne stand ziemlich tief im Westen und blendete ihn. Frankfurt aber lag im Süden. Da unten in Frankfurt, sagte Liz immer ängstlich, seitdem sie von dem Sonderauftrag wusste, so als läge Frankfurt in Richtung Hölle. Auch Böwe erwartete, dass Frankfurt da unten tatsächlich der finsterste Süden war.
***
Bis Wuppertal fuhr er mit dem Nahverkehr zweiter Klasse. Die Fahrkarte löste er am Bahnhof bei dem Kerl, den er schon als Kind nicht hatte leiden können. Sommers wie winters trug der den gleichen Pullover und trank seinen Kaffee aus einer ungespülten Tasse, die schmutzig wie ein Klo war, bevor er nebenbei den nächsten Kunden am Schalter bediente. Was war das nur für einer, den man so lange und eigentlich gar nicht kannte? Im Ort sagte man, er schreibe nach Feierabend Gedichte darüber, dass der Himmel längst abgeschafft sei. Sicher war er Kommunist, denn er trug nie weiße Hemden, auch sonntags nicht.
In Wuppertal-Elberfeld stieg Böwe um in den Fernzug nach Köln und in Köln in den nach Frankfurt. In den Fernzügen saßen andere Männer als im Nahverkehr. Männer mit dünnen Aktenmappen, dünnen Krawatten, glänzenden Anzügen und abstehenden Fledermausohren. Böwes Gesicht war oval und noch unentschieden. Hinter den Augen wartete eine erste Melancholie darauf, richtig Melancholie zu werden. Aber wenn er aus dem Zugfenster sah, verbündete sich das, was da draußen war, mit dem, was in ihm war. Er war glücklich in diesem schnellen Zug, der durch kleine Städte ohne Halt fuhr. Hatte er wirklich im Traum geschrien, in der Nacht?
In Köln setzte Böwe sich mit seinem neuen Köfferchen in den Speisewagen, um dort bis Frankfurt zu bleiben. Er strich mit beiden Händen über die purpur- und dunkelgrau gestreiften samtigen Sitze. Kaum einer der weiß gedeckten Tische war besetzt. Nur an dem Tisch, der am weitesten von ihm entfernt war, saß ein Mann in Hosenträgern, der viel älter war als er, und rauchte Zigarre. Böwe las die Speisekarte genau. Hähnchenbrust mit Reis, Linsensuppe mit und ohne Würstchen, Käse- oder Aufschnittplatte mit Gurkengarnitur. Er bestellte die Käseplatte und einen Wein.
Guten Abend, sagte die Frau. Draußen war es noch hell.
Sie war in Koblenz eingestiegen.
Er hatte sie bereits auf dem Bahnsteig gesehen, mit einem Gesichtchen, das in seine Hand gepasst hätte und das vielleicht älter war als seines, vielleicht aber auch nicht. Es war sehr blass, aber anders blass als das von Liz. Leo Böwe wünschte sich in dem Moment etwas und vergaß es gleich wieder.
Guten Abend.
Sie setzte sich an seinen Tisch, nachdem sie leise gefragt hatte, ob er auch nicht rauche. Sie trug einen flauschigen schwarzen Pullover und schob die Ärmel über sehr weiße Unterarme bis zu den Ellenbogen hinauf. Erst dann zog sie die Handschuhe aus. Sie trug eine Elfenbeinkette eng um den Hals und strich das Haar zurück, das blond war, aber mit einem Ton von Asche darin. Seine Schwägerin war auch blond, aber eigelb-blond. Sie war Schuhverkäuferin und überhaupt eine dumme Person. Wenn eine Frau allein reiste wie diese hier, war sie sicherlich eine intelligente Frau.
Ich hätte gern ein Glas Wein. Südwein, sagte sie zum Kellner.
Neben ihnen glitzerte der Rhein, als Böwe aus dem Fenster schaute. Spätherbst. Zwischen den Häusern rechts der Bahnstrecke sah man wenige Menschen. Sie liefen schräg, weil es windig war. Die Frau warf die Haare noch einmal zurück, und erst jetzt sah er, sie trug Ohrringe, orangerot wie die Winker am Auto, wenn man abbiegt. Sie legte eine braune Kameratasche auf den weiß gedeckten Tisch und bestellte eine Ovomaltine.
Zum Wein?, fragte Böwe.
Ich trinke Ovomaltine, sagte sie, damit ich groß …
… und nicht nervös werde, vervollständigte Böwe den Spruch aus der Werbung. Ein Schafslächeln, das sich dabei in sein Gesicht schlich, wischte er eilig mit der Hand weg. Er musste sich rasieren, merkte er, während er aus Verlegenheit sein Gesicht weiter rieb. Ein letztes Sonnenlicht fiel auf die zwei Weingläser und auf den Ehering an Böwes Hand.
Morgen war Allerheiligen.
Leo Böwe wurde am 10. Mai 1935 geboren, um Mitternacht, vier Monate und zwei Tage nach Elvis Presley, und zwei Jahre nach der Bücherverbrennung. Er las wenig. Aber ein Buch war seine Bibel. Eigentlich hatte er es nur wegen des Titels aus dem Regal irgendeiner Buchhandlung geholt: »Die geheimen Verführer«. Als er es aufschlug, begriff er sofort, dass es nichts mit Sex zu tun hatte. Als er es zurückstellen wollte, hatte er bereits zu lesen begonnen und war weiter lesend zur Kasse gegangen. Bei dem Buch ging er in den Wochen darauf in die Lehre. Abends, während das Radio für Liz spielte, saß Böwe neben ihr auf der Couch, mit angezogenen Knien, seine Nase spitz wie der Schnabel eines neugierigen Vogels, und begriff, warum Frauen mit Vorliebe Artikel in roter Verpackung kaufen, warum Männer Zigaretten rauchen, warum eine Frau nur selten das Kleid kauft, das ihrem Geschmack entspricht, warum die Herrenbekleidung femininer und die Angst vor Banken größer wird, ja, warum man diese oder jene politische Partei wählt und warum sich die Menschen neuerdings die Zähne vor dem Frühstück putzen.
Manchmal las er Liz daraus vor. Sie gähnte. Ihr Gelangweiltsein hatte sie ihm langweilig gemacht. Aber die zwei Reihen hübscher, kleiner, weißer Zähne, die sie beim Gähnen wie geheime Perlen zeigte, hatten ihn wieder versöhnt.
Bis wohin fahren Sie?, fragte die Frau mit dem Gesichtchen.
Bis Frankfurt.
Beruflich?
Ja.
Was machen Sie beruflich?
Was ich beruflich mache, wiederholte Böwe und holte Luft, ich reise viel, im Moment wenigstens, sagte er.
Ich auch, sagte die Frau ihm gegenüber und sah aus dem Fenster dabei.
Böwe war noch nie in Paris oder London oder Amerika gewesen. Er war noch nie irgendwo gewesen, wo man eine andere Sprache sprach. Nur einmal in Holland, mit Liz. Aber da hatte er die Menschen gut verstanden, die Sprache war wie Plattdeutsch daheim gewesen. Liz war auf zu hohen weißen Riemchenschuhen durch die Klosteranlagen am Hafen und dann auf Nylonstrümpfen über den Strand von Scheveningen gelaufen, die Schuhe wie eine Handtasche unter dem Arm. Böwe hatte nicht einmal Schuhe oder Anzugjacke ausgezogen, trotz der Hitze. Er hatte immer woanders hingeschaut als Liz, um nicht mit ihr streiten zu müssen. Ja, seine Liz hatte nach zwei Tagen bereits Heimweh und er an ihrer Seite Fernweh bekommen. Denn Liz sah die Welt grundsätzlich anders als er. Sie sah gar nicht erst richtig hin. Zum ersten Mal hatte er da gedacht, dass jeder von ihnen ein so kleines Leben führte, so klein, dass ein anderer kaum Platz darin fand. Auf der Strandpromenade dann hatten sich zwei Tauben gepaart, und er und Liz hatten beide wieder woanders hingeschaut.
Ja? Die Frau schob aufmunternd die Hände über die weiße Tischdecke an ihrem Weinglas vorbei in seine Richtung. Sie reisen auch, das ist aber ulkig.
Sie hatte ulkig gesagt, und das Wort passte gar nicht zu ihr. Das passte nur zu billigen Personen.
Was machen Sie denn?
Sein Gesicht zog sich merkwürdig in die Breite. Ich bin Schriftsteller, hörte er sich am Ende eines unsicheren Lächelns sagen, aber so langsam, dass er es noch mitten im Satz hätte verhindern können. Das war keine Lüge, würde er sich später trösten. Das war eine Erfindung, und erfinden war nicht lügen. Danach schaute er angestrengt aus dem Fenster, denn er fürchtete, sie könnte gleich nach seinem Namen fragen, und ihm würde außer Goethe, Edzard Schaper und Heinrich Böll nichts einfallen.
Schriftsteller, sagte die Frau so langsam, wie er gelächelt hatte. Schriftsteller? Sind Sie dafür nicht zu jung?
Der Punkt ist der, sagte er und stockte. Er dachte an sein Lieblingsbuch, »Die geheimen Verführer«. Für den Griff ins Unbewusste, sagte er, braucht man erst einmal Know-how und nicht unbedingt Erfahrung.
Know-how? Sie sprechen Englisch?, sagte die Frau. Böwe wurde rot und merkte, wie er nickte.
Sie waren in England?
Er nickte.
Das ist aber ulkig, ich auch, sagte die Frau.
Schon wieder dieses alberne Wort!
Wann waren Sie denn dort, wenn ich fragen darf, sagte er rasch, bevor sie weiterfragen konnte.
Ich war drei, als meine Eltern und ich nach England gingen.
Böwe starrte auf ihr Haar, und das Wort, das er gesucht hatte, fiel ihm ein. Baltisch blond, dachte er, sie ist baltisch blond, und erst als er das Wort baltisch gefunden hatte, glaubte er zu verstehen, was sie mit England meinte.
Dann sind wir ja ungefähr gleich alt?, sagte er verlegen, um nichts über die Sache mit England sagen zu müssen. Für einen Augenblick glaubte er in ihrem Gesicht ein Entsetzen zu sehen. Bisher hatten sie sich verstanden, weil sie nichts voneinander wussten. Jetzt war es anders.
Ja, sagte sie, das sind wir. Und sonst?
Es dauerte eine Zeit, bis sie einander wieder ansehen und weitersprechen konnten. Von seinem Platz im Speisewagen aus betrachtet, schien im Himmel bereits Schnee zu hängen. Er roch ihr Parfum, und solange er nicht hinsah, glaubte er, ihren Geruch in der Nase, sie sehe jemandem ähnlich. Trotzdem hatte sie so etwas Fremdes.
Als die ersten Häuser von Frankfurt auftauchten, berührten sich ihre Füße unter dem Tisch. Er zuckte als Erster zurück, als hätten sie sich aus Versehen geküsst, und fragte, wie sie denn heiße. Da hatte sie schon nach ihrer Kamera gegriffen und in sein Gesicht hinein abgedrückt.
Wie heißen Sie?, fragte er noch mal.
Und Sie?
Leo.
Leo Tolstoi? Sie lachte, er nicht.
Und, darf ich?
Was?
Ihnen das Foto schicken?
Wohin?
Nach Hause vielleicht?
Böwe wurde wieder rot, als er Nein sagte.
Sie stand auf, zog den Mantel an und ging zur Tür, obwohl der Zug noch nicht in den Bahnhof eingefahren war. Sie stand in dem zugigen Teil zwischen den Waggons, noch gut sichtbar, aber schon weit weg. Die Diagonale zwischen ihnen sagte, dass etwas falsch war. Großstadtfrauen. Er schaute auf den leeren Platz gegenüber. Der Ort, an dem sie sich aufgehalten hatte, blieb ohne sie zurück. Die Tischdecke verwelkte.
Großstadtfrauen. Lou war auch so eine gewesen, sie kam aus Berlin. Leo Böwe wohnte mit seiner Mutter damals unten im Haus im Hinterzimmer des Lebensmittelgeschäfts. Das war kurz nach dem Krieg. Wenn er seine Schulaufgaben machte, konnte Böwe Lou im Laden auf den Steinkacheln mit ihren Sandaletten herumklappern hören und sich vorstellen, wie sie in ihrem weißen Kittel durch den Laden streifte, von der Obsttheke zur Fleischtheke, weiter zur Käsetheke und dabei den Bleistift mit der Zunge befeuchtete, bevor sie die nächste Summe auf den Rechnungsblock schrieb. Manchmal saß sie auch an der Kasse und zerzauste den kleinen Jungen, die mit Einkaufszetteln kamen, das Haar. Aber die waren alle jünger als er. Nach der Arbeit ging Lou in ihre Mansarde hinauf, barfuß, auch wenn es kalt draußen war. Die Schuhe in den Händen, schlug sie die Absätze rhythmisch gegeneinander und summte etwas, das das Haus für einen Moment zu einem anderen Haus machte.
Berlin ist meine Heimat, Berlin!, sagte Lou. Sie war achtundzwanzig, Böwe sechzehn. An einem Sonntagnachmittag stand er mit Sparschwein vor ihrer Mansardentür, um sie zu fragen, ob sie ihn nicht erlösen könnte von seinen ungefähren Träumen.
Ich will dein Sparschwein nicht, sagte Lou. Sie zündete sich eine Zigarette an. Komm rein, Kleiner.
Wir haben hier auch mal gewohnt, hier oben, sagte er.
Na, weit bist du dann ja noch nicht gekommen.
Und Sie, waren Sie schon mal am Meer?
Und du, schon mal in Berlin gewesen, Kleiner?
Lou hatte ein blaues Sofa, und ihre Fingernägel hatten die gleiche Farbe wie ihre Bluse. Sie roch nach Birke, wenn sie die Arme hob. Ihre Achseln waren rasiert. So etwas hatte Böwe noch nie gesehen. Er setzte sein schiefes Lächeln auf, und Lou schaute kurz interessierter. Er fuhr mit der Hand über sein Kinn, als müsse er sich endlich mal rasieren, und ging an das kleine Fenster, das auf den Hof führte. Er sah hinunter auf die Mülltonnen und auf die schwarze BMW des Hausbesitzers.
Hier, sagte er, habe ich mit zwei mal gesessen und die Beine hinausbaumeln lassen.
Ja, sagte Lou, wir wissen nicht immer, was wir tun.
Ich hätte hinausfallen und tot sein können, sagte Leo, meine Mutter musste sich von hinten anschleichen und mich packen, bevor ich sie bemerkte. Lou lächelte leer, und Leo Böwe zweifelte plötzlich daran, dass er ein ungewöhnlicher Mensch sei mit ungewöhnlichen Phantasien, und dass er deshalb auch ungewöhnliche Bedürfnisse haben dürfe.
Ich geh dann mal wieder, sagte er. Sie gab ihm die Hand.
Und Tschö!
Wiedersehen, sagte er.
Er legte sich im Hinterzimmer des Ladens auf den Boden und betrachtete den deutlichen Weg im Linoleum von der Tür zur Anrichte. Ein Trampelpfad, denn alle aus dem Laden bedienten sich in der Mittagspause beim Geschirr und Besteck seiner Mutter. Auch Lou. Sie spülte als Einzige nachher nicht ab. Mit dem Kopf neben dem Trampelpfad dachte Böwe an Eingeweide und nahm sich vor, Lou eines Tages zu bestrafen. Wie, das war ihm in dem Moment nicht ganz klar. Tage später ging er in den Laden, ohne einen Einkaufszettel seiner Mutter. Lange suchte er in der Umgebung der Kasse herum, hinter der Lou saß. Dann kaufte er sich einen Kamm und schob ihn vor Lous Augen sehr langsam in seine Gesäßtasche. Lou strahlte ihn dabei an.
Na, kleiner Böwe?, sagte sie.
Eigentlich hatte da alles angefangen.
***
Vier Wochen später hatte Böwe sich an Frankfurt gewöhnt. Er lief mit Brustbeutel unter dem gerippten Unterhemd durch den Bahnhof, mit dem Unterhemd unterm Nylonhemd, mit dem Nylonhemd unter dem Schlips, er lief mit seinem dunkelblauen Schlips und Windsorknoten, den er sonst nur sonntags trug, und über all den dünnen Schichten spannte sich sein Anzug. Der Anzug war neu, und ein Geruch nach Kunstfaser stieg Böwe bei jeder Bewegung in die Nase. Aber die Schuhsohlen waren aus Leder. Seine eigelbblonde Schwägerin arbeitete in einem Schuhgeschäft, das bedeutete: Einkaufspreis. So musste er nicht auf Kreppsohlen, also auf Radiergummi, wie er immer sagte, in die Welt hinaus. Die Welt? Mann! Böwe lief geschäftig durch den Hauptausgang des Frankfurter Bahnhofs, Richtung Kaiserstraße. Hier stieß die Kaiserstraße senkrecht auf den Bahnhof. Da, wo er herkam, gab es auch eine Kaiserstraße, aber die verlief parallel zu den vier Gleisen eines Kleinstadtbahnhofs. Parallelen, das waren zwei Geraden, die sich erst im Unendlichen berührten, wusste Böwe aus dem Mathematikunterricht.
Er wartete auf die Straßenbahn Nummer 17, die zum Hotel am Berg fuhr. Alle Nummern kamen, nur die 17 nicht, und Böwe beschloss, erst einmal in sein Büro zu gehen, die Kaiserstraße hoch, bis zur Zeil. Danach war es nur noch ein kleines Stück bis zum Hotel.
Männer sprangen leise aus den Bahnen neben ihm, wie man nur in einer Großstadt aus der Bahn springt, gaben den Zeitungsverkäufern auf der Verkehrsinsel im Vorbeilaufen abgezähltes Geld, schoben sich Rundschau, Neue Presse, Allgemeine unter den Arm und holten manchmal mit wenigen Schritten eine Frau ein, die mit ihrem Einkaufsnetz schon vorausgelaufen war, in dünnen Strümpfen, so dünn, als seien die Beine nackt. Irgendwo in der Nähe setzte sich vielleicht gerade jetzt eine baltisch blonde Frau auf ein Hotelbett und zog ihre Strümpfe aus, wobei sie sich auf den Rücken legte, die Beine in die Luft streckte und eine Weile so liegen blieb, zerschlagen nach einer ihrer vielen Zugfahrten, dachte Böwe.
Es war bereits dunkel. Die gebogenen Lichtmasten in der Kaiserstraße hatten Jugendstilornamente, aber keine Leuchten mehr. Schwarz standen sie vor einem dunkelgrauen Himmel. Böwes Köfferchen war nicht schwer. Er ging vorbei an einem zerbombten Wohnhaus, kein Haus, ein Knochen. Er ging am nächsten Haus vorbei, an dessen Restwänden aufstrebende Firmen auf sich aufmerksam machten, ging vorbei an einer Reihe neuer, aber schon klappriger Pavillons, und an jener Bierstube, die von acht Uhr früh bis Mitternacht warme Küche anbot.
Gegen eine fensterlose Mauer hatte ein Künstler seine strichdünnen Menschen aus buntem Metall geworfen, ein Haufen Mikadostäbchen, die Böwe an das Wandmosaik der katholischen Volksschule zu Hause denken ließen, an dem Liz und er jeden Sonntag vorbeikamen auf ihrem Weg zum Friedhof. Ein Reigen gesichtsloser Kinder umtanzte auf dem Mosaik einen ebenso gesichtslosen Mann, der ein Lineal in der Hand aufrecht hielt. Was machten Liz und er eigentlich jeden Sonntag auf dem Friedhof? Das Mosaik war für Böwe der Inbegriff seiner Sonntagnachmittage geworden, blass und leer und immer ein bisschen verregnet. Sonntags trug Böwe einen Raum aus Angst in sich. Natürlich hätte Liz das nicht verstanden, wenn er mit ihr darüber geredet hätte. Er würde seine Angst nie in ihr wecken können.
Böwe lief schnell die Kaiserstraße hinauf. Plötzlich ging ein Fremder dicht neben ihm, aber Böwe wurde deswegen nicht noch schneller. Er machte nur größere Schritte.
Brauchen Sie eine Schreibmaschine?
Eine was? Böwe blieb nicht stehen. Eine sehr junge Frau ging eilig an ihnen vorbei, mit einem Käppchen am Hinterkopf, das sie mit ziemlich vielen Nadeln festgemacht haben musste.
Eine Olivetti, sagte der Fremde, ich kann Ihnen günstig eine verkaufen. Sie kennen doch die Olivetti, die neue?
Böwe blieb nun doch stehen und musterte den Fremden. Der zog die Hände aus den Manteltaschen. Solche Hände hatte Böwes Chef auch. Es war viel Fleisch an ihnen, kleine, bleiche, fast silbrige Hände, mit denen man höchstens Kuchen aussuchen oder Hamster streicheln konnte. Aber diesen Schatten des Fremden, diesen Schatten auf dem Asphalt, hatte er den nicht schon mal gesehen? Im Kino vielleicht?
Böwe schüttelte den Kopf. Der Fremde ließ enttäuscht, aber freundlich die Schultern fallen.
Und die Nitribitt?, fragte der Fremde. Sein Ton war sachlich und nachdenklich.
Nein, sagte Böwe, ich will auch keine Nitribitt kaufen, und überhaupt, die Marke kenne ich gar nicht.
Es roch nach Autoabgasen in dem Moment, und der Fremde hatte sich eine Zigarette angezündet, die nach Nelke duftete. Mein Gott, ja, was er alles noch nicht kannte, dachte Böwe. Er strich sich über das Hemd, fühlte den Beutel und hätte jetzt gern ein Bier gehabt. Es war plötzlich so kalt, kälter als Oktober oder November, und die Kälte war nicht von hier. Es war eine dortige Kälte. Da griff der Fremde nach ihm und hielt ihn am Ärmel fest.
Nitribitt, wiederholte er.
Nitribitt, sagte Böwe. Ist die … ist die auch neu?
Neu nicht, sagte der Fremde, aber tot.
Es war der 31. Oktober 1957, kurz nach sieben. Es war Böwes viertes Wochenende mit Sonderauftrag in Frankfurt.
Ja dann, einen schönen Abend noch, sagte er abrupt, weil ihn der Tod einer Schreibmaschine nicht interessierte.
Ja dann, sagte der Mann, schade, und blieb noch einen Moment stehen. Er nickte sorgenvoll, aber seine Augen blieben ausdruckslos wie schwarze Knöpfe, in denen es Böwe schon nicht mehr gab.
Böwe wechselte die Straßenseite und wusste selbst nicht, warum. Der Gehsteig kam ihm leer vor, als sei es bereits Stunden später und tiefe Nacht. Der Wind blies kalt.
Sein Pfeffer-und-Salz-Köfferchen setzte Böwe bei der Tür ab. Das Büro war überheizt. Ohne Licht zu machen, öffnete er das Fenster gegenüber dem Schreibtisch und sah hinaus. Draußen schickten Autos Lichtbänder über die Straße, und an der Haltestelle der Linie 12, die Allerheiligen hieß, steckten zwei Männer die Köpfe zusammen und gaben einander Feuer.
Allerheiligen, war das nicht morgen? Trotzdem würden morgen die Vertreter kommen und ihre wöchentliche Auszahlung abholen. Allerheiligen war kein Feiertag in Frankfurt.
Böwe warf seinen Mantel zielsicher vom Fenster aus auf einen Stuhl bei der Tür, obwohl er das hier noch nie getan hatte, und setzte sich eine Weile hin, in die kalte Luft. Er machte noch immer kein Licht.
Die Kommunistische Partei Deutschlands war im Jahr zuvor verboten worden, und Böwes Chefs Fritz und Franz hatten das Büro mit Mobiliar und Gummibaum übernommen für besondere Geschäfte, zu denen auch Böwes Sonderauftrag gehörte. Sie hatten die Räume nicht gestrichen, nur die Bilder von Marx und Engels heruntergenommen und über die weißen Schatten an der Wand ihre eigenen Porträts gehängt. Ihre identischen Gesichter in den identischen Rahmen blickten lächelnd über Böwes Schreibtisch hinweg.
Warum haben Sie denn den Chef doppelt aufgehängt?, hatte letzte Woche der Hausmeister gefragt, und Böwe hatte köstlich, köstlich gerufen und dem Mann am frühen Freitagmorgen einen Asbach uralt spendiert, ohne mit dem Lachen aufzuhören. Die Büroeingangstür aus Holz hatten Fritz und Franz Locke gegen eine elegante Milchglasscheibe ausgetauscht. Über die neue Glastür warf sich kühn ein moderner Schriftzug: »LOCKE automatik«. Darunter die Grafik, ins Glas geschliffen, zeigte die Choreographie zwischen einem menschenleeren, aber aktiven Herrenschlafanzug, welcher einem ebenfalls leeren, doch anmutigen Damennegligé in den Nacken griff. Der Anzug ohne Kopf warf das Negligé ohne Kopf in den LOCKE-Toplader. Der Entwurf war von Böwe. Ein Künstler, unser kleiner Böwe, hatten die Zwillinge gesagt, ihn für diese moderne Kopflosigkeit gelobt und Liz dafür einen Präsentkorb mit Sekt geschickt.
Hatte er wirklich geschrien, heute Nacht?
Wenig Licht fiel von der Straße in den Raum. Böwe rückte die grüne Schreibtischunterlage zurecht und spitzte Bleistifte an. Er dachte, dass er sich eines Tages vielleicht gern an diese Zeit erinnern und sie seine Frankfurter Zeit nennen würde. Dabei fühlte er sich plötzlich so sehnsüchtig, als sei die Zeit bereits vorbei.
Hinter der Milchglastür erschien die dunkle Silhouette eines Mannes mit Hut.
Warum sitzen Sie denn im Dunkeln, mein kleiner Böwe?
Das Deckenlicht flammte auf, und Nobis ließ seine Hand einen Augenblick am Schalter.
Nobis verkauft seine fünfzehn Waschmaschinen in fünf Tagen, hatte Franz Locke zu Böwe gesagt, oft doppelt so viel wie die Kollegen. Nobis war weder sympathisch noch unsympathisch, aber er weckte sofort Interesse.
Er verkaufte, wie die anderen, an der Haustür an Frauen, die schon die ersten Spuren des Alters im Gesicht hatten und sich selbst dafür verachteten. Nobis war einer, bei dessen Anblick sie davon träumten, die Nacht woanders zu verbringen, in einem Hotel mit dunkel getäfelten Wänden, schweren Teppichen, dickem Gästebuch, um danach, in diesem wunderbaren Danach im BH am Fenster zu stehen, rauchend, sodass das Gesicht wieder warm aufleuchtete wie früher. Aber ihre Hände waren längst ruiniert. So kauften sie Waschmaschinen, von Nobis. Er war Teil des Traums, und dafür bezahlten die Frauen gern, fast immer in Raten zu 20 oder 30 Mark im Monat, eine Summe, so gering, dass die hohe Verzinsung nicht auffiel. Manche zahlten auch gern für die Hoffnung, in den zwei oder drei Jahren des Abzahlens Nobis noch einmal wiederzusehen, mit dem sie an irgendeinem Nachmittag in irgendeiner Küche durch den Kaufvertrag eine fast zärtliche Beziehung eingegangen waren, auch wenn am Abend der Mann den Kaufvertrag mit unterschreiben musste. Locke akzeptierte keine Unterschrift von Ehefrauen. Ehefrauen verdienten nicht das Geld. Nobis verdiente 2000 Mark in der Woche, manchmal wenigstens, und Böwe 583,23 Mark im Monat. Er mochte Nobis, doch er fragte sich bei dessen Anblick, für wen der Mann eigentlich lebte.
Böwe ging zum Fenster, um es bis auf einen Spalt wieder zu schließen. Gegenüber, über der Toreinfahrt Nummer 54, hing in einer Wohnküche eine hässliche Lampe von der Decke.
Was ist, kleiner Böwe? Nobis war hinter ihn getreten und schlug ihm auf die Schulter.
Traurig? Liebeskummer? Lassen Sie sich sagen, kleiner Böwe, sagte Nobis so, als hätten sie schon eine Weile miteinander gesprochen, die Liebe ist eine rein körperliche Angelegenheit, eigentlich eine Art Hygiene. Sex finden Sie überall. Denken Sie dabei nicht sofort an Liebe. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit einem Mädchen ein, zwei Monate und stellen dann fest, es war Zufall, dass es gerade die war. Denn gerade die war es nicht. Die andere, ihre Freundin vielleicht, gefällt Ihnen mittlerweile viel besser. Was machen Sie dann?
Ich bin verheiratet, sagte Böwe und drehte das Gesicht weg. Es war das Gesicht des Mannes mit dem Lineal, das größte in der Mitte des Wandmosaiks. Ein Gesicht wie ein Brot.
Über der Toreinfahrt 54 hatte sich das erleuchtete Fenster geöffnet.
So was, sagte Nobis.
Was?
Verheiratet?
Ja, verheiratet, sagte Böwe. Ein und ein halbes Jahr, und davor sind wir fast fünf Jahre miteinander gegangen.
O Gott, sagte Nobis, fünf Jahre, was das für Werbungskosten sind.
Aus dem Fenster über der Nummer 54 beugte sich eine ältere Frau und hob einen dicken Dackel neben sich auf das Fensterbrett. In dem Moment klingelte das schwarze Telefon auf dem Schreibtisch. Böwe ging hin. Kontrollanruf. Es war sein Chef Franz, und Nobis machte Zeichen, dass er nicht mit ihm sprechen wolle, sondern legte behutsam seine Kaufverträge neben das Telefon, um dann zur Tür zu schleichen. Dabei drehte er sich noch einmal um, schlug den Mantelkragen hoch und grinste Böwe an. Kurz verharrte sein mächtiger Körper in der Tür und füllte den ganzen Rahmen aus.
Dicht beim Gummibaum stand eine staksige Stehlampe. Die knipste Nobis auch noch an, bevor er die Tür schloss. Dann blieb Böwe allein im Licht zurück, lachte angestrengt ins Telefon und setzte sich gerade hin, wie ein Hund.
Danach rief er Liz an.
Wir stricken gerade, sagte sie, außer Atem.
Es gab im ganzen Haus nur ein Telefon, und das hing vier Stockwerke tiefer, unten im Lebensmittelgeschäft.
Liz und ihre Mutter saßen und strickten oft, wenn Böwe am späten Nachmittag von der Arbeit kam. Sie hatten sich nicht viel zu sagen, und Böwe fürchtete, wenn er die beiden Frauen so sah, dass auch er eines Tages anfangen würde zu stricken, Seite an Seite mit seiner strickenden Frau.
Und was machen wir jetzt Schönes?, rief er schon vom Flur aus und starrte noch immer im Mantel auf den Rest süßen Stuten, den seine Schwiegermutter immer zum Wochenende mitbrachte, seitdem Liz und er verheiratet waren.
Seine Schwiegermutter stand bei der Frage sofort auf und nahm ihrer Tochter den Teller weg. Liz strickte weiter, obwohl Leo an den Tisch kam und sie auf den Mund küsste. Was hatten sie sich vorgestellt, als sie heiraten wollten? Nichts. Und erträumt? Gar nichts. Die Hochzeit war das Endziel gewesen. Dass nach der Hochzeit eine Ehe kam, damit hatten sie nicht gerechnet. Als am Tag danach die Reste vom Fest weggeräumt, die weißen Tischdecken in der Waschküche eingeweicht, Akkordeon und geliehenes Geschirr zurückgebracht und die Fenster zur Straße und zum Hof zum Lüften geöffnet worden waren, wurde das Licht in dem Zimmer, in dem sie saßen, langsam grau. Liz und Leo Böwe saßen schweigend nebeneinander, ohne Trost in einer Berührung zu suchen. Ein kalter Ofen konnte nicht kälter sein. Später fanden sie ein Mittel, um mit dem grauen Licht umzugehen. Sie machten sich eine Kanne Kaffee und tranken sie Tasse um Tasse leer.
Lass uns ins Kino gehen, heute Abend!, sagte Böwe zu Liz, während seine Schwiegermutter bereits ihren hässlichen Hut aufsetzte und ihre Gummiüberschuhe anzog. Leo zwinkerte Liz zu.
Es war fünf Uhr nachmittags. Sie hatte kleine Brüste, die fast so hoch saßen, wie der BH es wollte, einen flachen Bauch und ziemlich kräftige Beine, die sie nicht rasierte. Sie trug nie Bikini, sie ging nie ins Schwimmbad, sie konnte nicht schwimmen. Ihre Mutter fand Schwimmen unmoralisch. Liz war sehr hübsch, wenn auch auf eine provinzielle Art. Selbst wenn sie sich modisch kleidete, mit Handschuhen, Hut, Stola, schwarzem Samttäschchen und Perlenband, verlor sie nicht diesen kindlichen, bäurischen Blick, in dem die Welt still stand, egal, ob sie gerade gut oder schlecht war. Er hatte sich dieses Mädchen ausgesucht.
Komm her, mein Mädchen, sagte er und ging auf das Sofa zu, kurz fiel sein Blick auf das Bild darüber. Ein Kunstdruck, »Rote Pferde«. Und kurz darauf liebten sie sich auf dem Boden, ein wenig ungeschickt wie immer, und sie mit geschlossenen Augen. Dass sie mit ihm auf der Teppichbrücke gelandet war, nahm er als Beweis dafür, ein richtiger Verführer zu sein.
Ich möchte nicht, dass du jedes Wochenende wegfährst, sagte sie, als er noch auf ihr lag. Er küsste sie. Ihr Mund schmeckte nach Mandeln. Mit den Fingerspitzen strich sie über die Teppichbrücke.
Warum?
Wenn du zu viel reist, sagte sie, wirst du bald nichts mehr fühlen.
Er schaute sie an. Der Satz war nicht rätselhaft gemeint.
Ganz sicher nicht. Er war ihr nur verrutscht und kam deswegen mit Bedeutung daher.