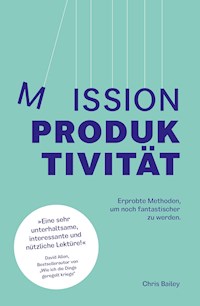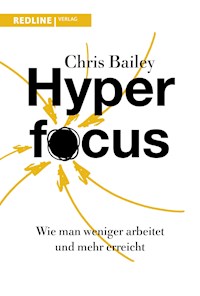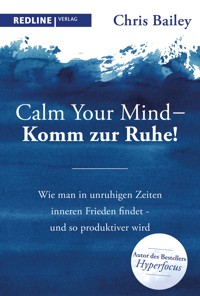
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ruhe bewahren in stressigen Zeiten Überstunden, Stress und mediale Dauerberieselung gehören im Berufsalltag schon fast zum guten Ton. Doch mehr zu arbeiten, bedeutet nicht, mehr zu leisten – im Gegenteil: Viele sind überfordert von nicht enden wollenden To-do-Listen oder fühlen sich zunehmend ausgebrannt und rastlos. Der Produktivitätsexperte Chris Bailey weiß aus der eigenen Erfahrung eines Burnouts: Das Geheimnis eines produktiven Lebens besteht darin, in ausreichend Ruhe zu investieren. Er zeigt, was wir tun können, um versteckte Stressquellen in unserem Alltag zu beseitigen, wie man sich durch »Stimulationsfasten« vom Dauerbeschuss der digitalen Welt erholt, und erklärt, wie man lernt, ohne Schuldgefühle zu entspannen. Es geht schließlich darum, zur Ruhe zu kommen, um nicht nur konzentrierter und überlegter zu arbeiten, sondern auch zufriedener und glücklicher durchs Leben zu gehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Chris Bailey
Calm Your Mind Komm zur Ruhe!
Chris Bailey
Calm Your Mind Komm zur Ruhe!
Wie man in unruhigen Zeiten inneren Frieden findet – und so produktiver wird
Übersetzung aus dem Englischen von Almuth Braun
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2023
© 2023 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe by Chris Bailey
Die englische Originalausgabe erschien 2022 bei Penguin LIfe, einem Imprint der Penguin Publishing Group, einer Einheit von Penguin Random House LLC unter dem Titel How to calm your mind.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Almuth Braun
Redaktion: Anne Horsten
Umschlaggestaltung: Maria Verdorfer
Umschlagabbildung: white snow/ Shutterstock
Satz: Daniel Förster
eBook by tool-e-byte
ISBN Print 978-3-86881-948-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-542-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-543-1
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für meine Familie
Du bist der Himmel. Alles andere – ist nur Wetter
PEMA CHÖDRÖN
INHALT
VorwortWarum wir innere Ruhe brauchen
1. KapitelDas Gegenteil von Ruhe
2. KapitelLeistungsstreben
3. KapitelDie Burn-out-Gleichung
4. KapitelNach mehr verlangen
5. KapitelReizüberflutung
6. KapitelReizabstinenz
7. KapitelGehen Sie den analogen Weg
8. KapitelRuhe und Produktivität
9. KapitelInnere Ruhe – das Fundament für ein produktives und zufriedenes Leben
Danksagung
Über den Autor
Quellenverzeichnis
VORWORTWARUM WIR INNERE RUHE BRAUCHEN
Ich wollte dieses Buch eigentlich gar nicht schreiben. Vor einigen Jahren erlitt ich einen schweren Burn-out und bekam kurze Zeit später während eines Auftritts vor ungefähr 100 Menschen eine Panikattacke (mehr darüber im ersten Kapitel). Um meine geistige Gesundheit zu bewahren, beschäftigte ich mich daraufhin intensiv mit der wissenschaftlichen Forschung rund um das Thema Ruhe. Dafür wälzte ich Zeitungsartikel, sprach mit Forschern und führte Eigenexperimente durch, um die Ideen, auf die ich gestoßen war, selbst auszuprobieren und meinen Geist zu beruhigen.
Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, über Produktivität zu schreiben, und das mache ich wirklich gerne. Inmitten meines Burn-outs und meiner Angstzustände schwankten meine Gedanken jedoch zwischen Rastlosigkeit und Verunsicherung. War ich überhaupt befugt, anderen Ratschläge zu erteilen, da ich mich ausgerechnet dann, wenn ich meine selbst empfohlenen Produktivitätsstrategien anwendete, erschöpft, nervös und unruhig fühlte? Irgendetwas stimmte da nicht.
Nachdem ich tief in die entsprechende Forschung eingetaucht war, stieß ich glücklicherweise auf eine ganz andere Idee als die, welche ich mir selbst eingeredet hatte. Zunächst aus schierem Selbsterhaltungstrieb, aus dem schon nach kurzer Zeit eine unstillbare Neugier wurde, entdeckte ich, dass der als ruhig bezeichnete Geisteszustand ausgesprochen missverstanden, um nicht zu sagen, gar nicht verstanden wird. Zwar ist es richtig, dass es in unserer Verantwortung liegt, mit nervöser Anspannung oder innerer Unruhe - dem Gegenteil von Ruhe - umzugehen, allerdings sind zahlreiche Faktoren, die dieses Gefühl der inneren Unruhe auslösen, gar nicht für das bloße Auge sichtbar. Deswegen sind sie so schwer auszumachen und noch schwerer zu bekämpfen.
Sicher bin ich nicht der einzige Mensch, der sich unruhiger und angespannter fühlt als früher. Ich schreibe diese Zeilen im Jahr 2022 - nach zwei besonders belastenden Jahren. Wenn auch Sie Anspannung und innere Unruhe verspüren, sollten Sie wissen, dass Sie nicht allein sind, und deswegen nicht zu hart mit sich ins Gericht gehen. Manche Quellen der inneren Unruhe (und des Stresses) sind leicht auszumachen, zum Beispiel die globale Pandemie, Nachrichten über Kriegsgeschehen oder ein überaus fordernder Job. Viele andere Quellen sind hingegen nicht greifbar, darunter auch die, über die wir in diesem Buch sprechen werden. Zu diesen Faktoren gehören das Ausmaß unseres eigenen Leistungsstrebens, die zahlreichen, im Alltag versteckten, unsichtbaren Belastungsquellen, die Reizüberflutung, der wir uns regelmäßig aussetzen, wie wir mit den sechs »Burn-out-Faktoren« umgehen, unser persönlicher Reizpegel, die Zeit, die wir in der digitalen im Vergleich zur analogen Welt verbringen und sogar unsere Ernährung. Diese Quellen der nervösen Anspannung sind die metaphorischen Drachen, gegen die ich auf meinem Weg zu innerer Ruhe kämpfen musste.
In diesem Buch werde ich diese und weitere Ideen ausführlich darlegen. Zum Glück gibt es praktische Taktiken - viele davon sofort umsetzbar -, die Ihnen dabei helfen Ihre innere Anspannung und Ihren Burn-out zu überwinden und Ihre innere Ruhe wiederzufinden.
Mit fortschreitendem Erfolg meiner Experimente, um Stress und Burn-out anzugehen, und als ich geistig ruhiger wurde, stellte ich erleichtert fest, dass meine erteilten Produktivitätstipps nicht falsch waren. Allerdings hatte ein maßgebliches Mosaiksteinchen im gesamten Produktivitätsbild gefehlt.
Die Ratschläge zur Steigerung der Produktivität funktionieren. Gute Empfehlungen (es gibt auch viel heiße Luft) tragen dazu bei, dass wir unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit und unsere Energie kontrollieren können. Damit schaffen wir in unserem Kopf und unserem Terminkalender Raum für die wirklich wichtigen Dinge, und das bereichert unser Leben.
Außerdem können wir auf diese Weise Stress reduzieren und bleiben zugleich immer auf dem Laufenden. Angesichts der vielen Bälle, die wir heute gleichzeitig in der Luft halten müssen, ist das wichtiger denn je. Entscheidend ist aber auch, die Fähigkeit einer gesunden Produktivität in unserem Berufsund Privatleben zu entwickeln. Denn wenn wir so angespannt sind, dass wir kurz vor einem Burn-out stehen, sinkt unsere Produktivität unmerklich.
In innere Ruhe zu investieren ist der richtige Weg, um unsere Produktivität zu erhalten und sogar zu steigern. Wenn es uns gelingt Ruhe zu finden und unsere innere Anspannung zu lösen, fühlen wir uns in uns selbst wieder zu Hause – körperlich und geistig. Auf diese Weise erweitern wir unser tägliches Energiereservoir, arbeiten produktiver und steigern unsere Lebensqualität. Wenn wir mehr Ruhe in unseren Alltag bringen, ergänzen wir das fehlende Mosaiksteinchen, das unser berufliches und privates Streben nach einem ressourcenschonenden Leben unterstützt. Die entsprechenden Ideen in diesem Buch vorzustellen gab mir das Gefühl, alle meine bisherigen Produktivitätstipps mit einem befriedigenden Klick richtig einordnen zu können.
Im Verlauf meines Wegs zu innerer Ruhe ist meine Erschöpfung und innere Anspannung gewichen und mein Produktivitätsniveau enorm angestiegen. Mit ruhigem, klarem Kopf fiel es mir relativ leicht, meine Ideen zu Papier zu bringen und miteinander zu verknüpfen. Wo ich zuvor üblicherweise einige hundert Worte geschrieben hatte, waren es nun einige tausend. Mit nachlassender Anspannung wurde ich zudem geduldiger. Ich hörte intensiver zu und konnte mich tiefer auf die Menschen und Dinge einlassen, mit denen ich mich beschäftigte. Meine Gedanken waren klar, meine Ideen schärfer umrissen und mein Handeln bewusster. Ich agierte zielgerichteter und aktiver, und meine Aufmerksamkeit ließ sich nicht mehr von äußeren Ereignissen zerfasern. Außerdem gelang es mir mehr in Einklang mit den Zielen hinter meinen Handlungen zu kommen, wodurch ich meine Tage als sinnstiftender erlebte.
Tatsächlich ermöglicht ein ruhiger Geist enorme Produktivitätsvorteile. Und innere Ruhe können Sie immer finden, unabhängig von Ihren jeweiligen Umständen wie Zeitdruck, einem knappen Budget oder begrenzter Energie. (In Kapitel 8 werden wir beleuchten, wie viel Zeit Sie durch Ruhe gewinnen.)
Das führt uns zu einer spannenden Schlussfolgerung: Die vielfältigen geistigen Vorteile innerer Ruhe einmal außer Acht gelassen, lohnt sich der Zeitauf-wand allein schon, um die eigene innere Anspannung zu überwinden. Denn unser Produktivitätsgewinn macht diesen Zeitaufwand mehr als wett.
Auf meinem Weg zu innerer Ruhe saugte ich alles auf, was es über dieses Thema zu lernen gab, und formte es zu einem groben Konzept für dieses Buch. Ich begann diesen Prozess zögerlich, denn mir war klar, dass ich die herausfordernden, persönlichen Anteile meiner Geschichte offenbaren musste. Die Phänomene Unruhe, innere Anspannung und Burn-out sind jedoch zu weit verbreitet, als dass man sie verschweigen sollte. Indem ich über meinen Weg und meine gelernten Lektionen berichte, hoffe ich, auch Ihnen zu mehr innerer Ruhe verhelfen zu können.
Wir leben in unruhigen Zeiten. Wenn Sie nicht gerade hinterm Mond leben, dann wissen Sie, dass man sich derzeit wegen wahnsinnig vieler Dinge sorgen kann. Ich werde nicht weiter auf die Gründe eingehen (wir hören schon genug über die Probleme in der Welt), aber man kann guten Gewissens behaupten, dass es schwer ist in der modernen Welt nicht innerlich aufgewühlt zu sein.
Innere Ruhe bedeutet nicht, die Realität zu ignorieren. Vielmehr verleiht sie uns Resilienz, Energie und Durchhaltevermögen, um mit dem ständigen Wandel zurechtzukommen. Zwar wollte ich mit innerer Ruhe zunächst vor allem meine Anspannung lösen, aber inzwischen empfinde ich diesen Zustand als geheime Zutat, um mich völlig auf den Augenblick zu konzentrieren. Da uns ein ruhiger Geist produktiver macht, brauchen wir uns wegen der dafür aufgewendeten Zeit nicht schuldig zu fühlen.
Oberflächlich betrachtet, ist innere Ruhe das Gegenteil eines sexy Produktivitäts-Hacks. Doch wie die Hefe im Brot oder die Prise Salz in Ihrem Lieblingsrezept, verbessern schon kleinste Mengen an Ruhe unser Leben und tragen dazu bei, dass wir uns präsent und zufrieden fühlen.
Und tiefere innere Ruhe bringt noch wesentlich größere Vorteile mit sich: Durch sie fühlen wir uns bei allem, was wir tun, fokussiert und entspannt. Innere Ruhe erdet uns und lässt uns bewusster und engagierter handeln. Sie steigert unsere Lebensfreude und spart uns Zeit - was wollen wir mehr?
Ich hoffe, Sie werden am Ende dieses Buches dasselbe feststellen wie ich: dass innere Ruhe in einer turbulenten Welt der bestmögliche »Lifehack« ist.
1. KAPITELDAS GEGENTEIL VON RUHE
Bis vor wenigen Jahren war innere Ruhe für mich nichts, was ich bewusst gesucht hätte. Ruhe verspürte ich eher zufällig: wenn ich die Arbeit hinter mir gelassen hatte und in der Dominikanischen Republik am Strand abhing, während des Urlaubs im Kreise meiner Liebsten oder wenn zu Beginn eines langen Wochenendes keinerlei Pläne oder Verpflichtungen anstanden.
Abgesehen von solch glücklichen Zufällen war Ruhe nichts, was ich aktiv angestrebt hätte, was es mir wert gewesen wäre, danach zu suchen, oder worüber ich überhaupt nachgedacht hätte. Bis ich dann merkte, dass Ruhe in meinem Leben völlig fehlte.
Zu meinem Leidwesen weiß ich noch den genauen Tag (und die exakte Uhrzeit!), als mir klar wurde, dass mein Leben nur noch aus Trubel und Hektik bestand. Die Erkenntnis traf mich wie ein Blitz oder wie eine gusseiserne Badewanne, die durch den Boden einer baufälligen Wohnung kracht.
Wie im Vorwort erwähnt, stand ich auf einer Bühne, als es passierte.
Innere Anspannung, das Gegenteil von innerer Ruhe, zeigt sich bei jedem Menschen anders: Einige begleitet sie stets, andere bemerken sie nur selten. In meinem Fall war sie ein Phänomen, das immer im Hintergrund rumorte. An jenem Tag entlud sich die latente Anspannung, die mit dem zunehmenden Stress meiner ständigen beruflichen Reisen immer größer geworden war, in einer ausgewachsenen Panikattacke, während ich vor einem hundertköpfigen Publikum auf der Bühne stand.
Wenige Augenblicke, bevor ich die Bühne betrat, fühlte ich mich ... neben der Spur. Meine Gedanken rasten schneller als üblich. Mir war, als würde ich jeden Moment umkippen und ohnmächtig werden.
Zum Glück kam ich wieder zu mir, als ich meinen Namen hörte.
Ich erklomm die Stufen, nahm den Pointer und legte los. Nach ein oder zwei Minuten fühlte ich mich ziemlich gut, und das Schwindelgefühl hatte sich verzogen. Doch dann geschah es: Ein alles verschlingendes, erdrückendes Gefühl bemächtigte sich meines Geistes und meines Körpers, und ich fiel in ein tiefes Loch der Nervosität. Es war, als habe mir jemand eine Ampulle flüssigen Horrors in mein Gehirn injiziert. Während ich bei jedem Wort stammelte und stotterte, als hätte ich eine Handvoll Murmeln im Mund, sammelte sich Schweiß in meinem Nacken. Mein Herz raste und ich fühlte mich wieder einer Ohnmacht nahe. Die Schwindelattacke, die ich kurz vor meinem Auftritt erlitten hatte, kehrte zurück.
Ich riss mich zusammen und stolperte im Autopilotmodus durch meine Präsentation. Um nicht hinzufallen, klammerte ich mich am Rednerpult fest und entschuldigte mich bei meinen Zuhörern, indem ich meinen Zustand auf eine schlimme Grippe schob, was sie mir (dankenswerterweise) abzukaufen schienen. Wie mir schien, brachte man mir genügend Mitgefühl entgegen, um mich durch meine Präsentation zu tragen, auch wenn ich am liebsten aufgegeben und von der Bühne geflüchtet wäre. Ich beendete meine Präsentation unter verhaltenem Beifall.
Das war wie ein Sieg für mich.
Gleich nach meinem Vortrag fuhr ich gesenkten Hauptes im Aufzug zu meinem Hotelzimmer, wo ich mich auf das Queensize-Bett fallen ließ. Nachdem ich mich etwas beruhigt hatte, ließ ich die Ereignisse des Tages noch einmal Revue passieren. Alles war ein einziger Nebel, ein Gewirr aus verschwommenen, ineinanderfließenden Dingen, die sich nicht voneinander trennen ließen. Meine Fäuste ballten sich, als ich mich abmühte, meine Schwäche auf der Bühne mental noch einmal zu durchleben, und bei der Erinnerung verkrampfte ich mich.
Auch meine Ankunft im Hotel am Abend zuvor spielte ich geistig noch einmal durch. Nachdem ich nach einem langen Reisetag – einem von über-aus vielen – in mein Hotelzimmer eingecheckt hatte, nahm ich ein Bad. Das ist eine meiner Lieblingsmethoden, um mich auf Reisen zu entspannen (ein Bad und natürlich ein üppiges Essen von einem Lieferservice). Wenn ich am Abend vor einem Auftritt genug Zeit habe, lege ich mich fast immer in die Wanne und höre Nerd Podcasts, erleichtert, rechtzeitig an meinem Zielort zu sein.
Am Abend vor besagter Präsentation befand ich mich gedankenverloren in der Wanne, während sich das Wasser langsam abkühlte. Mein Blick wanderte durch das Bad zum Fön, der mit aufgerolltem Kabel auf einer Ablage unter dem Waschbecken lag, dann zu den kleinen Shampooflakons, die einen blumigen Duft verströmten, und den aufgereihten Conditionerfläschchen, und schließlich zu dem runden, metallenen Überschwappschutz vorne an der Wanne zwischen dem Abfluss und dem Wasserhahn.
In dieser runden Metallplatte spiegelte sich mein Gesicht, leicht verzerrt durch die geschwungene Oberfläche. Falls Sie auf Ihrem Smartphone jemals versehentlich in die falsche Richtung gewischt haben und sich in der Kamera plötzlich selbst erblicken, erinnern Sie sich wahrscheinlich an den Schock, den Sie empfunden haben. Genauso ging es mir mit meinem Spiegelbild, das mir von dem blank polierten Überschwappschutz entgegenstarrte. Ich wirkte müde und erschöpft und vor allem völlig ausgelaugt.
Ich erinnere mich, dass ich dachte: Ich bin wirklich nicht gut drauf im Moment.
Seit Jahren war Produktivität – das Thema, über das ich am folgenden Tag sprechen wollte – meine Leidenschaft gewesen. Ich hatte meine Karriere und zum großen Teil mein Leben auf diesem Thema aufgebaut. Selbst während ich diese Zeilen schreibe und nachdem ich den Weg eingeschlagen habe, aus dem dieses Buch entstanden ist, ist es nach wie vor meine Leidenschaft – eine Leidenschaft, die sich weiterentwickelt hat, weil ich ihr einen großen und verdienten Platz in meinem Leben eingeräumt habe.
In jenem Moment wurde jedoch etwas anderes deutlich. So wichtig dieses stets präsente Thema für mich war, und soweit ich es auch erforscht hatte, hatte ich versäumt, meinen eigenen Produktivitätsdrang einzudämmen. Ich fühlte mich angespannt, ausgebrannt und ausgelaugt wie so viele andere, die sich zu viel aufladen – so, wie Sie sich vielleicht schon ein- oder zweimal gefühlt haben.
Der Stress hatte sich in meinem Leben aufgetürmt und fand kein Ventil, um zu entweichen.
Dann erwachte ich aus meiner geistigen Rückschau, erhob mich langsam vom Bett, packte meinen Koffer, tauschte mein weißes Hemd gegen einen Hoodie, setzte Kopfhörer auf und trottete – wahrscheinlich immer noch grübelnd – zum Bahnhof, um nach Hause zu fahren.
Im Zug hatte ich Gelegenheit, noch weiter zurückzublicken.
Der Blick zurück
Als ich meine Situation analysierte, stellte ich verblüfft fest, dass ich immer geglaubt hatte, so etwas wie eine Panikattacke auf der Bühne würde einem nur passieren, wenn man sich nicht gut genug um sich selbst kümmerte.
Aber das hatte ich doch. Tatsächlich hielt ich mich für jemanden, der gut für sich selbst sorgte!
Zum Thema Selbstfürsorge gibt es unzählige Ratschläge für hart arbeitende Menschen. Vor meiner Panikattacke auf der Bühne hatte ich selbst einige praktiziert, darunter tägliche Meditation (üblicherweise 30-Minuten-Sitzungen), ein oder zwei Stille Retreats pro Jahr, mehrmalige Workouts pro Woche, Massagen, gelegentliche SPA-Besuche mit meiner Frau, Buchlektüre, Podcasts und heiße Bäder, wenn ich auf Reisen war – oftmals nach einem köstlichen indischen Essen. Mich um Selbstfürsorge zu bemühen, diente mir als Ausgleich zu meiner Leidenschaft für Produktivität, bei der es hauptsächlich darum geht den Nutzen und die Leistung bei der Arbeit zu optimieren.
Ich dachte, all das sei genug. Und mehr als das: Ich hielt mich für einen der Glücklichen, die all das tun können. Nicht jeder genießt den Luxus oder das Privileg eine Woche Urlaub zu nehmen, um in einem Meditation Retreat abzuschalten, oder hat das Budget für mehrere Massagen im Monat. Angesichts der ganzen Selbstfürsorge, der ich kostbare Zeit und Geld widmete, überraschte es mich, wie sich meine unterschwellige Anspannung zu einer ausgewachsenen Panikattacke entwickeln konnte. Mir wurde klar, dass ich mich intensiver mit diesem Thema beschäftigen musste, um wirklich Ruhe zu finden. Und so machte ich mich auf den Weg, aus dem dann dieses Buch entstand.
Gegen Ende des Jahres, meist in den Weihnachtsferien, denke ich immer gerne über das kommende Jahr nach und überlege mir, was ich bis zum folgenden Jahresende geschafft haben möchte. (Ich benutze hier mit Absicht das Futurperfekt. Ich finde, es ist eine unterhaltsame und nützliche Aktivität, um Dinge mental vorwegzunehmen und mir eine Zukunft vorzustellen, die ich noch nicht für mich geschaffen habe.) Jedes Jahr formuliere ich drei berufliche Vorhaben: Projekte, die ich beendet, Geschäftsbereiche, die ich ausgebaut, und weitere Meilensteine, die ich erreicht haben möchte. Außerdem nehme ich im Geiste vorweg, wie mein Privatleben am Ende des folgenden Jahres aussehen wird, und bestimme die drei Dinge, die ich bis dahin erreicht haben möchte.
In jenem Jahr fiel es mir leicht, drei berufliche Vorhaben zu formulieren, weil es Projekte gab, die ich bereits in Angriff genommen hatte: ein Hörbuch über Meditation und Produktivität zu schreiben (für das es eine Abgabefrist gab), meine Vorträge im besagten Jahr unterhaltsam und hilfreich zu gestalten (die Termine standen bereits fest), und einen erfolgreichen Podcast zu erstellen (denn heute gehört ein eigener Podcast doch dazu, oder?).
Zwar formulierte ich sonst auch immer drei große persönliche Vorhaben, nach dieser ungelegenen Panikattacke beschränkte ich mich jedoch auf ein einziges Ziel: herauszufinden, wie ich mich angemessen um mich selbst kümmern konnte. Dafür konzentrierte ich mich gedanklich auf eine einfache Frage: Was musste ich tun, um dauerhaft innere Ruhe zu finden?
Sondierung der Lage
Zu Beginn meines Vorhabens wollte ich ausschließlich meinen wirren Kopf klären. In dem Maße, wie das Projekt voranschritt, veränderte sich jedoch mein Blick auf Produktivität und Ruhe sowie zahlreiche damit verwandte Ideen. Hier einige Lektionen, die ich gelernt habe und auf die ich in den nachfolgenden Kapiteln eingehen möchte:
Ruhe ist Anspannung diametral entgegengesetzt.Unsere Angwohnheit, ständig nach Leistung zu streben, kann ironischerweise unsere Produktivität mindern, weil dies irgendwann zu chronischem Stress, Burn-out und innerer Anspannung führt.In den meisten Fällen verursachen wir unseren Burn-out nicht selbst. Und was noch besser ist: Es gibt wissenschaftlich erprobte Methoden, einen Burn-out zu überwinden. Daneben bieten sich Wege an, das Phänomen des Burn-outs zu analysieren, um die eigene Situation besser zu verstehen, indem wir zum Beispiel untersuchen, wie wir bei den sechs »Burn-out-Faktoren« abschneiden, und auf die eigene »Burnout-Schwelle« achten.In der modernen Welt müssen wir uns einem gemeinsamen Feind stellen: unserem Bedürfnis nach Dopaminausschüttung. Dopamin ist ein neurochemischer Botenstoff in unserem Gehirn, der uns verleitet, uns mental übermäßig zu stimulieren. Unsere »Reizüberflutung« zu verringern, die sich danach richtet, wie vielen dopamingetriebenen Reizen wir uns regelmäßig aussetzen, bringt uns der inneren Ruhe näher.Zahlreiche Stressquellen in unserem Leben sind auf den ersten Blick nicht erkennbar, lassen sich aber wunderbar per Reizentwöhnung beseitigen, auch »Dopaminentgiftung« genannt. Indem wir unsere geistige Reiztoleranz neu ausrichten, werden wir ruhiger, entspannter und vermeiden einen Burn-out.Fast alle Gewohnheiten, die uns innere Ruhe bescheren, stammen aus der analogen Welt. Je mehr Zeit wir in der analogen und je weniger wir in der digitalen Welt verbringen, desto ruhiger werden wir. Am besten entspannen wir uns in der analogen Welt, wenn wir im Einklang mit der naturgegebenen Programmierung unseres Gehirns handeln.Wir können gleichzeitig innere Ruhe und Produktivität anstreben. Wenn wir bewusster und absichtsvoller arbeiten, steigt unsere Produktivität. Wenn unsere Gedanken dagegen unruhig in alle Richtungen schießen, lässt unsere Produktivität nach. Es gibt sogar Methoden, um zu berechnen, wie viel Zeit wir gewinnen, wenn wir uns um innere Ruhe bemühen.Eine der wichtigsten mentalen Veränderungen, die ich vornehmen würde, geht mit dem letzten Punkt, der Produktivität, einher und steht damit über jeder Einzellektion. Angesichts unserer extrem turbulenten Welt fand ich schließlich heraus, dass der Pfad zu einer höheren Produktivität direkt über die innere Ruhe führt.
Auf meinem Weg zu innerer Ruhe stieß ich auf zahllose Taktiken, Ideen und Veränderungen der inneren Einstellung, die wir alle anwenden können, um Ruhe in unserem Leben zu finden, sogar an besonders hektischen Tagen.
Diese Maßnahmen werde ich mit Ihnen teilen, wobei ich zwei Hauptquellen der inneren Unruhe und Anspannung in der heutigen modernen Welt unter die Lupe nehme: das »Verlangen nach mehr« und unsere Neigung, Superreizen zum Opfer zu fallen. Superreize sind hoch entwickelte, übertriebene Versionen der Dinge, die wir von Natur aus gerne machen. Wir werden untersuchen, wie diese Faktoren uns derart beeinflussen, dass wir unser Leben rund um den Botenstoff Dopamin strukturieren und einen anomalen chronischen Stresspegel hinnehmen. Wo es nützlich ist, werde ich eigene Erfahrungsberichte sowie Erkenntnisse von interessanten Forschern einflechten, die ich auf meinem Weg kennengelernt habe. Und natürlich werde ich praktische Ratschläge geben, wie sich all diese Impulse verarbeiten lassen.
Nachdem wir die Faktoren untersucht haben, die uns um unsere innere Ruhe bringen, werden wir weiter in die Tiefe dringen, um zu sehen, wie wir unsere Tage ruhig gestalten können. Wir werden Themen behandeln wie die Funktionsweise von Stress, welche typischen »Notausgänge« wir nutzen, wenn wir ängstlich sind, warum wir uns nicht schuldig fühlen sollten, wenn wir nach innerer Ruhe streben, und weitere spezifische Taktiken, die wir anwenden können, um unsere innere Anspannung zu lösen. In diesem Buch werde ich außerdem darüber sprechen, was ich aus meinen Selbstversuchen gelernt habe, zum Beispiel meine Produktivitätszeit klar abzugrenzen, eine einmonatige Dopaminfastenkur durchzuführen, um meinen geistigen Reizpegel drastisch zu senken, und meine Koffeintoleranz neu zu bestimmen.
Wir wollen mit einem Thema beginnen, das mir am Herzen liegt, und zu dem ich eine gesündere Beziehung entwickeln wollte, um innere Ruhe zu finden. Sie haben es vielleicht erraten, es geht um »Produktivität«.
Ob es uns bewusst ist oder nicht: Die Welt, in der wir uns befinden, veranlasst uns immer wieder, über unsere eigene Leistungsfähigkeit nachzuden-ken. Wie ich am eigenen Leib erfahren habe, kann dieser Drang, immer produktiver und leistungsfähiger zu werden, uns dazu verleiten, uns zahllose Geschichten über uns selbst einzureden – egal ob sie stimmen oder nicht – und in erheblichen chronischen Stress ausarten.
Wenn Sie bereit sind, wollen wir nun tief in das Thema eintauchen und erforschen, was ich als »Leistungsmentalität« bezeichne.
2. KAPITELLEISTUNGSSTREBEN
Wie wir unsere Identität formen
Für mich ist es undenkbar, über meine Lektionen in puncto innerer Ruhe zu schreiben, ohne zunächst über Leistung zu sprechen beziehungsweise darüber, wie wir unsere Identität über Leistung definieren.
Zum großen Teil formt unsere Identität sich aus unserer Selbstsicht und der Fremdsicht, also wie wir von anderen gesehen werden.
Wenn Sie Ihr Leben wie ein Video zurückspulen und im Schnelldurchlauf all Ihre Errungenschaften, Triumphe und Herausforderungen Revue passieren lassen könnten, kämen Sie irgendwann zu dem Punkt, an dem Ihre Identität sich noch nicht gebildet hatte. Sie waren ein Kind und betrachteten die Welt mit großen, staunenden Augen – wie eine kleine Figur in einer Schneekugel. Dabei sammelten Sie auch Anhaltspunkte über sich selbst: Dinge, die Sie aus Ihrer Umwelt aufnahmen und Narrative, die Ihnen ein Bild darüber vermittelten, wer Sie zu sein glaubten ...
Mit großen Augen und neugierigem Blick, Ihre Wange auf das nasse Gras gepresst – während Sie vielleicht mit dem Zeigefinger einen Frosch anstupsten – hörten Sie im Hintergrund die gemurmelten, nicht für Ihre Ohren bestimmten Worte Ihrer Tante, die einem Ihrer beiden Eltern erzählte, was für ein wissbegieriges Kind Sie sind.
Bin ich wissbegierig? Nun ja, das bin ich wahrscheinlich. Aber was bedeutet das? ...
Sie spulen schnell vor bis zur Highschool, zum Physikunterricht im ersten Jahr. Physik war eigentlich nicht Ihr Ding, aber irgendwie fand Ihr Lehrer ... eine perfekte Methode, zu erklären, wie die Elemente der Welt miteinander interagieren.
Vielleicht ist Wissenschaft etwas für mich? Ich konnte schon immer logisch denken. Was sagt das über mich aus?
Wieder spulen Sie schnell vor, drücken den Play-Button und gelangen zu der Woche, als Sie Ihre zweite Arbeitsstelle antraten. In einem Meeting bemerkt Ihr neuer Boss – bis heute Ihr Lieblingsboss – nebenbei, wie zuverlässig Sie sich in der ersten Woche gezeigt haben und dass es Ihnen auf magische Weise immer gelingt, alles zu erledigen, was man Ihnen aufgetragen hat.
Natürlich bin ich zuverlässig. Das ist Teil meines Naturells. Ich würde sagen, ich bin einfach produktiv.
Mit der Zeit verdichten sich die Erinnerungen zu Belegen dafür, wie wir uns entwickelten und schließlich dafür, für wen wir uns selber halten.
Auch ich verfüge über Narrative wie diese – dass ich neugierig, logisch und produktiv war –, bis ich schließlich ein einjähriges Produktivitätsprojekt startete, in dessen Rahmen ich forschte und experimentierte und so viele Produktivitätstipps einholte, wie ich nur konnte. Zu Beginn dieses Projekts – ich kam damals frisch von der Uni – lehnte ich zwei gut bezahlte Vollzeitstellen ab, um mich der Erforschung des Themas Produktivität zu widmen und ein Jahr lang keinen Cent zu verdienen. (In Kanada können wir die Rückzahlung unserer Studienkredite eine Weile aufschieben, was die Projektarbeit um einiges leichter machte.) Wie Sie sich vorstellen können, verstärkte dieses Vorhaben die Narrative, an die ich in Bezug auf mich selbst glaubte. Einige dieser Narrative, die dieses Projekt untermauerte, trafen zu. Zum Beispiel, dass ich mich stark für die Wissenschaft der Produktivität interessierte. So abseitig ein derartiges Interesse auch sein mag, gilt dieses Narrativ bis heute – inzwischen sogar vielleicht noch mehr als früher.
Aber ich konstruierte auch andere Narrative über mich selbst, zum Beispiel, dass ich geradezu übermenschlich produktiv war. Diese Identität stand auf einem weniger stabilen Fundament. Zu meinem eigenen Nachteil fand ich umso mehr Belege für dieses Narrativ, je mehr ich mit Ideen und Stra-tegien experimentierte. Das führte dazu, dass ich mich immer mehr darin vergrub.
Natürlich stammten diese Narrative nicht allein von mir. Nachdem ich zum Beispiel in einer Woche 70 Stunden lang TED Talks angesehen hatte (um mit Informationsspeicherung zu experimentieren), schrieb mir die TED-Talk-Organisation, ich sei »wahrscheinlich der produktivste Mann überhaupt«. Das fühlte sich damals verdammt gut an. Obwohl ich es ein wenig übertrieben fand, prägte dieser Satz, der in Interviews und in der Anmoderation zu meinen Vorträgen immer wieder zitiert wurde, zweifellos meine Storys über mich selbst (von meinem Ego ganz zu schweigen). Mit der Zeit kamen immer mehr anerkennende Zitate hinzu – Öl für das Feuer, das meine neu definierte Identität schmiedete.
Ich wusste einiges über Produktivität und möchte gerne glauben, die Strategien zu einer intelligenten Herangehensweise an meine Arbeit wirklich gelernt oder sogar entwickelt zu haben. Das könnte man erwarten, wenn man bedenkt, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, dieses Thema zu erforschen, darüber nachzudenken und damit zu experimentieren. Schreiner sollten wissen, wie man Möbel anfertigt, Lehrkräfte sollten wissen, wie man unterrichtet, und Produktivitätsforscher sollten wissen, wie man in der gleichen Zeit, in der andere Menschen wenig erledigen, vieles schafft.
Indem ich mir das Narrativ meiner grenzenlosen Produktivität aneignete, ließ ich – wie so viele andere –, außer Acht, dass ich mich an einem Punkt überforderte. Ich wusste viel über Produktivität, aber es gab auch viel, was ich nicht wusste. Vor allem war mir der angemessene Platz der Produktivität in meinem Leben nicht klar.
Eventuell war ich gestresster als ich mir selbst eingestand, und die ständigen Reisen verschlissen mich mehr, als ich wahrhaben wollte. Vielleicht hatte ich mich in ein Narrativ verstrickt, das tatsächlich gar nicht lebbar war und das mich über kurz oder lang ruhelos und angespannt machte und in den Burn-out trieb.
Wenn wir unsere Identität bilden, stützen wir uns im besten Fall auf unsere unveränderlichen Eigenschaften und definieren unsere Identität auf Basis unserer wichtigsten Werte. Oft wählen wir aber Aspekte unseres Lebens aus, die dieses Kriterium nicht erfüllen, einschließlich unserer Berufswahl. Sobald unser Job oder ein beliebiger anderer Lebensbereich ein Teil unserer Identität wird, fühlt sich sein Verlust so an, als verlören wir einen Teil unserer Persönlichkeit. Diesen Fehler habe auch ich gemacht. Ich sah in meiner Arbeit keine berufliche Tätigkeit mehr; vielmehr war sie zu einem Teil meines Seins geworden. Jede lobende E-Mail eines Lesers oder einer Leserin, jede Äußerung in den Medien und jede anerkennende Bemerkung wurde zu einem weiteren Mosaiksteinchen, das dieses Narrativ verstärkte, ein weiterer Kübel mit feuchtem Beton, der in das Fundament dieser neu geformten hyperproduktiven Identität gekippt wurde.
Mein Burn-out und meine akute Panikattacke auf der Bühne, aber auch schlichtere Erinnerungen, wie mich selbst im Wasserüberlauf der Badewanne zu spiegeln, trieben einen Keil zwischen mich und mein Selbstbild. Sie mahnten mich eindrücklich, dass die vermeintlichen Belege, auf die ich einen Großteil meiner Identität gegründet hatte, in die Irre führten.
Es wäre gelogen zu behaupten, mir wäre all dies auf der Zugfahrt nach Hause klar geworden. Eines wurde mir auf dieser Fahrt jedoch klar: Ich hatte mein Produktivsein um jeden Preis bis an einen Punkt getrieben, an dem das Fundament ins Wanken geriet. Irgendetwas fehlte.
Wie Denkweisen entstehen
Zu Beginn dieses Buches möchte ich Ihnen eine scheinbar einfache Frage stellen: Woran bemessen Sie, ob ein Tag Ihres Lebens ein guter Tag war? Denken Sie ein oder zwei Minuten ernsthaft über diese Frage nach. Achten Sie darauf, was Ihnen spontan einfällt, machen Sie eine kurze Pause, überlegen Sie, und sprechen Sie mit Ihrem oder Ihrer Ehe- oder LebenspartnerIn darüber (eine meiner bevorzugten Techniken).
Wenn Sie so sind wie ich, macht es Ihnen möglicherweise sogar Spaß diese Frage in Ihrem Kopf hin- und her zu wälzen.
(Ich bin da, wenn Sie damit fertig sind.)
Wenn Sie ein wenig über diese Frage nachgedacht haben, haben Sie wahrscheinlich gemerkt, dass es zahllose Möglichkeiten gibt, einen Tag zu bewerten, je nachdem, auf welche Kriterien Sie sich fokussieren. Nachfolgend einige Antworten, die ich gehört habe (die zugrundeliegenden Werte stehen in Klammern dahinter):
In welchem Umfang Sie anderen helfen konnten, sei es privat oder beruflich (Dienen).Wie viele Aufgaben Sie auf Ihrer To-do-Liste abhaken konnten (Produktivität).Wie sehr Sie den Tag genießen konnten (Lebensfreude).Wie viel Geld Sie verdient haben (finanzieller Erfolg).Wie engagiert Sie beruflich oder privat gewesen sind (Präsenz).Wie viele tiefe, authentische Momente Sie mit anderen erlebt haben (Verbindung).Ob der Tag Sie glücklich gemacht hat (Zufriedenheit).Das sind nur einige Beispiele. Neben Ihren Werten könnten die Kriterien, nach denen Sie Ihren Tag beurteilen, auch von anderen Aspekten Ihres Lebens beeinflusst werden wie die Kultur, in der Sie leben, Ihre persönliche Lebensphase, Ihre Kindheit und Jugend, und welche Chancen Ihnen offenstehen. Jemand, der in einer Familie von Investmentbankern groß geworden ist, wird seinen Tag wahrscheinlich nach anderen Kriterien bemessen als jemand, der in einer Familie von Freigeistern aufgewachsen ist, die in einem VW-Bus gelebt hat.
Wichtig ist der Hinweis, dass es keine »richtige« Antwort auf diese Frage gibt. Zwar treten die meisten von uns am Ende eines Tages nicht innerlich einen Schritt zurück, um zu betrachten, ob dieser erfolgreich war - nicht alle von uns verfolgen ein Ritual wie Tagebuch schreiben oder Meditation -, trotzdem sinnieren wir oft unbewusst darüber nach, ob ein Tag gut war oder nicht. So lange Sie damit zufrieden sind, wie Sie Ihren Tag verbracht haben, und in Einklang mit Ihren Werten leben, werden Sie sich mit dem Tagesablauf wohlfühlen, egal ob er auf andere gnadenlos konkurrenzorientiert oder wie ein schräges Hippie-Abenteuer wirkt. Es sollte genügen, am Ende eines jeden Tages mit sich im Reinen zu sein - wie Sie Ihre Zeit verbringen, ist allein Ihre Sache.
Trotz der vielfältigen Wege einen Tag zu bewerten, und bei allen Unterschieden zwischen unseren individuellen Werten und Lebenssituationen, scheinen die meisten Menschen einen Tag danach zu beurteilen, wie viel sie geschafft haben beziehungsweise wie produktiv sie waren.
Das bezieht sich typischerweise auf den Beruf. Aber wenn Sie auch nur annähernd so sind wie ich, denken Sie auch zu Hause so.
Die Leistungsmentalität
Wenn Sie Ihr Leben zurückspulen könnten, würden Sie hoffentlich feststellen, dass es Ihrer jüngeren Version egal war, wie produktiv Sie waren oder wie viel Sie an einem Tag erledigt hatten. Weil Sie noch nicht so viele Storys über sich selbst angesammelt hatten, dachten Sie auch kaum darüber nach, was andere von Ihnen erwarteten, und erwarteten auch weniger von sich selbst.
Falls Sie so ähnlich ticken wie ich, war Ihr jüngeres Ich ein freier Geist, der dem sprichwörtlichen Wind folgte und die Dinge einfach um ihrer selbst willen tat. Vielleicht haben Sie Zeitkapseln gebaut, sind an neue Orte geradelt und haben Gerichte zusammengeköchelt, deren Zubereitung zwar Spaß machte, die aber grauenvoll schmeckten – wilde Mischungen aus Mehl, Ketchup und anderen willkürlichen Zutaten aus dem Küchenregal.
Ab und zu waren Sie vielleicht sogar mental so untätig, dass Sie sich langweilten, was wiederum eine spontane Ideenflut in puncto Zeitvertreib auslöste. Vielleicht bauten Sie mit Bettlaken und den Wohnzimmermöbeln eine Festung oder beklebten den Sockel der Küchenschränke mit Aufklebern. (Wann haben Sie sich das letzte Mal gelangweilt?)
Als Sie jünger waren dachten Sie nicht daran Ihre Tage zu bewerten. Im Verlauf des Lebens und mit zunehmender Verantwortung verändert sich das. Wir lernen, unsere Zeit – und oft auch unseren Wert – ins Verhältnis zu unserer Leistung zu setzen.* Als Erwachsene hält uns die Last der Verantwortung gerne von unbeschwerten Abenteuern ab.
Schon als Kind fangen wir an uns diese Haltung anzugewöhnen. Mit der Einschulung treten wir in ein System ein, das uns Ziele setzt, sodass wir mit anderen Schülern und Schülerinnen konkurrieren, um diese Ziele zu erreichen: Je besser unsere Noten, desto höher steigen wir im Schulsystem auf, und desto weiter werden wir es im Leben bringen. Gute Noten sind die Eintrittskarte zu einer Karriere als Raketenwissenschaftler, Hirnchirurg oder renommierter CEO, der in einem Gulfstream-Jet kreuz und quer durch die Welt fliegt. Je fokussierter wir arbeiten, je lösungsorientierter wir vorgehen, und je motivierter wir sind, desto mehr leisten wir. Und so wollen wir in immer kürzerer Zeit immer ehrgeizigere Ziele erreichen: immer höhere Gehälter, immer höhere Leistungsboni und immer höhere Hierarchiestufen innerhalb unseres Unternehmens. Egal wie weit wir kommen, wir wollen immer noch mehr. So funktioniert die Leistungsmentalität. Wenn wir uns einmal auf die Erfolgsschiene begeben haben, kommen wir nicht mehr davon herunter.
Im Verlauf unseres Lebens und mit wachsender Verantwortung vermehren sich auch die Optionen, unsere Zeit zu verbringen, und nicht all diese Möglichkeiten sind gleich beschaffen.
Wenn wir uns ständig fragen, ob wir nicht etwas Wichtigeres tun könnten als das, womit wir uns gerade beschäftigen – ein Volkswirt bezeichnet das vielleicht als die »Opportunitätskosten« unserer Zeit –, bekommen wir irgendwann Schuldgefühle und zweifeln, ob wir unsere kostbare knappe Zeit auch wirklich optimal einsetzen. Die Verantwortung lässt die Entscheidung, welchen Aktivitäten wir Priorität einräumen, folgenreicher werden, weil sie die Frage der Opportunitätskosten aufwirft. Falls irgendwann kurz der Gedanke an ein Abenteuer vorbeihuscht, denken wir als Nächstes vielleicht an all die wesentlich wichtigeren Dinge, die wir stattdessen erledigen könnten: Wir müssen Wäsche zusammenlegen, der Hund muss vor die Tür und wir müssen E-Mails beantworten.
Das wahre Leben kommt uns in die Quere.
Selbst wenn Sie zunächst nur im Beruf auf Verantwortung und Opportunitätskosten achten, erreichen Sie vielleicht irgendwann einen Kipppunkt, an dem aus Ihrem unermüdlichen Fokus auf Produktivität eine Haltung wird, die auf Ihr Privatleben abfärbt. Anstatt Produktivität einfach als eine Reihe von Praktiken zu betrachten, auf die man zurückgreift, wenn man viel Arbeit hat und das Zeitbudget knapp ist, wird das Bedürfnis, jeden Moment maximal auszuschöpfen, zu einem allgegenwärtigen Begleiter – selbst wenn man eigentlich nur entspannen möchte.
Ich bezeichne dieses Verhalten als Leistungsmentalität. Dabei handelt es sich um eine Reihe von konditionierten Einstellungen und Überzeugungen, die uns ständig antreiben noch mehr zu leisten. Diese Mentalität führt dazu, dass wir unsere Zeit ständig mit irgendetwas füllen müssen und uns schuldig fühlen, wenn wir unsere Zeit »nicht optimal« verbringen. Es ist die innere Stimme, die uns einredet, dass wir besser nach Hause gehen und schon mal das Abendessen vorbereiten sollten, wenn wir gerade mit einem Freund oder einer Freundin gemütlich bei einem Latte macchiato sitzen. Es ist die Stimme, die uns sagt, dass wir unsere Liste noch nicht angehörter Podcasts abarbeiten sollten, während wir gerade einen wunderschönen Spaziergang durch den Park genießen. Und vor allem bewirkt diese Mentalität, dass wir unaufhörlich über die Opportunitätskosten unserer Zeit nachdenken und darüber grübeln, wie wir aus unserer knappen Zeit noch mehr herausholen können.
Die meisten von uns bewerten ihre Zeit und ihre Ziele nicht ständig aus dieser Perspektive.
Allerdings scheinen wir mit fortschreitender Lebenszeit immer mehr Stunden, Tage, Wochen und Jahre an unserer Leistung zu messen. Wir reden uns ein, unsere Einstellung würde sich verändern, sobald wir in Rente gehen, und machen weiter wie gehabt.
Die Entspannung kann warten, und das gilt auch für den Genuss der Früchte unserer Leistung. Ein »erfolgreicher Mensch« zu sein, kann zum Bestandteil der eigenen Identität werden. Wenn die Liste unserer beruflichen Leistungen mit unserer persönlichen Identität verschmilzt, betrachten wir unseren Erfolg als integralen Bestandteil unserer Persönlichkeit.
In ihrem Buch The Writing Life vertritt Annie Dillard die Auffassung, dass die Art, wie wir unsere Tage verbringen, etwas darüber aussagt, wie wir unser Leben ausrichten.1 Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wie wir unsere Tage messen. Wie wir unsere Tage messen, sagt etwas darüber aus, wie wir unser Leben messen. Wenn wir unsere Tage danach bewerten, wie viel wir am Tag erledigen können, dann laufen wir Gefahr, auch unser gesamtes Leben danach zu beurteilen.
Schule und Beruf verleiten uns etwas zu viel Gewicht auf Produktivität zu legen, aber natürlich dienen beide einem wichtigen Zweck. Sie sind die Grundsteine der modernen Welt, wie wir sie kennen.
Man kann nicht genug betonen, wie viel besser es uns in der modernen Welt geht als den Menschen in früheren Zeiten. Wenn Sie einen Landarbeiter von vor 200 Jahren in einen gut sortierten Supermarkt führen würden, würde ihn das überquellende Warenangebot wahrscheinlich völlig überfordern. Dabei sind Supermärkte nicht einmal annähernd die luxuriösesten Einrichtungen des modernen Lebens. Wenn der arme Tropf sich irgendwann wieder beruhigt hätte (was wahrscheinlich eine Weile dauern würde), könnten Sie ganz langsam Ihr Smartphone aus der Tasche ziehen und ihm das Gerät vorführen, das Ihnen erlaubt, sich mit jedem Menschen auf der Welt in weniger als einer Sekunde zu verbinden.
Dank des wirtschaftlichen Fortschritts ist das inflationsbereinigte Jahreseinkommen eines durchschnittlichen Amerikaners von $ 2000 auf $ 50 000 pro Kopf gestiegen.2 Während unser Wohlstand um das Fünfundzwanzigfache gewachsen ist, sind gleichzeitig die Preise zahlreicher Waren gesunken, was sich zum großen Teil dem technologischen Fortschritt verdankt.
Für die $ 1000, die Sie noch vor 80 Jahren für einen Fernseher bezahlt haben, bekommen Sie heute einen wesentlich größeren Bildschirm und eine weitaus höhere Bildauflösung. Und das in Farbe!
Und nicht nur wir in den reicheren Ländern dieser Erde profitieren von diesem Wachstum. In den letzten beiden Dekaden hat sich die Zahl extrem armer Menschen mehr als halbiert.* Vor 20 Jahren lebten 29 Prozent der Menschen in extremer Armut; heute sind es 9 Prozent.3 Wirtschaftsindikatoren wie diese sind bedeutsam. Der renommierte Forscher Hans Rosling schreibt in seinem Buch Factfulnes: »Der Faktor, der das Leben der Menschen am meisten beeinflusst, ist nicht ihre Religion, ihre Kultur oder das Land, in dem sie leben, sondern ihr Einkommen.«4
Aus all diesen Gründen werde ich nicht gegen das Wirtschaftswachstum argumentieren, das unsere Lebensverhältnisse verbessert, vorausgesetzt (eine starke Annahme), die resultierenden Vorteile sind gerecht verteilt.
Die moderne Welt hat jedoch ihren Preis: Angst und Anspannung. Die Systeme, in denen wir leben und arbeiten – und die innere Einstellung, die diese Systeme begünstigt, sowie der Stress, den wir als ihre Begleiterscheinung akzeptieren – tragen in hohem Maße zu dieser Entwicklung bei. Ob in der Schule oder am Arbeitsplatz, überall wird Leistung und Produktivität belohnt. Über die gesamte Lebensspanne betrachtet, werden wir potenziell umso »erfolgreicher«, je produktiver wir sind.
Die moderne Gesellschaft legt großen Wert auf traditionelle Erfolgsmaßstäbe wie Geld, Status und Anerkennung, und ignoriert schlechter quantifizierbare Messgrößen wie den Grad unserer Lebenszufriedenheit, wie tief und erfüllend unsere Beziehungen sind, und ob wir für andere Menschen wichtig sind. Der Weg zu mehr Erfolg führt über persönliche Produktivitätssteigerung und die Anhäufung so vieler produktiver Tage, dass daraus ein »erfolgreiches« Leben wird. Je mehr Zeit wir in Systemen verbringen, die Produktivität belohnen, desto überzeugter sind wir, dass es vor allem darauf ankommt, produktiv und leistungsstark zu sein. Bis diese beiden Faktoren schließlich zum Standardkriterium für unsere Bewertung werden, wie gut wir mit unserer Zeit umgegangen sind.
* Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass das eigene Leben viel mehr wert ist als das, was Sie in Ihrer Lebenszeit leisten.
* Anm. d. Übers.: Nachdem die Zahl der Menschen in Armut weltweit 30 Jahre lang fast konstant gesunken ist, kommt es in Folge der Covid-19-Pandemie erstmals zu einem erneuten Anstieg von extremer Armut. Besonders betroffen sind Subsahara-Afrika und Südasien, aber auch der Nahe Osten und Nordafrika. Neben der Pandemie ist auch der Klimawandel ein zentraler Treiber von Armut. (siehe: https://www.bmz.de/de/agenda-2030/sdg-1.)
Die Magie der Produktivitätstipps
In diesem Kapitel konzentriere ich mich in erster Linie auf die Kosten des Produktivitätsstrebens zulasten Ihres Wohlbefindens. Allerdings hat der Ehrgeiz, möglichst produktiv zu sein, auch seine positiven Seiten, vor allem, wenn man es nicht übertreibt. Wenn Sie bei dem Wort »Produktivität« an seelenlose Effizienz denken, dann sind Sie nicht allein. Aber, keine Sorge! Es gibt wesentlich freundlichere Produktivitätsansätze, und Ratschläge zur Produktivitätssteigerung machen aus Ihnen nicht automatisch einen leistungssüchtigen Roboter.
Für mich bedeutet Produktivität einfach, unsere gesetzten Ziele zu erreichen, egal, ob es darum geht, das E-Mail-Postfach zu leeren, sich zwischen zwei Jobbewerbern zu entscheiden oder an einem Strand zu relaxen und dabei zwei Piña Coladas zu trinken (einen für jede Hand). In meinen Augen sind wir im besten Sinne produktiv, wenn wir uns etwas vornehmen und es dann auch tun. Anders ausgedrückt: Produktivität meint hier nicht, immer noch mehr zu wollen, sondern absichtsvoll zu handeln. Diese Definition gilt für jeden Kontext und jeden Lebensbereich.
Doch selbst mit dieser (hoffentlich humaneren) Definition sind Produktivität und Leistung zwei Seiten derselben Medaille, selbst wenn unser »Leistungsziel« einfach darin besteht, einen Tag auszuspannen. Ich werde diese freundlichere Definition einen Moment beiseitelassen, weil es sich lohnt, das Leistungsstreben anhand einer traditionell akzeptierten Definition zu betrachten: unsere Ziele zu erreichen (sprich, Erfolg nach traditionellem Muster).
Produktivitätstaktiken sind weder gut noch schlecht. Methoden, Gewohnheiten und Strategien, die uns effektiv und leistungsfähig machen, lassen sich für großartige Zwecke einsetzen. Ich habe es selbst erfahren: Produktivität ist eines meiner Lieblingsthemen, und mich auf Produktivitätssteigerung zu fokussieren, hat mich bemerkenswerte Dinge vollbringen lassen, auf die ich stolz bin, und Erfolge erzielen lassen, die ich ansonsten wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Gleichzeitig hat mich dieser Leistungsfokus in den Burn-out und in die innere Anspannung getrieben. Produktivitätsexperten sprechen kaum darüber, dass Leistungsstreben sowohl zu Erfolg führen als auch schaden kann.
Das wollen wir also hier thematisieren.