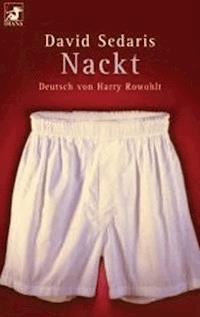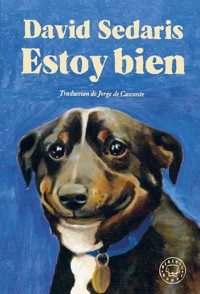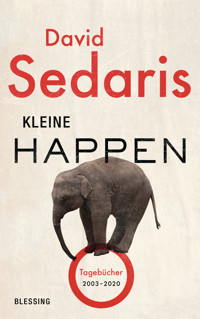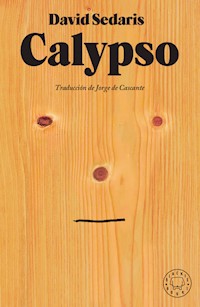7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
#1-Bestseller der New York Times
Den betörend geheimnisvollen Namen Calypso teilen sich unter anderem eine griechische Meeresnymphe, ein afrikanisch-karibischer Tanzrhythmus und ein Saturnmond. Fragt man David Sedaris, ist Calypso ein besonders bescheuerter Name für eine Katze. Aber auch ein betörend geheimnisvoller Titel für die lang erwartete neue Geschichtensammlung eines der erfolgreichsten Humoristen unserer Zeit, der es wie kein anderer versteht, zarte Schönheit im Hässlichen zu entdecken und die banale Komik des schönen Scheins zu entlarven.
Die autobiografischen Geschichten in Calypso kreisen um das solare Zentrum der Familie. In den Ferien und an Feiertagen kommt der Sedaris-Clan zusammen, im elterlichen Strandhaus, später in David Sedaris' eigener Zuflucht mit Meerblick, und flickt am generationsübergreifenden Quilt aus gescheiterten Beziehungen, tragischen Toden, späten Einsichten - und hartnäckiger Liebe zu den Freunden, die man sich nicht aussuchen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Die autobiografischen Geschichten in Calypso kreisen um das solare Zentrum, das in jedem Leben eine kritische Masse darstellt – die Familie. In den Ferien und an Feiertagen kommt der Sedaris-Clan zusammen, im elterlichen Strandhaus, später in David Sedaris’ eigener Zuflucht mit Meerblick, und flickt am generationsübergreifenden Quilt aus gescheiterten Beziehungen, tragischen Toden, späten Einsichten – und hartnäckiger Liebe zu den Freunden, die man sich nicht aussuchen kann: der Familie.
DerAutor
David Sedaris, geboren 1956 in Johnson City, New York, aufgewachsen in Raleigh, North Carolina, lebt in England. Er schreibt u. a. für den New Yorker und BBC Radio 4. Mit seinen Büchern Naked, Fuselfieber, Ich ein Tag sprechen hübsch und Schöner wird’s nicht wurde er zum Bestsellerautor. Zuletzt erschienen im Blessing Verlag Das Leben ist kein Streichelzoo.Fiese Fabeln (2011) und Sprechen wir über Eulen – und Diabetes (2013) sowie 2017 seine vielbeachteten Tagebücher Wer’s findet, dem gehört’s.
DAVID SEDARIS
CALYPSO
Aus dem Amerikanischen
von Georg Deggerich
BLESSING
Originaltitel: Calypso
Originalverlag: Little, Brown and Company, Hachette Book Group, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 by David Sedaris
Copyright © 2018 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und -illustration: Geviert, Grafik & Typografie, München, nach einem Entwurf von Peter Mendelsund
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-23405-8V001
www.blessing-verlag.de
Für Joan Lacey
INHALT
IN BESTER GESELLSCHAFT
JETZT SIND WIR ZU FÜNFT
KLEINER KERL
SCHRITT FÜR SCHRITT
EIN GETEILTES HAUS
DAS PERFEKTE ENSEMBLE
LEVIATHAN
IHR ENGLISCH IST SO GUT
CALYPSO
EIN BESCHEIDENER ANTRAG
GANZ ZU SCHWEIGEN
UNGEZÄHMT
DIE DAVONGEKOMMENEN
SORRY!
FAULER ZAUBER
EIN PAAR GRÜNDE, WARUM ICH IN LETZTER ZEIT DEPRIMIERT BIN
WARUM LACHST DU NICHT?
HIER STEHE ICH
DIE GEISTERWELT
UND WO DU SCHON MAL DRIN BIST, SIEH DOCH GLEICH NACH MEINER PROSTATA
DAS COMEY-MEMO
IN BESTER GESELLSCHAFT
Obwohl eine ganze Branche einem das Gegenteil erzählt, bietet das mittlere Lebensalter nur wenige echte Freuden. Der einzige Lichtblick, der mir einfällt, ist, dass man mit etwas Glück ein Gästezimmer hinzugewinnt. Manche kommen automatisch in den Genuss, wenn ihre Kinder das Haus verlassen, andere, so wie ich, kaufen sich irgendwann ein größeres Haus. »Folgt mir«, sage ich jetzt und führe unsere Gäste zu einem Raum, der nicht auf die Schnelle für sie hergerichtet wurde. Er dient nicht gleichzeitig als Arbeitszimmer oder Webkammer, sondern hat nur einen einzigen Zweck. Ich habe das Zimmer mit einem Bett statt mit einer Ausklappcouch ausgestattet, und an der Wand befindet sich, genau wie im Hotel, ein Gepäckständer. Das Beste ist aber das eigene Bad.
»Wenn ihr lieber duscht statt badet, kann ich euch oben im zweiten Gästezimmer unterbringen«, sage ich. »Da gibt es auch einen Gepäckständer.« Ich höre die Worte, als kämen sie aus dem Mund einer Sprechpuppe, und erbebe mit der Zufriedenheit eines Mannes in den besten Jahren. Ja doch, mein Haar ist grau und ausgedünnt. Ja doch, das Ventil in meinem Penis ist undicht, und nach dem Pinkeln gehen immer ein paar Tropfen in die Hose. Aber ich habe zwei Gästezimmer.
Wenn man in Europa lebt, lockt man damit Gäste an, jede Menge Gäste. Die Leute zahlen ein Vermögen für ihren Flug aus den USA. Bei ihrer Ankunft sind sie pleite und erschöpft und würden vermutlich auch in unserem Auto schlafen, wenn wir sie darum bäten. In der Normandie hatten wir ein Haus auf dem Land und quartierten unsere Gäste auf dem Dachboden ein, der gleichzeitig Hughs Studio war und nach Ölfarben und verwesenden Mäusen roch. Er hatte einen rustikalen Spitzgiebel, aber keine Heizung, sodass es entweder zu kalt oder zu heiß war. Das Haus hatte nur ein Bad, eingezwängt zwischen Küche und unserem Schlafzimmer. Gäste mussten also auf die Privatsphäre verzichten, die man gelegentlich auf der Toilette braucht, sodass ich Hugh zweimal am Tag mit vor die Tür nahm und laut rief, als sei dies ganz normal: »Wir vertreten uns genau zwanzig Minuten lang die Beine. Braucht jemand irgendetwas vom Straßenrand?«
Ein anderes Problem in der Normandie war, dass unsere Gäste bloß im Haus herumsitzen konnten. In unserem Dorf gab es kein einziges Geschäft, und der Fußweg ins nächste Dorf war wenig angenehm. Was nicht heißen soll, dass unsere Besucher sich nicht amüsierten – man musste nur der richtige Typ dafür sein, ein Frischluftfanatiker mit genügend eigenem Antrieb. In West Sussex, wo wir zurzeit wohnen, ist es mit dem Besuch etwas leichter. Im Umkreis von fünfzehn Kilometern gibt es eine idyllische Kleinstadt mit einem Schloss und eine genauso malerische Stadt mit siebenunddreißig Antiquitätenläden. In den kalksteingesprenkelten Hügeln kann man wandern und Rad fahren. Mit dem Wagen sind es fünfzehn Minuten zum Strand, und der nächste Pub ist bequem zu Fuß zu erreichen.
Unsere Gäste reisen gewöhnlich von London mit dem Zug an, und bevor wir sie am Bahnhof abholen, erinnere ich Hugh daran, dass wir für die Dauer ihres Aufenthalts das perfekte Paar abgeben werden. Wenn ich am Küchentisch sitze und er hinter mir steht, muss er eine Hand auf meine Schulter legen, genau an der Stelle, wo ein Papagei säße, wenn ich statt des idealen Partners ein Pirat wäre. Wenn ich eine Geschichte erzähle, die er schon so oft gehört hat, dass er sie stumm mitsprechen könnte, muss er so tun, als höre er sie zum ersten Mal, und er muss mindestens so viel, wenn nicht gar noch mehr Begeisterung zeigen wie unsere Gäste. Für mich gilt das auch, und ich muss Entzücken heucheln, wenn er etwas kocht, das ich nicht ausstehen kann, zum Beispiel Fisch mit lauter winzigen Gräten. Vor einigen Jahren habe ich es in der Normandie einmal gründlich vermasselt, als seine Freundin Sue über Nacht blieb und er etwas auftischte, das aussah wie eine Haarbürste. Und zwar derart vermasselt, dass ich hinterher ernsthaft überlegte, sie umbringen zu lassen. »Sie weiß zu viel«, sagte ich zu Hugh. »Diese Frau stellt eine Gefahr dar, und wir müssen sie aus dem Weg schaffen.«
Seine Freundin Jane hat auch ein paar unschöne Dinge gesehen, und obwohl ich sie und Sue mag und beide seit zwanzig Jahren kenne, fallen sie doch unter die Kategorie von Hughs Gästen. Das bedeutet, dass ich zwar meine Rolle spiele, aber nicht für ihre Unterhaltung zuständig bin. Natürlich biete ich hin und wieder einen Drink an. Ich erscheine zu den Mahlzeiten, aber ansonsten kann ich kommen und gehen, wie es mir gerade passt, und auch schon mal mitten im Satz aufstehen. Mein Vater hat das sein Leben lang gemacht. Man redet mit ihm, und er verschwindet einfach, nicht, weil er wütend wäre, sondern weil das Gespräch für ihn beendet ist. Ich war etwa sechs, als mir das zum ersten Mal auffiel. Man sollte meinen, es hätte mich gekränkt, aber stattdessen sah ich nur auf seinen entschwindenden Rücken und dachte: Und damit kommt man durch? Einfach so? Yippie!
Letztes Jahr zu Weihnachten waren drei meiner Schwestern zu Besuch, wobei Gretchen und Amy die beiden Gästezimmer bekamen. Also überließen wir Lisa unser Schlafzimmer und zogen nach nebenan in den umgebauten Stall, in dem ich mein Arbeitszimmer habe. Eine Sache, die Hugh während ihres Aufenthalts auffiel, war, dass mit Ausnahme von Amy und mir niemand in meiner Familie je gute Nacht sagt. Die Leute gehen einfach aus dem Zimmer – manchmal mitten beim Essen – und tauchen erst am nächsten Morgen wieder auf. Meine Schwestern waren meine Gäste, aber weil sie zu dritt waren und sich miteinander unterhalten konnten, musste ich mich nicht die ganze Zeit um sie kümmern. Nicht, dass ich mich nicht mit ihnen abgegeben hätte. In unterschiedlichsten Konstellationen gingen wir wandern oder fuhren mit dem Rad herum. Aber ansonsten saßen sie im Wohnzimmer und plauderten oder versammelten sich in der Küche, um Hugh beim Kochen zuzusehen. Ich gesellte mich eine Weile dazu und sagte dann, ich hätte zu tun. Was nichts anderes bedeutete, als nach nebenan in den Stall zu gehen, den Computer anzuschalten und einem spontanen Einfall folgend zu googeln, was Russell Crowe denn gerade so machte.
Einer der Gründe, warum ich die drei eingeladen und ihnen sogar die Flugtickets bezahlt hatte, war das Gefühl, es könnte das letzte Mal sein. Bis auf meinen Bruder Paul, der keinen Pass hat, aber schwört, ein Elektriker auf dem Bau habe ihm versichert, man könne einen am Flughafen kaufen, sind wir inzwischen alle über fünfzig. Von schlimmeren Krankheiten sind wir bislang verschont geblieben, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis uns das Glück verlässt und einer von uns Krebs bekommt. Und dann wird es einen nach dem anderen treffen, wie Figuren in der Schießbude.
Ich hatte die Tage bis zu ihrer Ankunft gezählt, warum war ich also nicht nebenan und saß mit Hugh in unserer Küche aus dem sechzehnten Jahrhundert mit dem Steinboden und dem knisternden Kaminfeuer? Vielleicht machte ich mir Sorgen, meine Familie würde mir auf die Nerven gehen, wenn ich mich zwischendurch nicht entfernte, oder noch wahrscheinlicher, ich würde ihnen auf die Nerven gehen, und unsere gemeinsame Woche würde nicht so harmonisch verlaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also verzog ich mich in mein Arbeitszimmer und schlug irgendwie die Zeit tot. Dann ging ich zurück ins Haus und hörte Dinge, bei denen ich wünschte, nie fortgegangen zu sein. Es war so, als würde man eine Stunde zu spät ins Kino kommen und sich fragen: Wie ist das Känguru nur an den Nunchaku gekommen?
Eine der Geschichten, deren Anfang ich verpasste hatte, drehte sich um Tabletten, die meine Schwester Gretchen seit eineinhalb Jahren nahm. Sie sagte nicht, warum der Arzt sie ihr verschrieben hatte, sondern nur, dass sie deswegen nachts schlafwandelte und im Schlaf aß. Ich selbst hatte es letztes Jahr an Thanksgiving, das wir in einem Haus auf Hawaii verbracht hatten, miterlebt. Wir hatten um sieben zu Abend gegessen, und gegen Mitternacht, etwa eine Stunde nachdem sie schlafen gegangen war, kam Gretchen aus ihrem Zimmer. Hugh und ich sahen von unseren Büchern auf und beobachteten, wie sie in die Küche ging. Dort nahm sie den Truthahn aus dem Kühlschrank und fing an, Fleischstücke mit den Fingern abzuzupfen. »Warum holst du dir keinen Teller?«, fragte ich, worauf sie mich ansah, nicht verächtlich, sondern ausdruckslos, als habe sie nur den Wind vor der Tür gehört. Dann streckte sie ihre Hand in das Tier und holte etwas von der Füllung heraus. Wählerisch pickte sie daran herum, bis sie beschloss, sie hätte genug, und in ihr Zimmer zurückging, ohne sich um die Schweinerei in der Küche zu kümmern.
»Was war das heute Nacht?«, fragte ich sie am nächsten Morgen.
Gretchens Gesicht stellte sich auf schlechte Nachrichten ein. »Was war was heute Nacht?«
Ich erzählte ihr, was passiert war, und sie sagte: »Verdammt. Ich habe mich schon gefragt, woher die braunen Flecken auf meinem Kopfkissen kommen.«
Nach der zur Hälfte verpassten Geschichte zu urteilen war Thanksgiving noch eine vergleichsweise harmlose Nacht für Gretchen gewesen. Einige Wochen nach der Episode mit dem Truthahn war sie in North Carolina morgens in die Küche gekommen und hatte auf der Anrichte ein offenes Marmeladenglas mit lauter Krümeln darin entdeckt. Zuerst hatte sie gedacht, es handele sich um Kekskrümel. Doch dann hatte sie den umgekippten Karton gesehen und bemerkt, dass sie einen der Futterriegel gegessen hatte, die sie normalerweise zerbröselt und an ihre Zierschildkröten verfüttert. Die Riegel sind etwa zehn Zentimeter lang und bestehen aus toten Fliegen, die wie Holz-Briketts zusammengepresst werden. »Nicht nur das«, sagte sie. »Nachdem ich damit fertig war, habe ich noch sämtliche Blüten von meinem Weihnachtsstern gegessen.« Sie schüttelte den Kopf. »Er stand auf der Anrichte neben dem Karton mit dem Schildkrötenfutter, und es waren bloß noch die Stängel übrig.«
Ich ging zurück in mein Arbeitszimmer, überzeugter denn je, dies wäre unser letztes gemeinsames Weihnachten. Ich meine, Fliegen! Wenn man sich schon im Schlaf über das Futter der Haustiere hermacht, sollte man sicherheitshalber seine Schildkröten gegen einen Hamster oder ein Kaninchen eintauschen, irgendein Tier, das ungefährlich ist und sich vegetarisch ernährt. Und wenn man einmal dabei ist, sollte man die Zimmerpflanzen gleich mit entsorgen – als Erstes den Kaktus – und die Reinigungsmittel unter Verschluss aufbewahren.
Später am Abend räkelten sich meine Schwestern wie Katzen vor dem Holzofen im Wohnzimmer. »Früher habe ich im Spiegel immer mein Gesicht betrachtet«, sagte Gretchen und blies eine Wolke Zigarettenqualm in die Luft. »Heute überprüfe ich, ob meine Nippel auf gleicher Höhe sind.«
O mein Gott, dachte ich. Wann hat das angefangen? Das letzte Mal, dass wir an Weihnachten alle zusammensaßen, war 1994 gewesen. Damals waren wir bei Gretchen in Raleigh, und sie hatte als Erstes am Morgen ihren Ochsenfrosch gefüttert, der ungefähr so groß wie ihr Bügeleisen war und Pappy hieß. Er schwamm in einem trüben, beheizten 120-Liter-Aquarium, das im Wohnzimmer auf dem Boden stand, gleich neben der Kasserolle, in der drei Molche hausten. Dieses Weihnachten war alles andere als normal gewesen, da unsere Mutter drei Jahre zuvor gestorben war. Es schien eine gute Idee, mit der Tradition zu brechen und etwas ganz anderes auszuprobieren. Deshalb das Haus meiner Schwester mit seinem Hauch von Sumpf statt unseres Elternhauses, in dem wir groß geworden waren und um das sich zu viele Geschichten rankten. Gretchens hüftlanges Haar ist seit jenem Weihnachten silbern geworden, und wenn sie schlafwandelt, humpelt sie ein bisschen.
An unserem ersten gemeinsamen Tag in Sussex zwängten wir uns alle in den Volvo und fuhren zu der Stadt mit den siebenunddreißig Antiquitätenläden. Hugh fuhr, und ich kroch nach hinten auf die Ladefläche und dachte glücklich: Da wären wir wieder, meine Schwestern und ich im Kombi, genau wie damals, als wir noch jung waren. Wer hätte 1966 daran gedacht, dass wir einmal gemeinsam im Wagen durch Südengland fahren würden, ohne dass sich auch nur für einen von uns seine Zukunftspläne erfüllt hatten? Amy war nicht Polizistin geworden, wie sie immer gehofft hatte. Lisa war keine Krankenschwester geworden. Niemand hatte ein Haus voller Diener oder einen zahmen Nasenaffen, aber wir hatten uns dennoch ganz tapfer geschlagen, oder?
In einem der Antiquitätenläden, die wir an diesem Nachmittag besuchten, entdeckten wir eine Richterperücke. Sie war widerlich und hatte alle Farben einer dreckigen Unterhose, was Amy und Gretchen nicht daran hinderte, sie aufzusetzen.
»Nein, danke«, sagte Lisa, als man ihr das Teil reichte. »Ich möchte nicht eure sämtlichen Bazillen auf meinem Kopf haben.«
Ihre Bazillen, dachte ich.
Um vier Uhr nachmittags ging die Sonne unter, und als wir uns auf den Heimweg machten, war es bereits dunkel. Ich nickte auf der Ladefläche kurz ein, und als ich aufwachte, redete Lisa gerade über ihre Gebärmutter, insbesondere die Sorge, ihre Gebärmutterschleimhaut könne zu dick sein.
»Wie in aller Welt kommst du denn da drauf?«, fragte Amy.
Lisa nannte den Namen einer Freundin und sagte, was Cynthia passiert sei, könne auch sie treffen. »Oder jede von uns«, sagte sie.
»Und was heißt das?«, fragte Gretchen.
»Dann müssen wir eine Ausschabung machen lassen«, erklärte Lisa.
Ich hob meinen Kopf über die Rückbank. »Woraus besteht die Gebärmutterschleimhaut überhaupt?« Ich stellte mir etwas Süßes und Gallertartiges vor. »So wie das Zeug, aus dem Trauben sind?«
»Das wäre Traubenfleisch«, sagte Amy. »Trauben bestehen aus Traube.«
»Tatsächlich eine gute Frage«, sagte Lisa. »Woraus besteht die Gebärmutterschleimhaut? Blutgefäße? Nerven?«
»Was für eine Familie«, sagte Hugh. »Kaum zu glauben, worüber ihr euch so unterhaltet.«
Später erinnerte ich ihn an den Besuch seiner Schwester Anne in der Normandie. Ich war eines Nachmittags von einer Fahrradtour zurückgekommen und hatte beim Betreten des Wohnzimmers gehört, wie sie zu ihrer Mutter Joan, die ebenfalls zu Besuch war, sagte: »Findest du nicht auch, dass sich ein Leguan großartig anfühlt?«
Am gleichen Abend, nach meinem Bad, hatte ich mitbekommen, wie sie ihre Mutter fragte: »Kann man dazu nicht auch Kamelbutter nehmen?«
»Kann man«, sagte Mrs. Hamrick, »aber ich würde es nicht empfehlen.«
Ich wollte schon nachfragen – »Wozu kann man Kamelbutter nehmen?« –, beschloss dann aber, dass mir das Geheimnis lieber war. Das geht mir oft so mit Besuchern. Ich werde mein Leben lang darüber rätseln, was Kristin, die bei mir zu Gast war, meinte, als ich eines Abends in den Hof trat und sie sagen hörte: »Zwergziegen wären ganz hübsch.« Oder, noch seltsamer, als Hughs Vater Sam uns in Begleitung eines alten Freundes aus dem Außenministerium einmal in Frankreich besuchte. Die beiden hatten über ihre gemeinsam in Kamerun verbrachte Zeit Ende der Sechzigerjahre gesprochen, und als ich in die Küche kam, hörte ich Mr. Hamrick sagen: »Also, war der Kerl nun ein Pygmäe oder bloß ein falscher Pygmäe?«
Ich drehte mich um und dachte auf dem Weg in mein Arbeitszimmer, ich frage später nach. Dann starb Hughs Vater, genau wie sein alter Freund aus dem Außenministerium. Vermutlich könnte ich den Begriff »falscher Pygmäe« googeln, aber es wäre nicht dasselbe. Ich hatte meine Chance, es herauszufinden, und ich habe sie vertan.
Hugh bedauert zutiefst, dass sein Vater das Haus in Sussex nicht mehr gesehen hat. Das Gebäude wäre so ganz nach Sams Geschmack gewesen: eine Ruine, die gerade so viel renoviert wurde, dass sie immer noch ziemlich mitgenommen aussieht. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Elektrik jetzt sicher ist, und wir haben eine Heizung. Aber Mrs. Hamrick kommt uns besuchen, und manchmal sitzen sie und Hugh in der Küche und reden über Sam. Man hört es nicht an aufgeschnappten Gesprächsfetzen, sondern an ihren Stimmen, die auch fünf Jahre nach seinem Tod immer noch zerbrechlich und ehrfürchtig klingen, voller Verlust und Sehnsucht. Genauso war es bei mir und meinen Schwestern, wenn wir von unserer Mutter redeten. Inzwischen, zweiundzwanzig Jahre später, endet fast jedes Gespräch über sie mit dem Satz: »Begreift ihr, wie jung sie noch war?« Bald werden wir selbst zweiundsechzig sein, das Alter, in dem sie an Krebs erkrankte und starb. Und dann werden wir älter sein, was sich falsch und irgendwie widernatürlich anfühlt.
Ich hatte schon lange Zeit vorher beschlossen, dass es dazu nicht kommen und ich auch mit zweiundsechzig sterben würde. Als ich dann Mitte fünfzig wurde, dachte ich, vielleicht sollte ich nicht so streng sein. Nachdem ich nun endlich zwei vorzeigbare Gästezimmer habe, kommt es mir dumm vor, nicht wenigstens etwas ausgiebiger davon zu profitieren.
Wenn unser Besuch abreist, fühle ich mich wie ein Schauspieler, der den Zuschauern beim Verlassen des Theaters zusieht, und bei meinen Schwestern war das nicht anders. Nachdem die Show vorbei war, konnten Hugh und ich wieder in unsere Alltagsrollen zurückfallen. Wir sind kein unausstehliches Paar, aber wir kennen die Sorte Auseinandersetzung, die sich an einer verlegten Socke entzündet und unversehens über alles und jedes geht. »Ich kann dich seit 2002 nicht mehr ausstehen«, zischte er kürzlich, als wir uns am Flughafen darüber stritten, in welcher Schlange der Sicherheitskontrolle es am schnellsten voranginge.
Ich war darüber weniger gekränkt als vielmehr verwundert. »Was war 2002?«, fragte ich.
Im Flugzeug entschuldigte er sich, und als ich den Zwischenfall einige Wochen später beim Essen ansprach, behauptete er, sich nicht daran erinnern zu können. Das ist eine von Hughs vielen herausragenden Eigenschaften: Er klammert sich nicht an Dinge. Eine andere ist seine große Zuvorkommenheit gegenüber alten Leuten, einer Gruppe, zu der ich in nicht allzu ferner Zukunft gehören werde. Es sind nur diese verdammten mittleren Jahre, die ich irgendwie durchstehen muss.
Das Geheimnis besteht natürlich darin, immer etwas zu tun zu haben. Wenn unsere Gäste fort sind, putze ich das Bad und ziehe die Betten ab. Waren es meine Gäste – beispielsweise meine Schwestern –, setze ich mich auf die Kante der Matratze, drücke die Bettlaken an meine Brust und ziehe den Geruch ein, bevor ich wieder aufstehe und auf wackligen Beinen in die Waschküche laufe, die ich mir immer gewünscht habe.
JETZT SIND WIR ZU FÜNFT
Ende Mai dieses Jahres, wenige Wochen vor ihrem fünfzigsten Geburtstag, beging meine jüngste Schwester Tiffany Selbstmord. Sie lebte in einem Zimmer in einem heruntergekommenen Haus im schäbigen Teil von Somerville, Massachusetts, und war nach Angaben des Leichenbeschauers mindestens seit fünf Tagen tot, bevor die Tür aufgebrochen wurde. Ich erfuhr die Nachricht über ein weißes Servicetelefon am Flughafen von Dallas. Weil das Boarding für meinen Flug nach Baton Rouge bereits begonnen hatte und ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, bestieg ich die Maschine. Am nächsten Morgen stieg ich in eine andere Maschine, diesmal nach Atlanta, und am Tag darauf flog ich nach Nashville, während ich die ganze Zeit über meine unablässig schrumpfende Familie nachdachte. Man erwartet, dass irgendwann die eigenen Eltern sterben. Aber ein Geschwisterteil? Ich hatte das Gefühl, als hätte ich meine seit 1968 bestehende Identität verloren, dem Jahr, in dem mein Bruder geboren wurde.
»Sechs Kinder!«, sagten die Leute. »Ihr Ärmsten. Wie bekommt ihr das nur hin?«
Es gab viele Großfamilien in der Nachbarschaft, in der ich aufwuchs. Jedes zweite Haus war wie ein Erbhof, sodass ich mir nie groß Gedanken darüber machte, bis ich erwachsen wurde und meine Freunde eigene Kinder bekamen. Ein oder zwei erschienen vernünftig, aber alles darüber hinaus kam mir skandalös vor. In der Normandie bekamen Hugh und ich gelegentlich Besuch von einem Paar, das seine dreiköpfige Rotte mitbrachte, und wenn sie ein paar Stunden später wieder gingen, war ich jedes Mal völlig gerädert.
Man nehme diese Kinder, verdopple die Zahl und ziehe das Kabelfernsehen ab: Das war die Situation, mit der meine Eltern klarkommen mussten. Jetzt allerdings waren es nicht mehr sechs, sondern nur noch fünf. »Und man kann nicht einfach sagen, ›Früher waren wir mal zu sechst‹«, sagte ich zu Lisa. »Das macht die Leute nur verlegen.«
Ich erinnerte mich an einen Vater mit seinem Sohn, denen ich vor einigen Jahren in Kalifornien begegnet war. »Und, gehören zur Familie noch mehr Kinder?«, fragte ich.
»Allerdings«, sagte der Mann. »Drei lebende und eine Tochter, Chloe, die noch vor der Geburt starb, vor achtzehn Jahren.«
Ich weiß noch, dass ich dachte, das ist unfair. Wie soll man darauf reagieren?
Verglichen mit den meisten Menschen, ob neunundvierzig Jahre oder auch neunundvierzig Monate alt, besaß Tiffany nicht viel. Sie hinterließ jedoch ein Testament, in dem sie verfügte, dass ihr Leichnam weder der Familie übergeben noch irgendein Angehöriger an ihrer Beerdigung teilnehmen dürfe.
»Sonst noch Fragen?!«, hätte unsere Mutter gesagt.
Ein paar Tage nach der Todesnachricht fuhr meine Schwester Amy mit einer Freundin nach Somerville und packte zwei Kartons mit Sachen aus Tiffanys Zimmer: Familienfotos, viele davon in Stücke gerissen, Kunden-Bewertungskarten von einem Supermarkt aus der Nachbarschaft, Notizbücher, Quittungen. Das Bett, eine bloße Matratze auf dem Boden, hatte man entfernt und einen großen Industrieventilator aufgestellt. Amy machte ein paar Fotos, die wir Geschwister einzeln und in Gruppen nach möglichen Hinweisen untersuchten: ein Pappteller auf einer Kommode, bei der mehrere Schubladen fehlten, eine auf die Wand geschriebene Telefonnummer, eine Sammlung von Schrubberstielen, alle in einer anderen Farbe, die wie Lampenputzer in einem grün gestrichenen Behälter standen.
Sechs Monate vor dem Tod unserer Schwester hatte ich mich nach einem Ferienhaus für uns alle auf Emerald Isle vor der Küste von North Carolina umgesehen. Unsere Familie hatte dort jeden Sommer verbracht, aber nach dem Tod meiner Mutter waren wir nicht mehr dort gewesen, nicht, weil wir das Interesse verloren hätten, sondern weil sie sich immer um das Haus gekümmert und vor allem die Miete bezahlt hatte. Das Haus, das ich mithilfe meiner Schwägerin Kathy gefunden hatte, besaß sechs Schlafzimmer und einen kleinen Pool. Die einwöchige Miete begann am Samstag, dem 8. Juni, und bei unserer Ankunft wartete in der Einfahrt schon die Frau eines Lieferservice mit sieben Pfund Meeresfrüchten auf uns, ein Geschenk von Freunden. »Ist auch Krautsalat dabei«, sagte die Frau und drückte uns die Tüten in die Hand.
Wenn meine Eltern früher ein Cottage gemietet hatten, drängelten meine Geschwister und ich uns vor der Tür wie ein Haufen junger Hunde vor dem Fressnapf. Sobald mein Vater aufgeschlossen hatte, stürmten wir ins Haus, um uns die besten Zimmer zu sichern. Ich nahm immer das größte mit Blick auf das Meer, und gerade wenn ich mit dem Auspacken beginnen wollte, kamen meine Eltern herein und sagten, das sei ihr Zimmer. »Also, was glaubst du denn, wer du bist?«, sagte mein Vater. Er und meine Mutter zogen ein, und ich wurde ins sogenannte Dienstbotenzimmer abgeschoben. Es war immer ebenerdig, eine Art nasskalte Kammer gleich neben dem Stellplatz für den Wagen. Nie gab es eine Innentreppe ins Obergeschoss. Stattdessen musste ich eine Außentreppe nehmen und meistens an der verschlossenen Eingangstür klopfen, wie ein Bettler, der um Einlass bittet.
»Was willst du?«, fragten meine Schwestern.
»Ich will rein.«
»Komisch«, sagte Lisa, die Älteste, zu den anderen, die sie wie Schülerinnen umringten. »Habt ihr auch dieses leise Fiepen gehört? Wer macht so ein Geräusch? Ein Einsiedlerkrebs? Eine kleine Meeresschnecke?« Normalerweise gab es eine klare soziale Trennung zwischen den drei älteren und den drei jüngeren Geschwistern in unserer Familie. Lisa, Gretchen und ich behandelten die drei anderen wie Diener und ließen es uns gut gehen. Am Strand jedoch hieß es oben gegen unten, was bedeutete, alle gegen mich.
Dieses Mal durfte ich mir das beste Zimmer aussuchen, weil ich für das Haus bezahlte. Amy nahm das Zimmer eine Tür weiter und mein Bruder Paul, seine Frau und ihre zehnjährige Tochter Maddy das Zimmer daneben. Das war’s dann mit Meerblick. Die anderen trafen später ein und mussten sich mit dem begnügen, was übrig war. Lisas Zimmer ging auf die Straße, genau wie das Zimmer meines Vaters. Gretchens Zimmer lag ebenfalls zur Straßenseite und war für einen Querschnittsgelähmten eingerichtet. Von der Decke hingen elektrische Flaschenzüge, mit denen man eine Person an Gurten ins und aus dem Bett hieven konnte.
Anders als die Ferienhäuser unserer Jugend gab es in diesem Haus kein Dienstbotenzimmer. Dazu war es zu neu und schick, genau wie die Häuser in der Umgebung. Traditionellerweise standen sämtliche Sommerhäuser auf Stelzen, aber inzwischen wird auch das Parterre häufig ausgebaut. Alle Häuser haben Strandnamen und sind in Strandfarben gestrichen, aber die meisten, die nach dem Hurrikan Fran im Jahr 1996 gebaut wurden, besitzen drei Stockwerke und sehen beinahe wie Vorstadthäuser aus. Unseres war geräumig und hell. Der Küchentisch bot Platz für zwölf, und es gab nicht nur eine, sondern gleich zwei Spülmaschinen. Die Bilder an den Wänden hatten alle etwas mit dem Meer zu tun: Seestücke und Leuchttürme und am Himmel lauter kleine Vs, das Logo für Möwen. An der Wand im Wohnzimmer hing der gestickte Spruch: »Du kannst den Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel anders setzen.« Daneben hing eine runde Uhr, bei der sämtliche Ziffern auf einem Haufen lagen, als wären sie abgefallen. Darüber stand: »Ist doch egal.«
Wann immer jemand nach der Uhrzeit fragte, bekam er zur Antwort: »Ist doch egal.«
Am Tag vor unserer Anreise war Tiffanys Todesanzeige im Raleigh News & Observer erschienen. Gretchen hatte sie aufgesetzt und mitgeteilt, unsere Schwester sei friedlich zu Hause entschlafen. Das klang so, als wäre sie sehr alt gewesen und hätte ein eigenes Haus besessen. Aber was blieb einem anderes übrig? Die Leute hinterließen auf der Internet-Seite der Zeitung Botschaften, und jemand schrieb, Tiffany sei gelegentlich in seinen Video-Verleih in Somerville gekommen. Als seine Brille zerbrochen sei, habe sie ihm eine angeboten, die sie beim Stöbern nach Kunstmaterialien in einer Mülltonne entdeckt habe. Weiter schrieb er, einmal habe sie ihm ein Playboy-Magazin aus den Sechzigerjahren geschenkt, mit einer Fotoserie unter der Überschrift »The Ass Menagerie«.
Das war faszinierend, da wir nicht viel über unsere Schwester wussten. Nacheinander hatten wir die Familie verlassen, um unsere Persönlichkeit zu entwickeln und nicht bloß ein Sedaris, sondern unser eigener, unverwechselbarer Sedaris zu werden. Aber Tiffany hatte sich für immer verabschiedet. Sie versprach vielleicht, Weihnachten nach Hause zu kommen, aber in letzter Minute kam immer irgendeine Ausrede: Sie hatte ihren Flug verpasst, sie musste arbeiten. Das Gleiche passierte mit den gemeinsamen Sommerferien. »Alle anderen haben es auch irgendwie hinbekommen«, sagte ich und spürte, wie alt und vorwurfsvoll ich klang.
Wir alle waren enttäuscht, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Selbst wenn man zu der Zeit nicht mit Tiffany auskam, musste man anerkennen, dass sie ihr Eintrittsgeld wert war – die dramatischen Auftritte, die ständigen profitauglichen Beleidigungen, das Chaos, das sie unausweichlich hinterließ. An einem Tag warf sie einen Teller nach einem, und am nächsten fertigte sie aus den Scherben ein kunstvolles Mosaik. Wenn das enge Bündnis mit einem ihrer Brüder oder Schwestern abkühlte, schmiedete sie mit jemand anderem ein neues. Wenn sie sich auch nie mit allen gut verstand, so hielt sie doch immer mit einem von uns Kontakt. Zuletzt war das Lisa, aber davor war jeder einmal an der Reihe gewesen.
Das letzte Mal war sie 1986 auf Emerald Isle mit dabei. »Und selbst da ist sie nach drei Tagen wieder gefahren«, erinnerte Gretchen uns.
Als Kinder verbrachten wir die meiste Zeit am Strand im Wasser. Dann wurden wir Teenager und widmeten uns der Sonnenbräune. Es gibt eine bestimmte Art von Unterhaltung, wenn man dösend in der Sonne liegt, für die ich immer eine Schwäche hatte. Am ersten Nachmittag unserer jüngsten Reise breiteten wir eine der Decken aus, die wir schon als Kinder benutzt hatten, legten uns nebeneinander darauf und erzählten Geschichten von Tiffany.
»Wisst ihr noch, wie sie Halloween in einer Army-Kaserne verbracht hat?«
»Oder als sie mit einem blauen Auge zu Dads Geburtstagsfeier aufgetaucht ist?«
»Ich erinnere mich noch an das Mädchen, das sie vor vielen Jahren auf einer Party kennengelernt hatte«, begann ich, als ich an der Reihe war. »Sie hatte von Narben im Gesicht erzählt und wie schrecklich so was wäre, und Tiffany hatte gesagt: ›Ich habe auch eine kleine Narbe im Gesicht, aber ich empfinde sie nicht als schlimm.‹
›Na ja‹, hatte das Mädchen gesagt, ›das würdest du aber, wenn du hübsch wärst.‹«
Amy lachte und drehte sich auf den Bauch. »Ha, das ist mal ein guter!«
Ich richtete das zusammengerollte Handtuch unter meinem Kopf. »Unglaublich, oder?« Aus dem Mund eines anderen wäre die Geschichte vielleicht ärgerlich gewesen, aber nicht hübsch zu sein war nie Tiffanys Problem gewesen, ganz besonders nicht in ihren zwanziger und dreißiger Jahren, als ihr die Männer reihenweise zu Füßen lagen.
»Komisch«, sagte ich, »aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie eine Narbe im Gesicht hatte.«
Ich blieb an diesem Tag zu lange in der Sonne und verbrannte mir die Stirn. Das war’s dann für mich und die Stranddecke. Für den Rest der Woche ließ ich mich kurz am Strand blicken, wenn ich mich nach dem Schwimmen abtrocknete, aber die meiste Zeit über fuhr ich mit dem Fahrrad die Küste entlang und hing meinen Gedanken nach. Während wir Geschwister uns untereinander problemlos verstanden, war es bei Tiffany immer harte Arbeit gewesen. Gewöhnlich hatten wir uns nach einem Streit wieder vertragen, aber beim letzten Mal hatte sie den Bogen überspannt, und als sie starb, hatten wir seit acht Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. In dieser Zeit war ich öfter in der Gegend von Somerville gewesen, und obwohl ich mit dem Gedanken gespielt hatte, sie zu besuchen und ein paar Stunden mit ihr zu verbringen, tat ich es nie, trotz der Ermunterungen durch meinen Vater. Zwischendurch hielten er und Lisa mich auf dem Laufenden: Tiffany hatte ihre Wohnung verloren, man hatte sie arbeitsunfähig geschrieben, sie war in ein Zimmer gezogen, das das Sozialamt ihr besorgt hatte. Vielleicht war sie ihren Freunden gegenüber mitteilsamer, aber ihre Familie erfuhr über ihr Leben immer nur häppchenweise. Sie sprach nicht mit uns, sondern zu uns, und zwar abwechselnd so lustig, scharfsinnig und widersprüchlich, dass man Mühe hatte, zwei aufeinanderfolgende Sätze miteinander zu verbinden. Bevor wir nicht mehr miteinander sprachen, wusste ich immer sofort, wenn sie am Telefon war. Ich kam ins Haus und hörte Hugh sagen: »Aha … aha … aha …«
Neben den zwei Kartons, die sie in Somerville gepackt hatte, brachte Amy auch das Schuljahrbuch meiner Schwester aus der neunten Klasse von 1978 mit. Unter den Botschaften ihrer Mitschüler befindet sich der folgende Eintrag von jemandem, der ein Marihuana-Blatt neben ihren Namen gemalt hat:
Tiffany. Dich gibt’s kein zweites Mal, also bleib, wie du bist. Schade nur, dass wir nicht mehr Partys feiern konnten. Diese Schule ist so was von öde. Bleib
– cool
– stoned
– hacke
– durchgeknallt
Der Ernst kommt später.
Woanders steht:
Tiffany
Ich freue mich schon, mit dir im Sommer einen durchzuziehen.
Tiffany,
Ruf mich in den Ferien an und wir schießen uns ab.
Wenige Wochen, nachdem diese Botschaften geschrieben wurden, lief Tiffany von Zuhause fort und kam anschließend in ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche namens Élan in Maine. Nach dem zu urteilen, was sie uns später erzählte, war es ein furchtbares Haus. Zwei Jahre später, 1980, kehrte sie nach Hause zurück, und von da an kann keiner von uns sich an eine Unterhaltung erinnern, in der sie das Heim nicht erwähnte. Sie machte die Familie dafür verantwortlich, sie einfach abgeschoben zu haben, aber wir Kinder hatten nichts damit zu tun. Paul zum Beispiel war gerade zehn, als sie ging. Ich war einundzwanzig. Ein Jahr lang schrieb ich ihr jeden Monat einen Brief. Dann schrieb sie mir, ich solle damit aufhören. Meine Eltern konnten auch nichts anderes tun, als sich immer wieder zu entschuldigen. »Wir hatten noch andere Kinder«, verteidigten sie sich. »Glaubst du vielleicht, wir hätten wegen einem von euch alles stehen und liegen lassen können?«
Nach drei Tagen auf Emerald Isle kamen Lisa und unser Vater, der inzwischen neunzig ist, nach. Da er auf der Insel seinen Spinning-Kurs in Raleigh verpasste, ging ich mit ihm jeden Nachmittag für einige Zeit in ein Fitnessstudio, das ich in der Nähe unseres Ferienhauses entdeckt hatte. Auf dem Weg dorthin redeten wir miteinander, aber sobald wir auf den Hometrainern saßen, hing jeder seinen eigenen Gedanken nach. Es war ein kleines Studio ohne viel Betrieb. An der Decke hing ein stummer Fernsehschirm, auf dem der Wetterkanal lief und uns daran erinnerte, dass sich irgendwo auf der Welt immer eine Katastrophe ereignete und Menschen ihre überschwemmten Häuser verlassen mussten oder vor einer trichterförmigen Wolke um ihr Leben rannten. Gegen Ende der Woche sah ich meinen Vater in Amys Zimmer durch die Fotos stöbern, die Tiffany zerrissen hatte. Er hielt einen Fetzen in der Hand, auf dem ein Stück vom Kopf meiner Mutter und etwas blauer Himmel zu sehen waren. Ich fragte mich, unter welchen Umständen das Bild zerstört worden war. Es kam mir so melodramatisch vor, wie ein gegen die Wand geworfenes Glas. Dinge, die Leute in Filmen machten.
»Einfach furchtbar«, flüsterte mein Vater. »Das ganze Leben eines Menschen in einem ärmlichen Karton.«
Ich legte meine Hand auf seine Schulter. »Genau genommen sind es zwei.«
»Zwei ärmliche Kartons«, verbesserte er sich.
An einem Nachmittag auf Emerald Isle fuhren wir zum Einkaufen in den Supermarkt. Ich war in der Obst- und Gemüseabteilung auf der Suche nach roten Zwiebeln, als mein Bruder sich von hinten anschlich, laut »Hatschi!« rief und dabei ein Bündel nasser Petersilie durch die Luft wedelte. Ich spürte den feuchten Schauer auf meinem Nacken und erstarrte in dem Glauben, irgendein gestörter, wildfremder Mensch habe mir soeben in den Nacken geniest. Es ist ein hübscher Trick, aber er hatte dabei auch die Inderin besprüht, die links neben mir stand. Sie trug einen blutroten Sari, sodass der Guss ihre blanken Arme, den Nacken und einen Teil des Rückens traf.
»Sorry, Mann«, sagte Paul, als sie sich entsetzt umdrehte. »Ich habe nur meinem Bruder einen Streich gespielt.«
Die Frau trug zahlreiche dünne Armreifen, die klimperten, als sie sich mit der Hand über den Hinterkopf fuhr.
»Du hast ›Mann‹ zu ihr gesagt«, sagte ich, nachdem sie sich entfernt hatte.
»Echt jetzt?«, fragte er.
»Echt jetzt?«, äffte Amy ihn gekonnt nach.
Am Telefon wird mein Bruder, genau wie ich, oft mit einer Frau verwechselt. Während wir unseren Einkauf fortsetzten, erzählte er uns, dass er kürzlich mit seinem Kombi liegen geblieben war und die Frau beim Abschleppdienst am Telefon zu ihm gesagt hatte: »Wir sind gleich bei Ihnen, Süße.« Er legte eine Wassermelone in den Einkaufswagen und sagte zu seiner Tochter: »Maddys Daddy redet wie eine Lady, aber das stört sie nicht, oder?«
Kichernd boxte sie ihn in den Bauch, und ich war verblüfft, wie unbefangen die beiden miteinander umgingen. Unser Vater war eine Autoritätsperson, während Paul eher etwas von einem Spielkameraden hat.
Wenn wir als Kinder ans Meer fuhren, sagte unser Vater etwa am vierten Tag: »Wäre es nicht hübsch, ein Haus am Strand zu kaufen?« Kaum machten wir Kinder uns Hoffnungen, kam er mit irgendwelchen Einwänden. Sie waren nicht belanglos – ein Haus zu kaufen, das irgendwann von einem Wirbelsturm weggerissen wird, ist vermutlich nicht die klügste Art von Investition –, trotzdem wollten wir unbedingt eines. Als Junge hatte ich geschworen, eines Tages würde ich ein Strandhaus kaufen, das allen gehören würde, solange sie meine drakonischen Gesetze befolgten und mir ewig dankbar wären. Deshalb trafen Hugh und ich uns am Mittwochmorgen, genau zur Hälfte der Ferienwoche, mit einer Immobilienmaklerin namens Phyllis, die uns eine Reihe zum Verkauf stehender Häuser zeigte. Am Freitagnachmittag machten wir ein Angebot für ein Cottage direkt am Meer, nicht weit von unserem gemieteten Ferienhaus, und noch vor Sonnenuntergang war der Kauf perfekt. Ich verkündete die Nachricht beim Abendessen und erntete genau die Reaktionen, die ich erwartet hatte.
»Also, Augenblick mal«, sagte mein Vater. »So was will gut überlegt sein.«
»Ist es«, erwiderte ich.
»Okay, also, wie alt ist das Dach? Wie oft ist es in den vergangenen zehn Jahren erneuert worden?«
»Wann können wir einziehen?«, fragte Gretchen.
Lisa wollte wissen, ob sie ihre Hunde mitbringen könne, und Amy fragte, wie das Haus hieße.
»Momentan heißt es Toll-Haus«, sagte ich, »aber wir werden es umbenennen.« Früher war Klar Schiff immer mein Lieblingsname für ein Strandhaus gewesen. Inzwischen hatte ich eine bessere Idee. »Wir nennen es Die See-Zierung.«
Mein Vater legte seinen Hamburger auf den Teller. »Oh, ganz bestimmt nicht.«
»Aber der Name ist ideal«, sagte ich. »Er sollte etwas mit Meer zu tun haben, und wenn ein Wortspiel drinsteckt, umso besser.«
Als ich hinzufügte, dass wir am Vormittag ein Haus mit dem Namen Wir Dünamischen gesehen hatten, zuckte mein Vater zusammen. »Wie wär’s denn mit Tiffany?«, sagte er.
Das allseitige Schweigen bedeutete: Tun wir so, als hätten wir das nicht gehört.
Er nahm seinen Hamburger wieder in die Hand. »Ich finde die Idee großartig. Damit erweisen wir ihr unseren Respekt.«
»Wenn es darum ginge, könnten wir ihm auch Moms Namen geben«, erwiderte ich. »Oder es halb nach Tiffany und halb nach Mom nennen. Aber es ist ein Haus, kein Mausoleum, und der Name würde auch nicht zu den anderen Häusern passen.«
»Ach, Unsinn«, sagte mein Vater. »Wer will schon zu irgendwem passen? Das wollten wir noch nie.«
Paul warf umgehend »Muschelspieler« in die Runde.
Amys Vorschlag enthielt das Wort »Spermwal«, und Gretchens war noch schweinischer.
»Was gefällt euch denn nicht an dem jetzigen Namen?«, fragte Lisa.
»Nein, nein, nein«, sagte mein Vater, der offenbar vergaß, dass er dies gar nicht zu entscheiden hatte. Einige Tage später, als die Reue über den Kauf einsetzte, fragte ich mich, ob ich das Haus nur gekauft hatte, um sagen zu können: Seht her, so einfach geht das. Ohne langes Hin und Her. Ohne darum zu bitten, die Klärgrube inspizieren zu dürfen. Zuerst macht man die Familie glücklich, und um die Details kümmert man sich später.