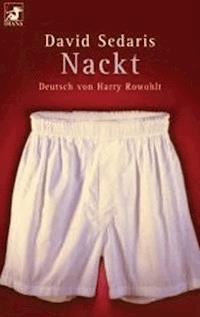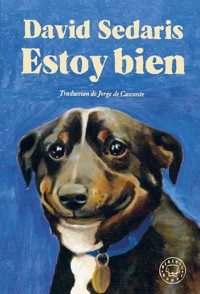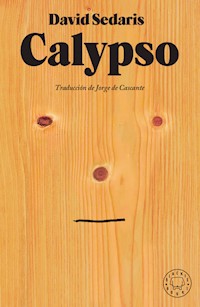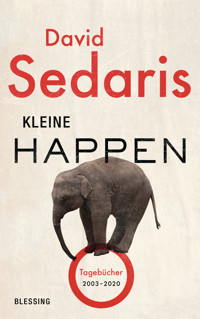
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In seinen zum Kult gewordenen Aufzeichnungen erkundet David Sedaris seltsame Frisuren, passiv-aggressive Konversationen in Postämtern und verunglückte Pointen des Smalltalks. Keinen schmutzigen Witz unterschlagend untermauert Sedaris seine Qualitäten als brillanter Beobachter und sein einzigartiges Ohr für das Bizarre.
Seine Tagebücher erinnern uns daran, dass wir einst George W. Bush gehasst haben und dass Donald Trump vor nicht allzu langer Zeit nur eine harmlose Witzfigur war. Die Zeit vergeht und Sedaris dokumentiert sie, an seinem Schreibtisch oder im Flugzeug, in Speisesälen von Hotels und schrägen japanischen Pensionen. Aus den kleinen Alltagsgeschichten wird ein Abbild des politischen Weltverlaufs, mal süß, mal bitter im Abgang, aber immer lustig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 804
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ZUMBUCH
Im zweiten Band seiner zum Kult gewordenen Aufzeichnungen erkundet David Sedaris seltsame Frisuren, passiv-aggressive Konversationen in Postämtern und verunglückte Pointen des Smalltalks. Es geht um Mäuse und Müll und darum, dass der Schlussverkauf bei Comme des Garçons genau einen Tag nach seiner Abreise aus Paris stattfindet. So ein verdammtes Pech!
Keinen schmutzigen Witz unterschlagend untermauert Sedaris seine Qualitäten als brillanter Beobachter und sein einzigartiges Ohr für das Bizarre. Seine Tagebücher erinnern uns daran, dass wir einst George W. Bush gehasst haben und dass Donald Trump vor nicht allzu langer Zeit nur eine harmlose Witzfigur war. Die Zeit vergeht und Sedaris dokumentiert sie, an seinem Schreibtisch oder im Flugzeug, in Speisesälen von Hotels und schrägen japanischen Pensionen. Aus den kleinen Alltagsgeschichten wird ein Abbild des politischen Weltverlaufs, mal süß, mal bitter im Abgang, aber immer lustig.
ZUMAUTOR
David Sedaris, geboren 1956 in Johnson City, New York, aufgewachsen in Raleigh, North Carolina, lebt in England. Er schreibt u. a. für den New Yorker und BBC Radio 4. Mit seinen Büchern Naked, Fuselfieber, Ich ein Tag sprechen hübsch und Schöner wird‘s nicht wurde er zum Bestsellerautor. Zuletzt erschienen im Blessing Verlag Das Leben ist kein Streichelzoo. Fiese Fabeln (2011), Sprechen wir über Eulen – und Diabetes (2013), Calypso (2018) und Bitte lächeln! (2023) sowie 2017 seine vielbeachteten Tagebücher Wer’s findet, dem gehört’s.
David Sedaris
KLEINEHAPPEN
Tagebücher
(2003 – 2020)
Aus dem Amerikanischen von Georg Deggerich
BLESSING
Die Originalausgabe A CARNIVALOFSNACKERY. DIARIES (2003-2020) erschien erstmals 2021 bei Little, Brown and Company, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by David Sedaris
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
by Karl Blessing Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Barbara Häusler
Umschlaggestaltung: SERIFA, Christian Otto
nach einem Originalentwurf von © 2021 Hachette Book Group, Inc.
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-27778-9V001
www.blessing-verlag.de
Für Ken Shorr
Anmerkung des Autors:
In diesem Buch habe ich vereinzelt die Namen von Personen verändert oder ihr Aussehen abgewandelt. Behutsame Überarbeitungen habe ich dort vorgenommen, wo der Text unklar war, der weitaus größte Teil der Tagebücher wurde jedoch unverändert übernommen.
Einleitung
Beim Lesen der Tagebucheinträge aus achtzehn Jahren für diesen zweiten Band sind mir einige Dinge aufgefallen. Als Erstes, dass es in meinem Leben viele Mäuse gibt. Sie finden mindestens dreihundert Mal Erwähnung, womöglich noch öfter. Sie sind mir daheim im Haus und im Garten über den Weg gelaufen. In Restaurants und in Banken. Ich bin sogar Mäusen im Urlaub begegnet! (Meinem, nicht ihrem.) Hinzu kommen Mäusegeschichten von Freunden oder Videos auf YouTube, in denen Mäuse Schlangen oder Schnappschildkröten zum Fraß vorgeworfen werden. Zusammengenommen würden diese Einträge ein eigenes Buch ergeben, eine Art Thriller für Katzen. Der einzige mäusefreie Ort ist New York, allerdings habe ich dort ein Problem mit Ratten – nicht in meinem Apartment, Gott sei Dank, aber sie belagern es und versuchen hineinzukommen. In einem Eintrag, den ich im Nachhinein streichen musste, ging es um eine Ratte, die ich um zwei Uhr nachts mit einem Erdnussflip im Maul am Times Square sah. Ein paar Wochen später entdeckte ich bei einem Spaziergang in West Sussex eine verletzte Ratte in einer Papiertüte. Ich bin sicher, selbst wenn ich mich auf dem Mond niederließe, würde ich dort auf der Arbeitsplatte in der Küche Mäusekötel finden.
Weiter gibt es eine übermäßig große Zahl von Einträgen, die auf die eine oder andere Art mit dem Reisen zu tun haben. Warum diese ewigen Flughafengeschichten?, fragte ich mich, als ich in den 1980er-Jahren Komiker im Fernsehen sah. Könnt ihr euch zur Abwechslung nicht mal was anderes einfallen lassen? Dann begannen meine eigenen Lesetouren und mir ging auf, wie viel Zeit diese Menschen damit verbringen, von einem Ort zum anderen zu gelangen. Wo immer Autos, Züge, Busse und Flugzeuge auftauchen, sind Spannungen und Unbilden nicht fern. Da ich nichts fesselnder finde, gibt es in meinen Tagebüchern unzählige Reisegeschichten, in denen häufig Chauffeure auftauchen. Das mag ziemlich großspurig klingen, aber ich werde nur durch die Gegend kutschiert, wenn ich auf Lesereise bin. Manchmal von einer Stadt zur nächsten, aber weitaus häufiger lädt man mich an irgendeinem Flughafen ein und bringt mich zu meinem Hotel. Hätte ich einen Führerschein, könnte ich mir einen Wagen mieten und selbst fahren, aber wie viele großartige Begegnungen wären mir da entgangen, die vielen Hundert Männer und Frauen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin und die mich überrascht und entzückt haben.
Es gibt auch sehr viele Einträge über Müll. Von 2010 an finden sich – zumindest, wenn ich mich in Großbritannien aufhielt – täglich ausufernde Berichte über die Anzahl der Dosen und Flaschen, die ich am jeweiligen Nachmittag eingesammelt habe, über am Straßenrand deponierte Säcke mit Hausmüll, über Toaster und Bauschutt. Reiste ich dann in ein anderes Land, schrieb ich über den Müll, den ich dort nicht sah. Vermutlich ist die Geduld jedes Lesers irgendwann erschöpft.
Gänzlich ausgelassen sind die unzähligen Zitate, die ich in Büchern und Zeitschriften gefunden habe, einzelne Sätze oder Abschnitte, die mir besonders schön oder gelungen vorkamen. Beispielsweise habe ich vieles aus Mavis Gallants Tagebüchern kopiert, wovon nichts in diesem Buch auftaucht, weil es Abdruckgenehmigungen erfordert hätte. Das schmerzt mich umso mehr, da mir die Zitate einen intellektuellen Anstrich gaben. Verzichtet habe ich auch auf mein Urteil über Bücher, die mich in all den Jahren enttäuscht haben. Schon immer habe ich mich für Autoren begeistern können, die ihre Zeitgenossen verunglimpfen und ständig Streit suchen, aber ich selbst möchte nicht zu diesen Leuten gehören.
Einige Einträge mögen überspitzt erscheinen, was zweifellos zutrifft. Wenn mir etwas besonders Interessantes widerfährt – etwa, wenn mir in einem der Restaurants von Cracker Barrel ein Affe begegnet oder eine Frau mir erzählt, ihrem Cousin seien in Mexiko beide Arme von Schweinen abgefressen worden –, gebe ich mir beim Eintrag ins Tagebuch besondere Mühe, weil ich weiß, dass ich es vermutlich auf der Bühne vorlesen werde. Fast alle diese Einträge laufen auf eine Pointe hinaus. Sie schwenken kleine Flaggen mit der Botschaft: Hey, hier komme ich! Viele dieser Einträge, die vor Publikum gut funktionieren, habe ich herausgestrichen, weil sie mir zu konstruiert und zu selbstgefällig erschienen. Andere wiederum habe ich behalten, ich meine, Schweine, die Leuten die Arme abfressen?
Wie schon der erste Band enthält dieses Buch zahllose Witze, die ich auf Partys und beim Signieren nach Lesungen gehört habe. Am liebsten hätte ich sie alle aufgenommen – die guten wie die schlechten –, aber in Zeiten wie diesen hätte mein Verleger die zu erwartende gewaltige Flut an Hassmails wohl kaum überstanden. Oh, anstößige Witze … wann, wenn überhaupt, wird eure Zeit wiederkommen?
Wie bei meinem ersten Tagebuchband Wer’s findet, dem gehört’s sei der Leser daran erinnert, dass es sich um meine Auswahl handelt und nur einen Bruchteil dessen darstellt, was ich in den vergangenen achtzehn Jahren für mich selbst aufgeschrieben habe. Ich habe mir keine besondere Mühe gegeben, möglichst nachdenklich oder tugendhaft zu erscheinen, aber ich könnte spielend sehr, sehr viel schlechter als auf diesen Seiten aussehen. Auch diesmal habe ich Einträge ausgewählt, die mir auf irgendeine Art lustig oder erstaunlich erschienen. Wer’s findet, dem gehört’s, der die Jahre 1997 bis 2002 umfasste, besaß einen Erzählbogen. »David Copperfield Sedaris« nannte ihn Hugh. Sollte auch dieser Band über einen solchen Bogen verfügen, wüsste ich nicht, welchen. Die Person, die ich am Ende des ersten Bandes war, ist zweifellos älter, aber nicht reifer geworden. Mit einiger Sicherheit lässt sich sagen, dass ich heute verwöhnter und ungeduldiger bin. Bei der Lektüre meiner Aufzeichnungen musste ich oft an Dorothy Parkers From the Diary of a New York Lady During Days of Horror, Despair, and World Change denken. Krieg und Unglück zuhauf – Naturkatastrophen, Flüchtlingsströme, Rassenunruhen –, und ich beklage mich, dass der Schlussverkauf bei Comme des Garçons genau einen Tag nach meiner Abreise aus Paris stattfindet, um in Zürich einen Preis in Empfang zu nehmen. So ein verdammtes Pech aber auch! Zu meiner Ehrenrettung sei gesagt, dass auch von Politik und aktuellen Ereignissen die Rede ist. Tatsächlich verfolge ich das Tagesgeschehen sehr genau, auch wenn man es nach der Lektüre dieses Buches nicht vermuten würde. Dass ich nur wenige dieser Einträge aufgenommen habe, liegt vermutlich daran, dass andere das sehr viel besser und mit weitaus mehr Autorität als ich können. Und wenn ich ehrlich bin, vor die Wahl gestellt, über die Unruhen des Arabischen Frühlings oder einen Bettler auf der Straße zu schreiben, der – wie ich es kürzlich erlebt habe – einer Frau vor ihm zuruft: »He, Sie haben ein Loch im Arsch!«, würde ich mich für Letzteres entscheiden.
Obwohl Sie das vermutlich längst wussten.
2003
16. Januar 2003
London, England
Drinks und anschließend Abendessen in Fulham mit Janes Freunden Allison und Ian. Sie ist zweiundfünfzig, Amerikanerin mit dichtem, schulterlangem Haar und dem leeren Blick einer chronischen Alkoholikerin. Bereits als wir kamen, hatte Allison puterrote Lippen vom Wein. »He«, sagte sie. »Stellt euch vor! Vorhin ist mir einfach so ein Zahn ausgefallen! Unglaublich, oder? Jetzt habe ich da ein dickes Loch.« Sie nahm den Zahn vom Kaminsims und gab ihn uns zur genaueren Untersuchung. Es war ein Backenzahn mit einer Goldkrone. »Zieht bloß nie nach England«, sagte sie warnend. Und dann: »Wollt ihr ihn haben?«
Das Seltsame war, dass es überhaupt nicht geblutet hatte. In ihrem Mund war einfach nur ein trockenes Loch, ohne Schmerzen oder Schwellung. Allison neigte zu ausladenden, albernen Gesten. Mitten im Satz hielt sie inne, zeigte mit der Hand von einem zu anderen und hob die Schultern wie eine Pantomimin. Sie sagte Wörter wie verdammt oder zum Teufel und legte anschließend beide Hände vor den Mund. Jede ihrer Geschichten wurde von irgendeinem Firlefanz unterbrochen. Ian, ihr schottischer Ehemann, war etwas älter und gut aussehend. Auch er hatte getrunken, konnte es aber besser wegstecken. »Nun denn, altes Haus«, sagte er, als es Zeit zum Essen wurde. »Wir müssen los. Die Leute haben Hunger.« Er nahm Allison das Bourbon-Glas aus der Hand, und sie nannte ihn einen Obermacker.
»Aber Jane ist hier«, jammerte sie. »Das ist etwas Besonderes!«
Wir aßen bei einem Inder um die Ecke. Ich saß neben Ian, der mir die hoch komplizierten Feinheiten des Lobens und Strafens an seinem ehemaligen Internat erklärte. Wenn das Rugby-Shirt mehr als zweimal im Semester vom Haken rutschte, wurde man aus dem Bett geholt und in die sogenannte Piffery gebracht, einen hohen Raum, in dem nichts außer einer Tischtennisplatte stand. Dort musste man seinen Schlafanzug ausziehen und seinen Hintern dem Stock präsentieren. »Ich glaube nicht, dass es Bambus war«, sagte er, als ich nach der Holzart fragte. »Nein, ich glaube, es war Walnuss oder Birke.«
Während Ian sich mit Hugh und mir unterhielt, stieg Allison von Wein auf Brandy um. Als wir das Restaurant verließen, wankte sie beträchtlich, was zum Teil am Alkohol und zum Teil an ihren kaputten Knien lag.
21. Januar 2003
London
Gestern Abend telefonierte ich mit (meinem Agenten) Don, der offenbar das Wort Seite vergessen hat. »Sie wollen mindestens zweihundert Kapitel, ich meine, nicht Kapitel, sondern … äh …«
Das passiert immer häufiger, und wenn ich helfen will, weiß ich nie, ob ich wie ein Franzose klinge, der im Gespräch mit mir ins Englische wechselt. »Zweihundert Seiten?«
»Genau das.«
23. Januar 2003
London
Gestern spazierten Hugh und ich nach Maida Vale. In der Nähe von Bayswater entdeckten wir ein Fliesengeschäft und sahen uns drinnen einige Muster an, als ein Mann eintrat. Er war Jamaikaner und fragte die Frau hinter der Theke nach einer bestimmten Straße. »Die nächste Straße ist eine Einbahnstraße«, erklärte die Verkäuferin ihm. »Sie müssen also eine weiterfahren und dann scharf links abbiegen. Es ist ganz in der Nähe.«
Dann fragte der Mann, ob die Frau mit ihm fahren würde. »Als Beifahrerin, um mir den Weg zu zeigen.«
»Nun«, sagte sie vorsichtig, »das geht nicht, wissen Sie, weil mein Vorgesetzter am Telefon ist und ich die Einzige bin, die hier die Stellung halten kann.«
»Na schön«, sagte der Mann. »Dann warten wir einfach, bis Ihr Vorgesetzter aufgelegt hat.«
Es war ein abstruser Vorschlag, und ich sah, wie die Frau in Panik geriet. »Es ist wirklich nicht weit von hier«, sagte sie. »Sie finden es. Ganz bestimmt!«
18. Februar 2003
London
Auf dem Weg zum Tesco-Supermarkt am Sonntagnachmittag spürte ich plötzlich einen Schlag mitten auf den Rücken. Nicht wie mit einem spitzen Gegenstand, sondern eher ein flaches Klatschen, als würde einem jemand ein bisschen zu feste gratulieren. Ich hatte einen Walkman auf und sah auf den Boden, deshalb dauerte es einen Moment, bis ich erkannte, dass ich von einer Gruppe Jungs überholt wurde, die mit ihren Fahrrädern auf dem Bürgersteig fuhren. Ich hatte sie gerade registriert, als ein zweiter Junge von hinten kam und mir seitlich gegen den Kopf schlug. Moment mal, dachte ich, während sie davonflitzten. Das könnt ihr nicht machen. Ich bin ein Erwachsener!
Ein Stück weiter den Bürgersteig entlang schlugen sie zwei weitere Männer und kurz danach eine Frau, die ihren Hund ausführte. Ich malte mir aus, was ich mit ihnen tun würde, sollte ich sie je zu fassen kriegen, aber es war heikel, weil es Kinder waren. Die Vorstellung, einen Zehnjährigen zu schlagen, ist bestenfalls rabiat, also ließ ich von den Jungs ab und konzentrierte mich auf die Fahrräder, indem ich im Geist die Reifen durchlöcherte und die Speichen mit dem Schuhabsatz zertrat. Die meiste Zeit aber fragte ich mich, ob sie sich in einem Jahr daran erinnern würden, einen kleinen Mann auf den Kopf geschlagen zu haben. Wäre ihnen mein Bild noch im Gedächtnis, oder hätten sie bis dahin so viele Leute geschlagen, dass sie sich an einzelne Gesichter nicht erinnern könnten?
1970 hatten Dan Thompson und ich einem Fahrer den Finger gezeigt, als wir mit dem Fahrrad die Shelley Road entlangfuhren. Er hatte uns von der Straße gedrängt, jedenfalls aus unserer Sicht, und als er unsere Geste sah, hielt er an und stieg aus. Der Mann rührte mich nicht an, aber er packte mit beiden Händen meinen Lenker. »Bürschchen«, sagte er, »ich sollte dir deine Zahnspange tief in deinen verdammten Rachen schlagen.« Wäre er einfach weitergefahren, hätte ich die ganze Sache vergessen, doch stattdessen hatte er mir gedroht und sich so für immer in mein Gedächtnis eingegraben.
Als ich den Tesco erreichte, war die ganze Horde davor versammelt. Zuerst wollte ich sagen: Entschuldigung, aber einer von euch hat mich vorhin versehentlich am Kopf getroffen und möchte sich sicherlich gerne entschuldigen. Es waren Kinder. Es würde keine Schlägerei geben und auch kein Klappmesser aus einem Stiefel gezogen, ich kniff jedoch trotzdem und hasste mich den restlichen Tag über dafür, ein solcher Feigling zu sein.
26. Februar 2003
London
Auf der Rückfahrt von Wandsworth wurde ich Zeuge, wie ein Inder sich an einem Schwarzen vorbeidrängte, der gerade beim Busfahrer seinen Fahrschein bezahlte. »Verpiss dich«, sagte der Inder, als der Schwarze ihn vorwurfsvoll ansah. »Na los, verpiss dich.« Der Inder war groß und schlank. Sein Kopf war obenrum kahl, ein blanker Fleck, der von glänzenden, schulterlangen Haaren umgeben war.
»Nein«, sagte der Schwarze, »du verpisst dich.«
»Du verpisst dich.«
»Nein, du verpisst dich.«
Die beiden Männer gingen in den hinteren Teil des Busses, und für einen Moment glaubte ich, es käme zu einer Prügelei.
»Scheiß N…«, sagte der Inder.
»He, ohne mich wärst du nicht mal hier«, erwiderte der Schwarze. Ich vermutete, er redete von Afrika als die Wiege der Zivilisation.
»Verpiss dich«, wiederholte der Inder. »Wenn du wissen willst, wo ich herkomme, frag deine Mutter. Ich hab sie nämlich gefickt.«
»Nein, ich habe deine Mutter gefickt«, sagte der Schwarze.
»Hast du nicht.«
»Hab ich wohl. Frag sie doch.«
»Deine Mutter ist ein Affe.«
»Deine Mutter ist ein Affe, nicht meine.«
»Verpiss dich.«
»Nein, du verpisst dich.«
Der Bus hielt, um weitere Fahrgäste zusteigen zu lassen, und die beiden Männer verstummten. Ich fragte mich, ob sie wohl während der restlichen Fahrt über ihren Streit nachdachten. Überlegten sie, was als Nächstes geschehen könnte, oder akzeptierten beide, dass es vorbei war? Anstelle des Schwarzen hätte ich mir dieses ganze Getue mit »Ich hab deine Mutter gefickt« geschenkt und mich geradewegs auf die kahle Stelle verlegt, die ganz offensichtlich die Achillesferse des Inders war. Die Art, wie er sein Resthaar arrangierte, deutete darauf hin, dass er in diesem Punkt sehr empfindlich war, wohingegen man nicht sicher sein konnte, wie er über seine Mutter dachte.
21. März 2003
Paris, Frankreich
Sie haben alle Métro-Linien geschlossen, die unter der amerikanischen Botschaft hindurchführen. Davor wurde eine Mauer errichtet, und Polizisten riegelten die Place de la Concorde ab. Ich hatte noch Zeit bis zu meinem Termin beim Parodontologen und sah zu, wie eine Gruppe Studenten die Rue Royale entlang zur Madeleine marschierten. Es war schwer zu verstehen, aber es klang so, als riefen sie »Boom Chaka Khan«.
Auf dem Nachhauseweg von Dr. Guig sah ich die Demonstranten wieder und fand heraus, dass sie »Bush est un assassin« – Bush ist ein Mörder – riefen. Überall in der Stadt gab es Kundgebungen, die ich mehr oder weniger den ganzen Tag über mitverfolgte. Wenn das die Reaktion darauf ist, dass Frankreich den Krieg aussitzt, kann ich mir nicht vorstellen, was passiert wäre, hätte Chirac Truppen ausgesandt.
° ° °
Letzte Woche wurde Hugh von der Wochenzeitung Orne Combattante interviewt, die ihn nach seiner Meinung zum Irakkrieg befragte. Gestern brachte Pierre ein Exemplar der entsprechenden Ausgabe mit zu seinem Lieblingsvietnamesen im sechsten Arrondissement, wo wir zum Abendessen verabredet waren. Er warf die Zeitung auf den Tisch und erklärte, Hugh, der Bush in Grund und Boden gestampft hatte, sei ein Verräter. Ich hätte gerne erfahren, was Pierre über Jacques Chirac dachte, aber er war zu sehr damit beschäftigt, mit der Amerikanerin am Nebentisch zu flirten. »Nur damit Sie wissen, was für ein charmanter Mensch ich bin: Meine beiden Lieblingsfilme sind Sleepless in Seattle und You’ve Got Mail«, sagte er.
23. März 2003
Paris
Während die International Herald Tribune die amerikanische Initiative unterstützt, französische Wörter und Produkte von Speisekarten in Restaurants zu verbannen, berichtet die BBC, die Jordanier würden von amerikanischen Zigaretten auf ziemlich brutal schmeckende Gauloises umsteigen, was wirklich ein erheblich größeres Opfer ist. Die Zeitung vom Donnerstag zeigte Bilder von wütenden Bewohnern des Mittleren Westens, die Bordeauxweine in den Mississippi kippten. Im französischen Fernsehen sah ich eine Reportage über eine Handvoll Antikriegsdemonstranten mittleren Alters aus einer Kleinstadt in Massachusetts. Es gehört nicht viel dazu, sich einer Menge von mehreren Tausend anderen anzuschließen, aber diese Leute stehen praktisch allein da und sind nun bei ihren Nachbarn verhasst. Die kleine Gruppe lief gerade am Rathaus vorbei, als ein Mann auf sie zustürzte, sie anrempelte und rief: »Ich hasse die Franzosen. Ich möchte sie töten.« Es war sehr seltsam, das ins Französische übersetzt zu hören.
24. März 2003
New York
Bei der Feier zur Verleihung der Academy Awards verzichten sie in diesem Jahr auf den roten Teppich, und erst gestern hieß es, etliche Stars würden der Veranstaltung fernbleiben, einige aus Sicherheitsgründen, andere, weil sie gegen den Krieg seien, und wieder andere, weil sie fänden, dies sei eher eine Zeit für stilles Nachdenken. In der gestrigen Financial Times wurde der Präsident der Academy mit dem Satz zitiert, die Verleihung der Oscars sei unsere patriotische Pflicht. Er erläuterte nicht, inwiefern, aber andererseits macht das ja keiner. Alle sagen nur, es sei deine patriotische Pflicht, und alle geben sich irgendwie damit zufrieden.
Der amerikanische Senfproduzent French’s Mustard hat eine Pressemitteilung herausgegeben, in welcher er erklärt, French sei der Familienname der Firmengründer und habe nichts mit Frankreich oder dem Verhalten des Präsidenten dieses Landes oder seines UN-Botschafters zu tun. »Wir stehen für Baseball Games und Picknicks am 4. Juli«, sagen sie. »Wir repräsentieren Amerika in seiner ganzen Größe.«
Unser Taxifahrer auf der Fahrt vom JFK war enttäuscht. Offenbar hatte er sich einen weiblichen Fahrgast gewünscht, und nun hatte er uns abbekommen. »Ich mag Ladys«, sagte er. »Sie erinnern mich an die Mutter meines Babys. Sie erinnern mich an Mommy.«
Es herrschte dichter Verkehr, und während der Fahrt hörte er den Sender Hot 101. Das Nachmittagsprogramm wurde von Wendy Williams moderiert, die zwischen den Songs Anrufe von Hörern entgegennahm, die ihr versicherten, wie großartig sie sei. Noch ehe wir Queens durchquert hatten, drohte Hugh damit, zurück nach Frankreich zu fliegen. »Ich weiß, wie man die Irakis aus Bagdad vertreibt«, sagte er. »Vergiss die Bomben, zwing sie einfach dazu, diesen gottverdammten Sender zu hören.«
9. April 2003
Princeton, New Jersey
Je kleiner der Flughafen, desto schrecklicher das Sicherheitspersonal. Nehmen wir nur Madison, Wisconsin. Als ich gestern Morgen dort eincheckte, entdeckte ich unten auf meinem Boarding Pass die gefürchteten vier S (Secondary Security Screening Selection) für eine besonders gründliche Sicherheitsüberprüfung. Die Frau am Schalter sagte, es sei reiner Zufall, aber American Airlines hat es immer auf mich abgesehen, vermutlich wegen der vielen One-Way-Flüge. Ein grauhaariger Mann bat mich um meinen Koffer, und nachdem ich ihn ihm übergeben hatte, ging ich nach draußen eine rauchen. Als ich wiederkam, sah ich den Typen und seinen Kompagnon in meinen Sachen wühlen. Sie zogen die deutsche Übersetzung von Me Talk Pretty One Day heraus und blätterten mit finsteren Blicken darin herum, als hätten sie ein geheimes Dokument mit den Positionsdaten eines Panzergeschwaders entdeckt. Es war ein merkwürdiges Gefühl, unbemerkt Leuten beim Durchwühlen deiner Sachen zuzuschauen. Sie leerten meinen Kulturbeutel und packten die Dose aus, die ich für Ronnie als Geschenk für ihre Wohnungseinweihung gekauft hatte. Als sie meine Zigaretten inspizierten, trat ich vor und fragte sie, was sie da machten. »Wir durchsuchen Ihren Koffer«, sagte der grauhaarige Mann. Und dann setzte er seine Arbeit fort.
12. April 2003
Wilmington, North Carolina
Bevor ich Austin verließ, hörte ich im Radio einen Bericht über einen Engländer, der Preise für stumpfsinnige Sicherheitsmaßnahmen vergibt. Der erste Preis geht an einen Sicherheitsmann am Flughafen, der eine Passagierin zwang, aus drei Fläschchen mit ihrer eigenen Muttermilch zu trinken. Sie hatte sie vor dem Boarden abgepumpt, und sie wollten sicherstellen, dass es sich nicht um Gift handelte. Das erklärt, weshalb Samenspender mit dem Greyhound reisen.
29. April 2003
Paris
Am Sonntag besuchte Hugh mit seinem alten Freund Jeff Raven ein Spiel der Mets. Gestern rief er an und verkündete, er sei jetzt großer Baseballfan, und gab sich Mühe, wie ein richtiger Macho zu klingen. »Jeffs Sohn musste zu einem Fußballspiel, deshalb mussten wir schon im sechsten Inning gehen«, sagte er. »Ich habe mir den Rest im Fernsehen angeschaut und heute früh die Besprechung in der Zeitung gelesen.«
Besprechung?
29. Mai 2003
La Bagotière, Frankreich
Auf meiner Lesereise durch die Vereinigten Staaten habe ich wieder und wieder gesagt, die Franzosen seien genervt von George Bush, könnten zwischen dem amerikanischen Volk und der amerikanischen Regierung aber sehr wohl unterscheiden. Das Publikum applaudierte jedes Mal, und ich stand da und dachte: Wenn es bloß wahr wäre. Selbst Manuela verzichtet inzwischen auf den Hinweis auf George Bush und richtet ihre Kritik an die Amerikaner im Allgemeinen. »Ich kann nichts dafür«, sagt sie. »Es ist eben viel einfacher.«
Gestern Vormittag sah ich in Montparnasse ein Plakat für Extreme Rage, den neuen Film mit Vin Diesel. Quer über das Gesicht des Schauspielers hatte jemand geschrieben: US go your fucking home.
5. Juni 2003
Paris
Gestern Abend sah ich im Fernsehen einen Ausschnitt aus dem Wettbewerb zur Wahl der Miss Universe. Da es sich um eine amerikanische Produktion handelte, wurde sie auf Englisch gezeigt und aus dem Off auf Französisch von einem Paar kommentiert, das sich gnadenlos über die hohlen Moderatoren lustig machte. Die fünf Finalistinnen traten im Abendkleid auf die Bühne, und die arme Miss Serbien und Montenegro wurde gefragt: »Wenn Sie die Wahl hätten, was wären Sie lieber, Feuer oder Wasser?«
»Damit wären die Probleme der Menschheit gelöst«, sagte der französische Kommentator. Die Kamera machte einen Schnitt auf Donald Trump, der mit beiden Händen unterm Kinn im Publikum saß.
»Wie abscheulich«, sagte die Kommentatorin. »Ein Monster!«
Miss Serbien und Montenegro starrte einen Moment auf das Mikrofon, verunsichert, ob sie die Frage richtig verstanden hatte. »Ich bin ein Mensch«, sagte sie. »Eine junge Frau mit Gefühlen, deshalb weiß ich nicht, wie es ist, ein Element zu sein, das nichts dergleichen kennt. Da ich eine solche Wahl nicht treffen kann, bleibe ich lieber ich selbst.«
Sie war nicht die Gewinnerin.
11. Juni 2003
Paris
Gestern Abend ging ich mit einer Iranerin namens Marjane essen, die mir folgenden Witz erzählte:
Eine Frau kommt mit einem großen Koffer in die Französische Zentralbank und sagt dem Präsidenten, sie würde gerne zehn Millionen Euro einzahlen. Er sieht beeindruckt auf das Geld und fragt, womit sie ihren Lebensunterhalt verdiene.
»Oh«, sagt sie. »Ich schließe Wetten mit Leuten ab. Ich würde zum Beispiel hunderttausend Euro darauf wetten, dass Sie rechteckige Hoden haben, wie Würfel, nur etwas größer.«
Der Präsident der Bank nimmt die Wette an, lässt die Hose herunter und demonstriert, dass er keine rechteckigen Hoden hat, sondern ovale, wie Eier.
»Okay, Sie haben gewonnen«, sagt die Frau. »Aber wenn Sie einverstanden sind, komme ich morgen wieder und gebe Ihnen das Geld. Ich bringe meinen Anwalt mit, und wenn der offiziell bestätigt hat, dass ich die Wette verloren habe, bekommen Sie Ihr Geld.«
Am nächsten Nachmittag erscheint die Frau in Begleitung ihres Anwalts. »Wenn Sie nichts dagegen haben«, sagt sie zu dem Präsidenten, »möchte ich Sie bitten, mir noch einmal Ihre Hoden zu zeigen, damit mein Anwalt sich selbst überzeugen kann.«
Der Präsident lässt die Hose herunter.
»Und wenn ich Sie um noch etwas bitten dürfte«, fährt sie fort, »würde ich sie gerne anfassen, nur um absolut sicher zu sein, dass sie nicht rechteckig sind.«
»Na schön«, sagt er.
Die Frau beugt sich herab, und als sie die Hoden des Mannes in die Hand nimmt, beginnt der Anwalt, seinen Kopf gegen die Wand zu schlagen.
»Was hat er denn?«, fragt der Präsident.
»Oh«, sagt die Frau. »Ich habe mit ihm um eine Million Euro gewettet, dass ich es schaffe, dem Präsidenten der Französischen Zentralbank die Eier zu kraulen.«
24. Juni 2003
Paris
Gestern Abend waren Hugh und ich mit zwei amerikanischen Freunden essen. Sie hatten eine Freundin mitgebracht, ebenfalls Amerikanerin, die seit zwanzig Jahren in Paris lebt. Deborah wohnt in einer ehemaligen Fabrik für Polizeiuniformen, einem kleinen, dreistöckigen Gebäude, das versteckt in einem Innenhof liegt. Sie bewohnt den zweiten und dritten Stock und hat auf dem Dach einen Garten angelegt. Im Erdgeschoss wohnt eine Französin, die sehr verängstigt war, nachdem man bei ihr eingebrochen und die Wohnung ausgeräumt hatte. Deborah versprach, Augen und Ohren offen zu halten, und wurde aktiv, als sie eine oder zwei Wochen später ihre Nachbarin »Halt, bitte, hört auf« schreien hörte.
Es klang, als würde die Frau vergewaltigt, deshalb rannte Deborah nach unten und hämmerte gegen ihre Tür. Als niemand öffnete, ging sie wieder nach oben und rief die Polizei an, wo man ihr sagte, ihre Nachbarin hätte vermutlich schlicht Sex.
Deborah erklärte, die Frau habe das Verb aufhören in einer Form gebraucht, die sich an mehrere Personen richtete, worauf der Beamte erwiderte: »Na … dann hat sie wohl Sex mit zwei Männern.« Anschließend kam er auf Deborahs amerikanischen Akzent zu sprechen und deutete an, sie müsse noch viel über französische Frauen lernen.
»Und Sie müssen noch viel über amerikanische Frauen lernen«, gab Deborah zurück. Dann verlangte sie seinen Namen und seine Dienstnummer, und als klar war, dass es Ärger geben würde, schickte der Beamte zwei Polizisten vorbei, die gegen die Tür hämmerten und feststellten, dass die Frau Sex mit zwei Männern hatte.
8. August 2003
La Bagotière
Es herrschten achtunddreißig Grad, als wir Villedieu auf halber Strecke zwischen hier und Granville erreichten. In der Stadt drängelten sich die Touristen, die alle auf der schattigen Seite der Straße liefen. Es war zu heiß, um essen zu gehen oder eine der Kupferwerkstätten ohne Klimaanlage zu besuchen, für die die Gegend bekannt ist, sodass sich alles auf dem Marktplatz versammelte und über die Hitzewelle redete.
Wir hatten am Stadtrand geparkt und waren auf dem Weg zurück zum Wagen, als mit Lautsprechern bestückte Lastwagen an uns vorbeifuhren und den Auftritt eines kleinen Wanderzirkus ankündigten. Die Wagen transportierten Käfige mit in der Hitze brütenden Tieren. Im ersten waren zwei Zwergponys, zwei Lamas und ein kniendes Kamel. »Guck mal, ein Kamel!«, sagten die Leute. Im zweiten Käfig waren ein hechelnder Tiger und seine zwei Jungen. Ihre Zungen hingen praktisch bis zum Boden, und man konnte den Eindruck gewinnen, sollten sie freikommen, würden sie einen schlimmstenfalls vollsabbern. Immerhin bekommt man nicht jeden Tag einen Tiger zu sehen.
Unser Hotel in Granville lag direkt am Meer, zwischen dem Casino und einer Rehaklinik für Schlaganfall- und Unfallopfer. Einige der Patienten saßen im Rollstuhl, aber die meisten liefen mit Gehstöcken oder Krücken, die Löcher im Sand hinterließen. Es war ein ungewöhnlicher Ort für gehbehinderte Menschen. Das Meer ergab ja Sinn, aber das Gebäude befand sich auf einer Klippe, und man musste Hunderte von Stufen steigen, um hinauf- oder hinunterzukommen, was bei zwei eingegipsten Beinen einige Zeit in Anspruch nahm.
Die Klinik besaß auch einen ins Meer gebauten Pool. Den halben Tag über war er unter Wasser, bei Ebbe tauchte er aber wieder auf und erfreute sich großer Beliebtheit. Man sollte meinen, eine Rehaklinik würde ihren Pool mit einer Leiter oder einer Rampe versehen, aber nichts da. Die Patienten sprangen hinein, um sich anschließend am dunklen Rand festzuklammern und mühsam hinauszuklettern.
Ich ging um drei ins Bett, und kurz darauf wachte Hugh auf, und wir redeten eine Weile. Er hatte geträumt, er wäre an einem Haus vorbeigelaufen und hätte auf der Veranda einen Mann gesehen, der ein Buch mit dem Titel Dress Your Family in Corduroy and Denim las.
Ich stand auf und schrieb den Titel in mein Notizbuch. Wenn es noch nicht zu spät ist, könnte der Traum sich als prophetisch erweisen. Dress Your Family in Corduroy and Denim. Ich glaube, das wäre ein großartiger Titel für mein neues Buch. (Anm.: Die deutsche Ausgabe erschien 2004 unter dem Titel Nachtprogramm.)
10. Oktober 2003
Savannah, Georgia
Als Lisa und ich heute aufwachten, herrschte dichter Nebel, sodass wir etwas langsamer fahren mussten. Die Fahrt von Boone nach Greensboro dauerte zwei Stunden, in denen wir Dr. Laura im Radio zuhörten. Die erste Anruferin hatte einen Mann im Internet kennengelernt und war sich unschlüssig, ob sie sich mit ihm verabreden sollte. »Sind Sie verrückt?«, fragte Dr. Laura. Sie behauptete, der Mann sei ein Pädophiler und die Frau dürfe erst dann wieder an eine Verabredung denken, wenn ihre Kinder erwachsen und aus dem Haus seien. »Sie sollen nicht sehen, wie ihre Mutter fremden Männern hinterherjagt«, sagte sie. »Sie sind die Mutter, nicht die große Schwester.«
»Was für ein Miststück«, meinte Lisa, und ich stimmte ihr zu.
17. Oktober 2003
Memphis, Tennessee
Ich fragte den Portier im Peabody Hotel, wo ich mir die Haare schneiden lassen könne, und er schickte mich zu einem von Schwarzen geführten Salon. Seltsamerweise herrscht in keinem anderen Dienstleistungsbereich noch heute so stark die Rassentrennung wie im Friseurgewerbe. Nie begegnet man Weißen in einem Friseurgeschäft für Schwarze und umgekehrt, offenbar weil man glaubt, dass sich jemand nur auf eine Art von Haaren spezialisieren kann. Natürlich ist das lächerlich, aber so ist es nun einmal.
Der Salon befand sich in einer heruntergekommenen Straße fünf Blocks von meinem Hotel entfernt, und als ich eintrat, fragte mich ein Schwarzer irritiert, was ich wolle. Ich erklärte es ihm, woraufhin der Friseur seinen Kunden ansah und sagte, wenn ich einen Haarschnitt wolle, solle ich am besten nach oben gehen.
Oben befand sich der Frauensalon. Eine Stylistin war gerade damit beschäftigt, einer Kundin Extensions einzuflechten, während ein junger Mann auf dem Stuhl danebensaß, zusah und über Kekse redete. Wie schon ihr Kollege fragte mich die Frau, was ich wolle, und schien überrascht, als ich um einen Haarschnitt bat. »Ich habe ziemlich zu tun«, sagte sie. »Sie können morgen wiederkommen, oder … nein, also … können Sie mir noch ein paar Minuten geben?«
Es sah so aus, als würde sie die Extensions direkt in die Kopfhaut ihrer Kundin einnähen. Die Nadel fuhr hinein und hinaus, und während ich wartete, blätterte ich in einem Exemplar von Black Hairstyles. Es war eine Ausgabe mit lauter Berühmtheiten. Auf dem Cover war Lil’ Kim abgebildet, die einen blauen Bob mit aufgesprühtem Chanel-Logo trug. Ich überlegte, mir die gleiche Frisur machen zu lassen, aber eigentlich wollte ich am liebsten wieder gehen. Nicht, weil ich befürchtete, die Frau würde mir die Frisur versauen – bei mir kann man nicht viel falsch machen –, sondern weil die Situation möglicherweise zu unangenehm war. Es war klar, dass ich nicht hierhergehörte, aber die Stylistin, die sich als Shelly vorstellte, gab sich alle Mühe, damit ich mich bei ihr wohlfühlte. Nachdem sie ihre Näharbeit auf dem Kopf der Frau beendet hatte, führte sie mich zu einem Stuhl und erkundigte sich, welche Haarlänge ich bevorzugte. Ich hatte keine Ahnung, woraufhin sie einen Aufsatz auf die Haarschneidemaschine steckte und loslegte. »Ich habe immer Probleme mit den Übergängen«, sagte sie. »Manchmal mach ich es unten zu kurz, und dann bleibt oben zu viel stehen.«
Während sie mir die Haare kürzte, nahm sie ihre Unterhaltung mit ihrer vorherigen Kundin und dem jungen Mann auf dem Stuhl wieder auf. Sie redeten über den Komiker Bernie Mac und kamen dann auf das Thema alte Menschen. »Meine Großmutter ist verrückt«, sagte die Frau mit den neuen Strähnen. »Wie alle alten Damen streut sie sich immer Puder in ihren Schlüpfer, bevor sie aus dem Haus geht.«
Die Friseurin nickte, und ich wollte fragen: Sie macht was? Dann erzählte die Frau, wie sie einmal auf einer Beerdigung war und auf der Toilette ihr Kleid versehentlich in die Strumpfhose gestopft hatte. »Mein ganzer Arsch war zu sehen«, sagte sie, und der junge Mann und die Friseurin lachten schallend.
Obwohl ich aufgefordert wurde, mich an der Unterhaltung zu beteiligen, machten meine Beiträge wenig Eindruck. Die beiden Frauen gaben sich amüsiert, der junge Mann dagegen tat so, als würde ich ihm etwas wegnehmen. Immer wieder sah er mich finster an, bis ich meinen Blick abwandte. Auf meinen Lesereisen in den Vereinigten Staaten erlebe ich ständig die angespannte Atmosphäre zwischen Schwarzen und Weißen, ein beinahe unablässiges Gefühl von Wettbewerb. Sie sind lustiger als wir, denke ich. Komm schon, lass dir einen lockeren Spruch einfallen.
Nach meinem Haarschnitt ging ich ins Hotel zurück und bemerkte, dass auf dem mechanischen Klavier ein Glas für Trinkgeld stand.
19. Oktober 2003
Chicago, Illinois
Lisa hat mir eine Ausgabe des Atlantic mit einem Artikel über Apotemnophilie geschickt, dem Wunsch nach der Amputation eigener Körperteile. Transsexuelle sagen oft, sie fühlten sich gefangen im falschen Körper, was in gewisser Weise auch bei diesen Menschen der Fall ist. Der Körper stimmt zwar, aber es ist zu viel davon da. Eine Frau sagte, wenn sie sich im Spiegel betrachte, sehe sie sich so, wie sie eigentlich sein sollte – armlos. Im ersten Moment dachte ich, es sei ein Druckfehler und müsste harmlos heißen, aber im weiteren Verlauf des Absatzes wurde sie konkreter und brachte ihren lebenslangen Wunsch zum Ausdruck, zwei kurze Armstummel zu besitzen. Eine andere Frau hatte einen ähnlichen Wunsch, nur auf tiefere Körperregionen bezogen. »Ich verstehe auch nicht, warum«, sagte sie, »aber ich wusste immer schon, dass ich meine Beine nicht will.«
Die Verfasserin des Artikels hatte die meisten Personen in einem Chatroom kennengelernt. Kein seriöser Arzt würde jemals einen gesunden Körperteil amputieren, sodass Menschen mit Apotemnophilie sich im Netz über Krankenhäuser in Südamerika und Osteuropa austauschen und denjenigen Tipps geben, die so verzweifelt sind, dass sie die Sache selbst in die Hand nehmen (solange sie noch zwei davon haben). Ein Mann setzte sich eine lokale Betäubungsspritze und steckte sein ungewolltes Bein in einen Häcksler. Die Fahrt ins Krankenhaus und alles andere waren genauestens geplant. Ein anderer beharkte sein Bein mit einer Kettensäge und war am Boden zerstört, als er aus der Narkose erwachte und man ihm sagte: »Gute Nachrichten, Mr. Yardley. Wir sind zuversichtlich, es wieder annähen zu können.« Zuletzt klappte es doch nicht, sodass es sich um eine der vielen medizinischen Wundergeschichten handelt, nur in umgekehrter Richtung.
Ich glaube von mir, für so ziemlich alles Verständnis aufzubringen, aber hier bin ich überfordert, ganz besonders bei der Frau, die ihre beiden Arme loswerden möchte. Begreift sie nicht, was das bedeutet? (Ich stelle sie mir an einer Straßenecke in New York vor. »Taxi!«) Sie wird sich nie wieder die Schuhe zubinden oder eine Mücke totschlagen, und ich habe keine Ahnung, wie sie anschließend in ihren geliebten Chatroom kommen will. Für mich klingt es einfach nur verrückt, aber diejenigen, die sich von unerwünschten Gliedmaßen getrennt haben, behaupten, es nicht zu bereuen. Der Mann mit dem Häcksler beispielsweise kann sich nichts Besseres vorstellen.
Ich las den Artikel auf dem Flug nach Chicago. Auf der Taxifahrt zum Hotel kamen wir an einem harmlosen Unfall mit einem Pkw und einem Minivan vorbei. Die beiden Fahrer standen gegen ihre Fahrzeuge gelehnt und telefonierten, während sich an der Unfallstelle einige Schaulustige versammelten. Ich sah einen etwa zwölfjährigen Jungen, einen Mann mit einem schwarzen Turban und dann, auf dem Bürgersteig, eine Frau ohne Beine in einem elektrischen Rollstuhl. Normalerweise hätte ich sie bemitleidet – wobei mein Mitleid weder erwünscht war noch in irgendeiner Weise half –, aber dennoch, ich hätte mir gewünscht, sie hätte ihre Beine noch. Jetzt aber sah ich sie nur an und dachte: Du hast dir die Suppe eingebrockt, jetzt musst du sie auch auslöffeln.
7. November 2003
Paris
Einem Artikel aus USA Today zufolge ködern amerikanische Jäger Bären inzwischen mit Süßigkeiten. Fabriken verkaufen ihre Ausschussware in großen Blöcken, z. B. fünfzig Pfund schwere Klumpen Snickers oder Baby Ruth Schokolade. Der Zucker ruiniert das Gebiss der Bären, und es gab ein Foto von einer Bärin, die ihre abgefaulten Schneidezähne in die Kamera hielt. Was macht ein Tier, wenn es Zahnschmerzen hat? Schlägt es seinen Kopf gegen einen Felsen, in der Hoffnung, den kranken Zahn auszuschlagen, oder leidet es einfach still vor sich hin?
Im Flugzeug brachten sie mir eine Bloody Mary statt des gewünschten Bloody Mary Mix. Vor genau zwei Jahren ist mir das schon mal passiert. Ich nahm versehentlich einen Schluck und ließ das Glas zurückgehen, bedauernd, dass ich keinen größeren Schluck genommen hatte. Es ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass ich Alkohol hatte. Im Frühjahr habe ich bei Amy ein Glas Weißwein mit Wasser verwechselt. Und auf Manuelas Hochzeit hat ihre Mutter einen Finger in ihr Champagnerglas getaucht und mir anschließend in den Mund gesteckt. Ich wünschte, ich würde einmal einen Joint mit einer Zigarette verwechseln.
3. Dezember 2003
Paris
Letztes Jahr schenkte ich Paul zu Weihnachten einen Plastikaffen, den ich auf einem Flohmarkt in Budapest gekauft hatte. Er war etwa so groß wie eine Zitrone. Wenn man ihn aufzog, aß er nicht die Banane in der einen Hand, sondern benutzte die andere, um zu onanieren. Überraschung! Vor einem Monat entdeckte Lisa ihn bei einem Besuch und erklärte, er sei widerlich, woraufhin Paul ihn in ihrem Behälter für entkoffeinierten Kaffee versteckte. Er ging davon aus, sie würde ihn am nächsten Tag finden, aber am nächsten Morgen trank Lisa normalen Espresso. Dann holte sie Bob in Winston-Salem ab und fuhr mit ihm in die Berge zu ihren Schwiegereltern, die bald in eine Wohnanlage für Senioren zogen. Mr. Evans hat Alzheimer, kann aber immer noch kleinere Aufgaben verrichten – zum Beispiel Kaffee kochen. Er fuhr mit dem Löffel in Lisas Kaffeebeutel, und man fragt sich nur, welche Schlüsse der pensionierte Baptistenpfarrer zog, als er im Kaffeepulver seiner Schwiegertochter auf einen onanierenden Affen stieß.
7. Dezember 2003
Paris
Gestern war es kalt und wolkenverhangen, und ich blieb bis drei im Haus. In unserem Viertel drängelten sich die Weihnachtseinkäufer, und ich lief eine Weile durch die kleinen Straßen zwischen der Rue du Four und der Markthalle. In einem Laden in der Rue Princesse kaufte ich eine kleine Vase und lief dann weiter zur Métro-Station Sèvres-Babylone, vorbei an lauter exklusiven Geschäften. Dieses Viertel hat beinahe etwas Peinliches. Es gibt ein Geschäft, das Topflappen aus Kaschmirwolle verkauft, und ein anderes, das auf handbestickte Schwämme spezialisiert ist. Ich ging bis zur Rue de Rennes, wo Zehntausende Arbeitslose für die Auszahlung ihres jährlichen Weihnachtsgelds auf der Straße waren.
Die Demonstration wurde von der Kommunistischen Partei Frankreichs unterstützt, und hin und wieder sah man eines ihrer roten Transparente, die zur Solidarität aufriefen. In Amerika stellt man sich unter einem Kommunisten entweder einen Studenten oder einen Spinner vor, hier dagegen sahen sie so aus wie jeder andere: der Mann mittleren Alters im schicken Mantel, die blonde Großmutter mit einer Stepptasche. Sie protestierten nicht gegen die albernen Läden in der Nachbarschaft, sondern forderten bloß einen Platz vor der Kasse.
22. Dezember 2003
Paris
Gestern Abend sah ich im Fernsehen einen Ausschnitt aus einer Sendung über eine Gruppe Engländer, die durch London liefen und Schamhaare von Frauen sammelten. Einzelne Exemplare wurden auf Toilettensitzen aufgelesen, aber die meisten Teilnehmer gingen gezielter vor und fragten unumwunden nach dem Gewünschten. »Entschuldigung«, sagten sie und zogen eine Schere aus der Gesäßtasche, »ich nehme an einer Art Wettbewerb teil und wollte fragen, ob Sie …«
Natürlich sprachen sie nicht irgendwen an. Vielmehr sahen sie sich nach dem Typ Frauen um, die bei ihrem Vorschlag dachten: Was soll’s, ich hab eh nichts damit vor.
Zu einer festgesetzten Zeit trafen sich die Männer wieder und verglichen ihre Funde. Es war wenig überraschend, dass der attraktivste Typ das meiste Schamhaar gesammelt hatte, auch wenn ich es ein wenig unfair fand. Du verdankst alles nur deinem Aussehen, dachte ich.
Er hatte praktisch ein ganzes Kopfkissen voll zusammen, während der eindeutige Verlierer gerade mal ein kleines Büschel vorweisen konnte. Zur Strafe musste er eine Pizza mit seiner Ausbeute als Belag essen. Die anderen trösteten ihn damit, dass auch Käse drauf war, aber man kann sich denken, welcher Belag in Erinnerung bleiben wird.
2004
15. Januar 2004
San Francisco, Kalifornien
Pauls neue Masche, Leute zu verunsichern, ist, am Telefon so zu tun, als hätte er gerade furchtbaren Zoff mit seiner Frau. Als ich gestern Abend anrief, nahm er ab und brüllte: »Dir werd ich’s zeigen, Kathy!«
3. Februar, 2004
Paris
Gestern Abend beim Essen wollte ich Manuela von einer Autopsie erzählen, bei der ich einmal dabei gewesen war. Sie spricht kein Englisch, aber ich machte meine Sache ganz gut, bis zum Schlusssatz.
»Alles in allem war es einfach … einfach …«
Und da ging mir auf, dass ich das französische Wort für »unvergesslich« vergessen hatte.
11. Februar 2004
London
Beim Hemdenbügeln hörte ich eine Talksendung im Radio und stellte fest, wie sehr sie sich von einer solchen in Amerika unterschied. Anders als der arrogante Rush Limbaugh und der noch selbstgefälligere Bob Grant war der Moderator ziemlich zahm. Die Geschichten seiner Zuhörer überraschten ihn, aber er ergriff nie die Gelegenheit, um über sie zu urteilen oder sie lächerlich zu machen. Tatsächlich machte ihn das ein wenig langweilig. Eine Talkshow braucht eine Zentralfigur, und wenn der Moderator sich davor drückt, müssen die Anrufer die Sache übernehmen, die dafür allerdings nicht lange genug auf Sendung sind. Gestern ging es um eine Studentin, die ihre Jungfräulichkeit im Internet versteigert hatte. Der Höchstbietende war ein Vierundvierzigjähriger, der ihr achttausendvierhundert Pfund zahlte. In Amerika hätte man damit mehrere Wochen lang Gesprächsstoff gehabt, aber hier schien das keinen zu kümmern. »Nun, ich denke, es ist ihr gutes Recht«, meinten die Anrufer. »Und die Semestergebühren sind ja schließlich gestiegen, nicht wahr?«
Selbst eine alte Frau zeigte keine Spur von Entrüstung. »Ich bin gerade dabei, mein Badezimmer zu renovieren«, erklärte sie dem Moderator, »und finde auf Teufel komm raus kein passendes Waschbecken.« Nachdem der Mann sie zurück zum Thema gebracht hatte, sagte sie nur: »Achttausendvierhundert Pfund, das ist eine schöne Stange Geld.«
22. Februar 2004
London
Anfang der Woche rief Tiffany an. Hugh und ich saßen gerade beim Abendessen, deshalb ließ ich den Anrufbeantworter laufen und beschloss, sie am nächsten Abend zurückzurufen. Am nächsten Abend hatte ich allerdings ein Interview, sodass ich es noch einmal einen Tag vor mir herschob und danach noch einen. Gestern Nachmittag, als ich mir gerade die Schuhe zuband, rief Paul an und warnte mich, Tiffany wolle Geld. »Sie mag Dad nicht darum bitten, deshalb versucht sie es bei dir.«
Ich habe ihr erst kürzlich fünfhundert Dollar geschickt, aber die reichen bei Weitem nicht aus, sie aus ihrem gegenwärtigen Schlamassel herauszuholen. Vor einigen Wochen hatte sie eine Fußoperation. Der Scheck, den sie von Dad zu Weihnachten bekommen hat, ist längst aufgebraucht, und jetzt ist sie arbeitslos und drei Monate mit der Miete im Rückstand. Natürlich könnte ich ihr mehr schicken, aber kein Geld der Welt kann ihr vermurkstes Leben wieder in die Spur bringen. »Sie muss zurück in den Mutterleib«, meinte Paul, was die Sache ziemlich genau trifft.
Aus Tiffany wird keiner schlau. Sie muss Medikamente für ihren Fuß nehmen und hat jüngst eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben, jemand sei bei ihr eingebrochen, während sie geschlafen habe, und habe zwanzig Schmerztabletten gestohlen. Es ist bezeichnend, dass der Dieb, wer auch immer es war, nicht alle Schmerztabletten geklaut hat und dass er oder sie sich noch die Zeit nahm, den Abwasch zu erledigen. Ich vermute, sie hat die Tabletten irgendwem verkauft und musste die Anzeige machen, um ein neues Rezept zu bekommen, aber bei Tiffany weiß man nie. Sie hat mir selbst gesagt, sobald sie Geld habe, gebe sie es mit vollen Händen aus: »Das machen wir Armen so.«
In ihren Erzählungen gibt sie das Geld Leuten, die noch schlimmer dran sind als sie. Angeblich zahlt sie ihrer Vermieterin mehr als vereinbart. Oder sie steckt Obdachlosen einen Zwanziger zu. Aber auch das mag ich ihr nicht so recht glauben. Sich selbstständig zu machen, kommt für sie nicht infrage, weil sie, wie sie sagt, physisch nicht in der Lage sei, ihre Backkünste umzusetzen. »Verstehst du denn nicht? Ich kann meine Hände nicht benutzen. Ich kann es einfach nicht.« Dabei funktionieren sie bestens, wenn es darum geht, zerbrochenes Geschirr auf Rigipsplatten zu zementieren, anscheinend sind sie jedoch unfähig, einen Mixer anzuschalten.
Vor ihrer Fußoperation hatte sich Tiffany eine Hand verletzt, und davor brauchte sie Geld für eine Zahnwurzelbehandlung. Sie hat ein schlechtes Jahr hinter sich, scheint aber zu glauben, so etwas wird ihr nie wieder passieren. Das Gebiss muss nur einmal in Ordnung gebracht werden. Dein linker Fuß lässt dich im Stich, und danach kannst du ihn von der Liste streichen. Je älter sie wird, desto mehr werden die Krankheitsfälle zunehmen, aber sie würde nie einen Cent für Notfälle zurücklegen. Tiffany ist stolz auf ihre Armut und redet davon, als wäre es eine Leistung. Sie glaubt, das Beste, was man für die Armen tun kann, ist, selbst arm zu werden. Auf diese Weise kann man mit den Armen reden und »wirklich zu ihnen Kontakt aufbauen«.
»Ich an deiner Stelle würde ihr sagen, sie soll sich an deinen Vater wenden«, sagt Hugh, ohne einzusehen, dass, ganz egal, wen Tiffany anruft, sie zuletzt immer mein Problem bleibt. Wenn Dad stirbt, wird sie ihr Erbe im Nu zum Fenster rausschmeißen und genau wieder dort landen, wo sie jetzt ist. Nichts wird sich ändern.
»Ich predige ihr immer, sie muss sich ein Ziel setzen«, sagt Dad. »Dass sie Synchronsprecherin werden soll.« Er redet, als ob seine Ratschläge zu irgendetwas führten, als ob sie sie annehmen und ihm eines Tages dafür danken würde. Man muss kein Genie sein, um von seinen Schulden runterzukommen. Wer Geld haben will, muss arbeiten, aber sie scheint unfähig, einer festen Arbeit nachzugehen.
23. Februar 2004
London
Nachdem ich gestern in mehreren Buchläden gestöbert hatte, ging ich auf ein Stück Kuchen ins British Museum. Neben mir saß eine englische Familie mit drei Kindern, das jüngste von ihnen im Rollstuhl. Der Junge sah ganz zufrieden aus, aber sicherlich war das nur vorübergehend. Eine nette halbe Stunde im Café, und dann ging es zurück zu einem Leben, in dem man ständig bevormundet und angestarrt wird. Ich bewunderte seine Tapferkeit, als seine Mutter ihn vom Tisch wegschob und ich sah, dass er ein Bein in Gips hatte. Dann bemerkte ich, dass der Rollstuhl nur gemietet war und er vermutlich gar nicht körperbehindert, sondern nur für ein paar Wochen gehandicapt war. So etwas ist mir schon öfter passiert, und immer habe ich das Gefühl, betrogen worden zu sein – als hätte das Kind mit Absicht mein Mitleid geweckt.
24. Februar 2004
London
Gestern Abend rief ich Tiffany an und ließ sie geschlagene zwei Stunden auf mich einreden. Ihr Monolog begann mit einer Frage, die dann auch die einzige blieb: »Weißt du, wer Homunkulus war?«
Pauls Berichten nach ist sie völlig durchgeknallt, aber wenn sie einem eine Geschichte erzählt, klingt sie zunächst ganz vernünftig. Dann wiederholt sie die Geschichte ein zweites und drittes Mal, und alles gerät aus den Fugen. Während eines kürzlichen Krankenhausaufenthalts fragte ein Arzt sie, ob sie sich in der Psychiatrieabteilung besser aufgehoben fühlte. »Da habe ich ihm gesagt: ›Hier geht es nicht darum, ob ich verrückt bin, hier geht es darum, dass Sie sich um meine Gesundheit kümmern. Der erste Satz des hippokratischen Eids lautet Füge niemandem Schaden zu, und Sie haben mir Schaden zugefügt, Mann. Genau darum geht’s, und wissen Sie was? Wenn ich mitbekommen hätte, dass Sie jemand anderen so behandeln wie mich, hätte ich Ihnen die Hölle heißgemacht, darauf können Sie wetten.‹ Und ich habe noch gesagt: ›Am besten, Sie geben mir einen Erlaubnisschein, dass ich vor die Tür gehen und rauchen darf, denn hier ohne Zigarette im Zimmer zu hocken, ist verdammt noch mal keine Option. Absolut nicht.‹«
Bevor sie ins Krankenhaus ging, hatte Tiffany sich als Vorleserin für Blinde beworben. Es war eine ehrenamtliche Arbeit, und auch wenn sie den Job nur einen einzigen Tag gemacht hat, ist sie ganz beseelt davon: »Wenn jeder sich um seine Mitmenschen kümmern würde, hätten wir nicht diese ganzen beschissenen Probleme. Die Frau ein paar Häuser weiter schlägt ihre Tochter, aber ich ruf deswegen nicht die Bullen. Stattdessen geh ich zu ihr und sage: ›He, lass mich für ein paar Stunden auf dein Mädchen aufpassen.‹ Und weißt du was, David, wenn jeder das täte, müssten die Leute nicht so aufwachsen wie wir früher.«
Paul hatte mich gewarnt, dass Tiffany um Geld bitten würde, aber das tat sie nicht. »Dad hat mir tausend Dollar geschickt, und weißt du, was ich damit gemacht habe? Ich hab sie diesem Typen gegeben, der Krebs hat, weil sich das so gehört.«
25. März 2004
London
Nicht weit von uns entfernt, an einer Ecke in der Nähe des Parks, steht eine Villa, die von einer hohen Mauer umgeben ist. Der Besitzer hat kürzlich seinen Garten mit Mist düngen lassen, und man kann es schon von Weitem riechen. Gestern kamen Hugh und ich auf dem Nachhauseweg vom Restaurant daran vorbei. Wir nennen es nur noch: »Das Haus am Kackeck.«
28. März 2004
London
Etwa alle halbe Stunde verkehrt ein Doppeldeckerbus zwischen London und Oxford, der sogar eine Toilette an Bord hat. Die Fahrt dauert je nach Verkehrslage ungefähr eine Stunde. Gestern war auf den Straßen wenig los. Hugh und ich zahlten beim Fahrer und setzten uns oben im Gang einer Chinesin gegenüber, die von dem Moment, da sie in den Bus stieg, bis zu ihrem Ausstieg in einem kleinen Dorf zwanzig Minuten vor Oxford, laut telefonierte. Sie war eine unattraktive Person mit einer Knollennase und einem Pferdegebiss. Ihre Füße waren zierlich und steckten in weißen Sneakers mit runder Kappe.
Nach einer halben Stunde drohte Hugh, ihr das Handy wegzunehmen und es aus dem Fenster zu werfen. Natürlich sagte er das nicht zu ihr, sondern nur zu mir. Dennoch befürchtete ich, er könnte es tun, und wurde nervös. Das Lachen der Frau deutete darauf hin, dass sie mit einem Freund oder einer Freundin sprach, was aber, wenn ich falschlag? Sie konnte auch mit einem Elternteil reden, der an Maschinen angeschlossen in einem chinesischen Krankenhaus im Sterben lag. Höchstwahrscheinlich aber war es ein Freund oder eine Freundin, und die Frau wusste nicht oder scherte sich nicht darum, dass es unhöflich war, in einem geschlossenen Raum so lange und so laut mit jemandem zu reden. Als wir ihre Haltestelle erreichten und sie die Treppe hinunterstieg, begann ich zu klatschen, und alle auf dem Oberdeck fielen mit ein. Alle außer Hugh, der mir zuzischte, das sei unhöflich von mir.
In Oxford besuchten wir das Ashmolean Museum, und um fünf Uhr gingen wir zur Queen’s Lane, um die Rückfahrt nach London anzutreten. Während wir auf den Bus warteten, bemerkte ich einen Mann Mitte dreißig, der eine selbst gedrehte Zigarette rauchte. Seine schulterlangen Haare waren zu den für Weiße typischen filzigen Dreadlocks geflochten, und er trug eine Lederjacke über einem gemusterten Pullover. Der Typ sagte, er brauche zwanzig Pence für die Fahrt nach Hause, und nachdem Hugh und die vier Leute vor ihm ihn abgewiesen hatten, wandte er sich an mich. Ich sah unbekümmert zum Himmel und sagte nur: »Tut mir leid.«
»Klingt nicht so, als ob’s Ihnen leidtäte«, sagte der Typ. »Was tut Ihnen leid? Dass Sie hässlich sind?«
Den anderen gegenüber war er nicht feindselig gewesen, aber irgendwas an mir schien ihn zu stören, und umgekehrt.
»Lassen Sie mich in Ruhe«, sagte ich.
»Na ja, Sie haben angefangen.« Wir starrten einander an, und für einen Moment wünschte ich mir fast, er würde mich schubsen oder mir einen Schlag verpassen. Wahrscheinlich hätte ich den Kampf verloren, aber ich verspürte den Wunsch, es zumindest zu versuchen, was ganz und gar nicht meine Art ist. Wieso hatte ich angefangen? Hatte ich etwa einen wildfremden Menschen angesprochen? Hatte ich um Geld gebeten?
Hugh würde gerne in der Zeit zurückreisen und 1910 in Oxford studieren. Ich würde gerne in der Zeit zurückreisen und auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf den Bus warten. Und wenn er käme, würde ich in letzter Sekunde einsteigen und so dem Typen mit den Dreadlocks aus dem Weg gehen. Ein idiotischer Gedanke für eine Zeitreise, aber der Zwischenfall hatte einen furchtbaren Nachgeschmack in meinem Mund hinterlassen, und ich musste pausenlos daran denken. »Haben Sie vielleicht zwanzig Pence?« Natürlich hatte ich die. So wie alle anderen auch. Aber wir hatten sie nicht für ihn.
Auf der Rückfahrt dachte ich darüber nach, wie hässlich ich bin, und wünschte, es wäre anders. Nachdem wir in London eintrafen, kaufte ich mir eine Zeitung und suchte darin nach Leuten, die noch unattraktiver waren als ich, und fragte mich, ob sie dem Bettler zwanzig Pence gegeben hätten. Zuletzt dachte ich daran, wie ich geklatscht hatte, als die Chinesin aus dem Bus stieg, und entschied, dass der Zwischenfall mit dem Typen mit den Dreadlocks meine gerechte Strafe gewesen war. Natürlich laufen die Dinge nicht wirklich so. Oder doch?
7. April 2004
London
Gestern Nachmittag hatte ich ein Treffen mit einem Vertreter von Age Concern, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich um ältere Menschen im Stadtteil Westminster kümmert. Ich war ein paar Minuten zu früh dran und nannte der Sekretärin meinen Namen, den sie als Sid Harris interpretierte.
»Schön, Sid«, sagte sie. »Nehmen Sie doch bitte einen Moment Platz. Ich rufe Sie, wenn Mr. Walsh sein Telefongespräch beendet hat.«
Ich wollte sie korrigieren und sagen, es sei ein Wort, Sedaris, aber vermutlich wäre ihr das peinlich, also setzte ich mich, ein frischgebackener Sidney, abgekürzt zu Sid. Nach einigen Minuten nahm die Sekretärin den Hörer ab und wählte eine Nummer. »Immer noch besetzt«, sagte sie. Eine Minute später versuchte sie es noch einmal. »Mr. Walsh, hier sitzt ein Sid Harris und möchte Sie sprechen.«
Er sagte etwas am anderen Ende der Leitung, und sie lächelte mich an und sagte: »Er ist unterwegs, mein Lieber.«
Mr. Walsh stellte sich als Ire heraus, schätzungsweise Anfang vierzig, eher klein und mit dichtem kupferfarbenem Haar. Er führte mich die Treppe hinauf in einen kahlen Raum, wo wir uns an einen Konferenztisch setzten und er meine Bewerbung für eine ehrenamtliche Tätigkeit überflog.
Die erste halbe Stunde des Gesprächs verlief glatt. Ich erzählte ihm, dass ich gerne ältere Menschen besuchen wolle, die ans Haus gefesselt seien, und kleinere Aufgaben für sie erledigen wolle. Vorzugsweise würde ich Putzarbeiten übernehmen, aber wenn Einkäufe zu machen seien oder jemand durch den Park geschoben werden wolle, sei auch das kein Problem. Ich sagte, ich hätte von heute an bis zum 13. Mai von Montag bis Freitag Zeit, bevor ich zu einer Reise nach Australien und in die Vereinigten Staaten aufbräche.
»Wir bezeichnen diese Art des ehrenamtlichen Engagements als ›häuslichen Betreuungsdienst‹«, sagte Harry, »aber angesichts des beschränkten Zeitraums kommen Sie dafür leider nicht infrage. Wir suchen Menschen, die einen engen Kontakt zu den Senioren aufbauen, oft über Jahre, und das funktioniert nicht, wenn Sie schon in gut einem Monat das Land verlassen.«
»Nun, das muss ja kein Problem sein«, sagte ich. »Haben Sie nicht jemanden, der am oder um den 13. Mai herum stirbt?«
Harry rutschte auf seinem Stuhl nach vorn und faltete die Hände. »Unser Geschäft ist nicht der Tod«, erklärte er. »In dieser Organisation geht es nicht ums Sterben, sondern darum, die Zeit zu feiern, die diesen Menschen noch gegeben ist.«
»Na schön«, sagte ich. »Ich bin sicher, einige Ihrer Betreuer machen auch mal Ferien. Kann ich nicht einige Tage oder auch Wochen für sie einspringen?«
Er erzählte etwas von einem Qualifizierungsprogramm, und ich sagte, ich wisse, wie man Toiletten reinige und Fenster putze.
»Davon bin ich überzeugt«, erwiderte er. »Ich spreche hier von Sensibilitätstraining. Von der Fähigkeit, auf die emotionalen Bedürfnisse unserer Klienten einzugehen.« In meinen Augen ist das alles Bullshit. Diese Menschen haben den Zweiten Weltkrieg überlebt. Brauchen sie tatsächlich jemanden, der sie fragt, wie sie sich fühlen, wenn sie es nicht mehr bis zur Toilette geschafft haben? »Macht Sie das traurig? Wollen Sie darüber reden?«
Nein. Sie wollen nur, dass der Haufen vom Boden verschwindet, und wenn ich das kostenlos für sie übernehme, wo ist dann da das Problem?
5. Mai 2004
London
Gestern war ein kalter und regnerischer Tag. Nachmittags gab es ein schweres Gewitter, ausgerechnet als ich Miss Babingtons Wohnung im zweiten Stock verließ. Sie wohnt in Maida Vale, und Age Concern hatte mich zu ihr geschickt, um ihr beim Auspacken ihrer Habseligkeiten zu helfen. »Oh, auf gar keinen Fall«, sagte sie, als ich nach meinem Schirm griff. »Bei dem Wetter lasse ich Sie nicht aus dem Haus.« Und so blieb ich. In ihrer Küche steht ein halbes Dutzend roter Plastiktragetaschen, wie Hugh und ich sie als Wäschekorb verwenden. Sie sind randvoll mit Dingen aus ihrer vorherigen Wohnung, und ich brachte sie ins Wohnzimmer, damit sie sie durchsehen und alles wegwerfen konnte, was sie nicht mehr brauchte. In der ersten Tasche befand sich ein klobiger Kassettenrekorder. »Was für ein Zufall«, sagte sie, »genau den habe ich gesucht.«
Sie stellte ihn auf einen wackeligen Tisch neben der Couch, bevor sie ihn zurück in die Tasche legte, mit dem Hinweis, sie werde sich später darum kümmern. Die zweite Tasche war voller noch eingepackter Weihnachtsgeschenke. »Die Leute schicken mir die«, seufzte sie. »Ich weiß nicht, warum. Sie tun’s einfach.« Zuletzt wanderten alle Taschen zurück in die Küche. »Ich sehe sie später durch, im Moment ist das zu anstrengend. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?«
6. Mai 2004
London
Heute erschien die englische Ausgabe von Nachtprogramm, wofür ich eine Woche lang die Werbetrommel rühre. Zum Auftakt gab ich sechs Regionalsendern der BBC Interviews, die alle telefonisch vom Hauptsitz des Senders in London geführt wurden. Keiner der Interviewer hatte das Buch gelesen, und um das Gespräch am Laufen zu halten, fragte ich sie nach ihrer Stadt und hörte zu, wie sie mir die diversen Attraktionen von Leeds oder Brighton aufzählten. Die einzige Ausnahme war der Moderator von Radio Jersey, der die Insel als »einen Haufen Geld im Meer, an den sich Alkoholiker klammern« beschrieb.
10. Mai 2004
Dublin, Irland
In der Abteilung für ausgefallene Geschenke des Kaufhauses Brown Thomas entdeckte ich eine kleine Packung Teeblätter, auf deren Etikett stand: ERLESENEROOLONG-TEE, GEPFLÜCKTVONSPEZIELLTRAINIERTENAFFEN.
Ich dachte über den Preis nach – zwanzig Dollar pro Gramm – und stellte mir dann eine Gruppe arbeitsloser Landarbeiter vor: »Verdammte Affen, kommen hierher und nehmen uns die Jobs weg.«
16. Mai 2004
Bangkok, Thailand
In Bangkok ist es nicht ungewöhnlich, ein halbes Dutzend gekochter Entenköpfe aufgetürmt am Bordstein zu sehen. Oder man stößt auf Plastiktüten, die als Einwegbecher benutzt wurden und in denen Kokosmilch bei siebenunddreißig Grad Hitze vergärt. Überall auf den Gehwegen liegen Zeitungen und Blechbüchsen, und dennoch bekam ich ein Bußgeld, weil ich eine Zigarettenkippe weggeworfen hatte.