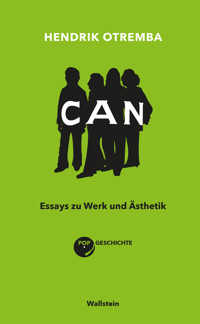
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Popgeschichte
- Sprache: Deutsch
Hendrik Otremba, Schriftsteller und Musiker in Personalunion, nähert sich einfühlsam dem Werk der legendären Kölner Band Can an und spricht mit deren Gründer Irmin Schmidt. Die Kölner Band Can passt - wenn auch lose mit dem Begriff Krautrock assoziiert - in keine Schublade. Zwischen 1968 und 1979 veröffentlichte sie regelmäßig Alben, die mittlerweile als moderne Klassiker zwischen Pop und Avantgarde gelten, komponierte erfolgreiche Filmmusiken und spielte ausufernde Konzerte. In der internationalen Rezeption hat die Band heute einen legendären Status. Nach der Auflösung blieben die Mitglieder eng miteinander verbunden und setzten ihre Karrieren auf Solopfaden fort, wobei sie sich oft gegenseitig musikalisch unterstützten. Auch Autorenfilmer wie Roland Klick und Wim Wenders profitierten von der großen Kompositionsgabe der Gruppe. Hendrik Otremba folgt den Spuren der Band und ihrer Protagonisten und beleuchtet deren Werk und Ästhetik ebenso emphatisch wie klug und kenntnisreich in acht Essays. Otremba hatte das große Glück, drei Mitgliedern von Can - Damo Suzuki (1950-2024), Holger Czukay (1938-2017) - persönlich zu begegnen und konnte den Gründer der Band, Irmin Schmidt (*1937), für diesen Band ausführlich interviewen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hendrik OtrembaCANEssays zu Werk und Ästhetik
PopgeschichteHerausgegeben von Gerhard KaiserRedaktion: Rahel Simon
Hendrik Otremba
CAN
Essays zu Werk und Ästhetik
Wallstein Verlag
Hendrik Otremba, geb. 1984, ist Schriftsteller, Musiker, Künstler und Dozent für Kreatives Schreiben.
Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diesePublikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internetüber http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2025Geiststr. 11, 37073 Göttingen
Umschlaggestaltung: Eva Mutter (evamutter.com)
Illustration: Hendrik Otremba
ISBN (Print) 978-3-8353-5965-9
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8939-7
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8940-3
Inhalt
Delay 2025
»Fetzen aus der Musikgeschichte!«Ein Gespräch mit Irmin Schmidt
1 Ruinen
2 Geistesgegenwart
3 Kintopp
4 Collage
5 Alien Singers
6 Liebezeit
7 Kontinuitäten
8 Rhapsodie
Stille (Gedicht)
Literatur
Zur Reihe »Popgeschichte«
Delay 2025
Ich will hier auf eine Art über Can schreiben, die auch von meiner eigenen Inspiriertheit erzählt, die ich mit der Gruppe verbinde: Das Œuvre der vergleichsweise kurzlebigen Band Can nämlich stellt etwas mit einem an, dem man sich kaum entziehen kann! So zumindest ist es mir ergangen – was mich dazu bewegt hat, hier in acht Essays Perspektiven auf ihr Werk einzunehmen, die diese Impulskraft beleuchten.
Letztlich schreibe ich dabei jedoch über etwas, das weit vor meiner Zeit gelegen ist und dem ich mich annähern muss wie einem entfernten Verwandten, diesem einen berühmt-berüchtigten Exzentriker im Kreis der weitverzweigten Familie, bei dessen Erinnerung allseits die Augen aufleuchten oder verdreht werden und, nach dem gefragt, allerorts getuschelt wird – und über den ich nur wie über einen Mythos schreiben kann: Can gibt es nämlich schon nicht mehr, als ich sie vor etwas über zwanzig Jahren zum ersten Mal höre. Somit forsche ich heute einem Phänomen aus der Vergangenheit nach, von dem ich zwar Bilder besitze, Videoaufnahmen, Musik. Live, in ausufernder Ekstase, habe ich Can aber nie erlebt – wenn auch die in den letzten Jahren in Serie erscheinenden Konzertmitschnitte dokumentieren, wie eindrucksvoll diese Ereignisse gewesen sein müssen.
Es geht in den hier versammelten Texten, die jeweils einem bestimmten Suchbefehl folgen, also auch immer um eine ganz subjektive, zeitversetzte Rezeption. Die Musik von Can bedeutet in meinen musikalischen Liebschaften dabei trotz dieses Abstands die wohl größte Konstante. Und es ist ein großes Glück für mich, dass sich kein geringerer als Can-Mastermind Irmin Schmidt bereit erklärte, für diesen Band mit mir zu sprechen. Wenn ich also auch Can in ihrer Schaffenszeit nie erleben konnte, so hat das Gespräch, das den hier versammelten Essays vorausgeht, für mich doch eine Brücke aus den 1970er-Jahren bis in die Gegenwart geschlagen. Begleitet von Schmidts Erzählungen findet meine Annäherung somit retrospektiv und notgedrungen, man könnte aber auch sagen: bewusst idiosynkratisch statt. Ich schreibe hier auch als Fan, als hungriger Canibale! Jedoch mit Verspätung. Verzögerung. Im Hallraum, im Nachklang. In einer Echokammer. Im Delay 2025 …
Als ich Anfang der 2000er-Jahre auf die Musik von Can stoße, existiert die Kölner Band schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr, gilt als Geheimtipp, wenn überhaupt. Man muss nach ihnen suchen, nach ihnen fragen. Die begeisterte Nacherzählung, die wenig später erfolgt, einhergehend mit variantenreichen musikalischen Zitationen der Zeit ab 1968, steht noch bevor: Krautrockdokus und -bücher gibt es kaum, höchstens als Import, und das Can-Studio ist auch noch nicht als begehbares Ausstellungsstück ins Rock- und Popmuseum in Gronau umgezogen. Die hiesige Musealisierung des Krautrock, ein Begriff, den das gros der Protagonisten jener Zeit wohlgemerkt ablehnt, hat noch nicht stattgefunden genau so wenig wie die heute bald erschöpfte Wieder- und Weiterveröffentlichung des stilistisch offenen Genrekatalogs, der in Deutschland erst seit einigen Jahren von feinsinnigen Labels wie Bureau B, Klangbad oder Grönland kuratiert wird – oder, im Falle des Can-Katalogs hauseigen und kontinuierlich seit der Gründung der Plattenfirma Spoon Records schon im Jahre 1979. Eine tiefergehende kulturhistorische Einordnung dieses besonderen Abschnitts der Musikgeschichte fehlt – und so sind die Innovationen jener Generation, überwiegend geboren um 1940, im Popjahrzehnt 2000 auch noch keine wirksame Inspirationsquelle. Konkret spürbare Auswirkungen von NEU!, Faust, Popol Vuh, Kraftwerk, Ash Ra Tempel, Tangerine Dream, Guru Guru, Amon Düül II, Harmonia et al. scheinen in Deutschland in diesen Jahren überblendet von entfernt verwandten weitstrahlenden Genreinnovationen, wie etwa im House und Minimaltechno. Als Sound Of Cologne haben sie zwar dem Erfindergeist von Irmin Schmidt, Holger Czukay, Jaki Liebezeit und Michael Karoli (und Co.) einiges zu verdanken, reflektieren ihn jedoch kaum oder machen ihn gar zu ihrem Narrativ. Jetzt ist die Zeit des Milleniums – kein Raum für Vergangenheit, keine Zeit für Huldigung, keine Chance auf Auferstehung. Die knallbunte und bisweilen etwas alberne Hyperventilation der 1990er-Jahre wirkt noch deutlich nach und nimmt nahezu die Gesamtoberfläche der jetzt immer mehr auch bebilderten Beschallung ein. VJ statt DJ, neongrell, am flatternden Puls der Gegenwart. Die Musikkultur wirkt in dieser Zeit selbstverliebt, interpretiert Pop als zuckende Möglichkeit eines affirmativen Daseins im Hier und Jetzt – und ist auch genau damit beschäftigt. Pop, das heißt für eine lange Zeit vor allem: der totale Genuss des Augenblicks! Ihr wollt ein Liebeslied? Friede, Freude, Eierkuchen? Just do it! How much is the fish?
Anders gesagt: Can sind kein Thema, als ich anfange, Dinge über die Maße geil zu finden, was in der Musikrezeption notwendig und kaum zu umgehen ist. Unermessliche Begeisterung, darunter macht man es nicht mehr, hat man einmal das Potenzial des eigenen Hörens und Sehens entdeckt. In dieser Lebensphase der intensiven Identitätsausbildung, zwischen Sturm, Drang und Selbstzweifel, immer bis zum Zerreißen gespannt zwischen Euphorie und Depression, mag damals auch Distinktionsbestreben eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen: Ich habe da was entdeckt, das kennt kein Mensch. Ich werde es euch zeigen!
Entdeckungen dieser Art ergeben sich durch konzentriertes Suchen oder die dringliche Empfehlung der Vertrauten – doch sie entstehen nicht im luftleeren Raum. Die meisten richtig guten Sachen lerne ich dabei durch mein Umfeld kennen, nicht durch die recommendations, die im durchdigitalisierten Zeitalter die Geschmäcker prägen, uns bald zu reinen Konsumenten gemacht haben werden. Wir reden hier über eine Zeit vor dem Algorithmus, als wir uns noch nicht freiwillig und direkt mit unserem mobilen Rezeptions- und Abspielapparat der Marktforschung aussetzen, noch nicht völlig selbstlos ein Profil abgeben, das aussagt, was uns wohl gefallen könnte (von dem wir vielleicht noch gar nicht wissen). Der Kapitalismus ist noch nicht derart totalitär, wie wir ihm heute ausgesetzt sind. So müssen wir selbst herausfinden, wo das Gute liegt – und wie es sich eben auch trennt von all dem, das nicht so gut ist. Anfang 2000 tauchen sie somit noch nicht auf dem Radar jenes euphorischen, lustvollen Fachsimpelns auf, das ganze Freundeskreise zusammenkittet. Can haben nichts mit camp zu tun, ihr Pop trägt keine Anführungszeichen, ist noch nicht zitiert.
Im Jahr 1984 geboren, bin ich zu jung, um die Kölner miterlebt zu haben – und Can selbst noch etwas zu frisch verblüht und mit ihren Folgeprojekten so gesehen zu relevant, als dass sie uns in popkulturellen Retroschleifen bereits als Geheimtipp erneut serviert werden können. Ich komme zu spät oder sagen wir: zur ungünstigen Zeit. Can haben sich nach einer kurzzeitigen Reunion mit dem ersten Sänger Malcom Mooney im Jahre 1989 schon bald nach Erscheinen von Rite Time wieder aufgelöst. Über Can zu stolpern, dieser Draht ist 2000 noch nicht gespannt, so stoße ich auf indirektem Weg auf die Band: Ich bin in jener Zeit bereits ein aufmerksamer Radiohead-Fan, sammle alles, was ich über Thom Yorke und seine Mitmusiker finden kann, höre tage- und nächtelang Idioteque von ihrem 2000er-Album Kid A. Das ist meine ganz eigene, leicht angekiffte Boy-Band-Phase. Ihr Poster schafft es bis auf die noch karge Wand meines Jugendzimmers. Fünf Briten, die neue Klänge erkunden, dabei tiefschöpfend über die guten Sachen der Vergangenheit informiert sind und diese in einen Sound morphen, der nach Zukunft klingt. Ich werde hellhörig und will etwas über die Musik erfahren, die sie inspiriert. Ein Freund hat Internet und dort, in diesem noch fremden Universum, stoße ich schließlich in einer meiner schmachtenden Recherchen auf einen rauschigen Videomitschnitt eines Liveauftritts der Band in Japan, der mich innehalten lässt. September 2001, kurz nach 9/11. Thief, im Original von einer Band namens Can, von der ich noch nie gehört habe. Radiohead widmen es zynisch dem amtierenden Präsidenten George W. Bush. Immer wieder höre ich mir das Stück an, sehr zur Unfreude der Eltern meines Freundes: Der Gebührenzähler läuft noch mit in der Welt am Draht in diesen frühen Jahren der globalen Metropole. Also suche ich in der analogen Welt weiter nach dem Ursprung des Stückes und stoße schließlich in einer staubigen Kiste in einem Plattenladen der Bochumer Ruhr-Universität auf die LPDelay 1968. Sie enthält sehr frühe, unmittelbar nach der Gründung der Band gemachte Aufnahmen, die aber erst im Jahr 1981 veröffentlicht werden, also bereits nach ihrer intensiven Schaffenszeit und der Auflösung 1979. Als ich die LP das erste Mal höre, ist es um mich geschehen. Das Original packt mich, verglichen mit dem weinerlichen Radiohead-Cover, noch viel mehr. Kein Wunder, ist hier doch schon alles angelegt, was Can so besonders macht: eine dichte Atmosphäre durch die Tasten und Knöpfe Irmin Schmidts, verbunden mit dem metronomischen Takt der dynamisch und pointiert trommelnden Körpermaschine Jaki Liebezeit, ein selbstbewusst schunkelnder, sehr menschelnder Holger-Czukay-Bass, die eingängigste Michael-Karoli-Gitarre, wie auch in allen folgenden Aufnahmen immer scharfkantig und on the edge – und in dieser frühen Version der Gruppe ein Sänger, der in einfachster Sprache stimmlich derart intensiv und einnehmend Wahnsinn, Verzweiflung und rauschhafte Entrücktheit transportiert, dass ich ihm sozusagen folgen muss! Malcolm Mooney: Why must I be the thief? Ich bin infiziert – und wundere mich, dass ich den Umweg über den Ärmelkanal, so gesehen sogar Japan, habe nehmen müssen, um über eine Band zu stolpern, die doch räumlich und zeitlich gar nicht weit entfernt von meinem Wohnort ihren Ursprung hat – und das vor gar nicht so langer Zeit. Ich werde im Ruhrgebiet groß, Köln liegt da gleich nebenan und durchaus auf meinem Radar. Eine regionale Band aber, die so einzigartig klingt, ist mir da noch nicht begegnet.
Es ist damals nicht leicht, etwas über Can herauszufinden. Das Internet ist noch nicht kuratiert (weil von den herkömmlichen Medien noch unbesetzt), wird ohnehin gerade erst als Informationsquelle vorstellig und begegnet uns noch nicht derart selbstverständlich, zugänglich und einnehmend, wie heute, wo es als das maßgebliche und alles durchdringende Kommunikationsmittel, als dominante Wissensmaschine nicht mehr wegzudenken ist und mit Youtube in weiten Teilen die Rolle eines Archivs eingenommen hat. Meine musikalische Sozialisation ist bis dato recht oldschool verlaufen, wenn auch mit großem Interesse an den zeitgeistigen Orten der Pop-Intelligenzia. Und die liegen vor allem in Köln, dem Ort von Spex, Viva II und Rockpalast. (An-)gefüttert werde ich durch Punk-Distros, hochgradig subjektive Fanzines und schwärmerische Mund-zu-Mund-Propaganda in labyrinthischen, verschrobenen Plattenläden. Can jedoch ist damals keine Band, die in den LP-Fächern durch Re-Issues oder ansprechend kuratierte Retrospektiven auffällt. Die Krautrockrenaissance hat noch nicht begonnen, das strahlende Werk liegt verschüttet, in Pappkartons auf Flohmärkten und Plattenbörsen. Als verkanntes Überbleibsel. Auch der Zeitgeist, dem Can entstammen und den sie als umtriebige Künstler mitgeprägt haben, als dessen illustre Protagonisten sie einst auftraten, ist kaum spürbar in diesen Jahren. Die westliche Welt ist musikalisch bestimmt von elektronischer Musik, Hiphop, britischem Indie und mit Interpol, The Strokes oder den Yeah Yeah Yeahs auch von neuen Rockbands aus New York City, jener Stadt, in der jüngst ein folgenreicher Terroranschlag dazu geführt hat, dass man doch eher mit Sorge in die Zukunft blickt, als freudig die Vergangenheit anzuzapfen. Auch die Phase der Reunions und Comebacks hat noch nicht begonnen, die in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Millennium im Großen wie im Kleinen immer mehr zu beobachten ist.
Als ich also bald an der Plattenspielernadel hänge, gilt es, diese progressive Phase der jüngeren Musikgeschichte erst noch auszugraben, den Schmutz der Zeit abzuklopfen und sich einzulassen, um ihr dann zu neuem Leben zu verhelfen. Und ist es nicht so, dass etwas gerade da, wo es verschüttet liegt, seine Wirkung dann um so strahlender entfaltet? Das Ausgraben geht ja dem Konsum voraus und weist als Erfahrung über ihn hinaus. Man ist genötigt, etwas zu finden, zu bergen, den Dreck abzuklopfen, sich zu vergewissern, sich einzulassen – um es dann zu neuem Glanz zu polieren. Ein Modus, dem schon im Suchen das Echtheitserlebnis innewohnt, das unserer Zeit so oft abgeht: Fundorte, Zustände, Fachgespräche. Dafür muss ich meinen Blick schärfen, mich öffnen für die Dinge, die nicht immer die naheliegenden sind. Und die vielleicht in der Rezeption auch erstmal eine Hürde bedeuten, weil sie, aus einer anderen Zeit und einem eigensinnigen ästhetischen Bewusstsein heraus, nicht gerade zugänglich erscheinen. Dieses neugierige Ausgraben verschafft der Wahrnehmung auf diesem Wege eine gesteigerte Intensität. Zum Glück also, könnte man sagen, verläuft meine Entdeckung damals nicht linear. Vielleicht komme ich sogar gerade richtig? Jedenfalls versetzt die Musik von Can mich auch noch zwanzig Jahre nach meiner Entdeckung in ekstatische Verzückung …
Nun gibt es mittlerweile schon einige Publikationen und Dokumentationen zu Can: das erst in England und dann übersetzt in Deutschland erscheinende Can Buch (1992), das neben Videomaterial von Hildegard Schmidt zusammengestellte Can Box: Book (1998), Anfang der 2000er-Jahre dann mehrere Einführungen von Robert von Zahn (etwa sein umfassender Text im sehr lesenswerten Ausstellungskatalog Pop am Rhein (2007)), die Linernotes der Vinylbox Lost Tapes (2012), Christoph Dallachs Oral History Future Sounds (2021) und zuletzt die Filmokumentation Can & me (2024) von Michael P. Aust. Mit All Gates Open ist 2018 eine formidable Bandbiografie entstanden, in der Rob Young nicht nur lückenlos erzählt, was es eben über die Gruppe zu berichten gibt, sondern auch den Transfer ihrer Wirkung ins 21. Jahrhundert beleuchtet: Neben interessanten Einblicken in die essayistischen Schriften Irmin Schmidts, in seine (Traum-)Tagebücher und Gedankenwelt, hat der Dirigent selbst im zweiten, von Max Dax und Robert Defcon entwickelten Buchteil Kiosk den Spieß umgedreht und sich mit einer illustren Künstlerschar unterhalten, die sich in der Vergangenheit als Verehrer von Can zu erkennen gegeben hat oder die das Mastermind der Band einfach selbst interessant findet.
Nachdem ich im Jahr 2017 für das Label Grönland die Holger-Czukay-Retrospektive CINEMA in Form einer umfangreichen Vinylbox kuratieren und ihn kurz vor seinem Tod noch zum ausführlichen Gespräch treffen durfte – die Veröffentlichung zu seinem 80. Geburtstag am 28. März 2018 erlebte er leider nicht mehr –, bin ich besonders glücklich, dass ich für dieses Buch Irmin Schmidt für mehrere ausführliche Gespräche gewinnen konnte. Ihm gilt mein ganzer Dank – für sein leuchtendes Werk, aber auch für seine Bereitschaft, mit mir zu sprechen, was mich weit über dieses Buch hinaus bewegt hat. Mit Schmidt reden ist intensiv, in ihm begegnen sich die kritische Zeugenschaft einer aufregenden Zeit und ein wacher Geist, pendelnd zwischen hohem Anspruch und einladendem Humor – sodass jedes seiner Worte, das er manchmal vielleicht selbst gar nicht so ernst nehmen möchte, wertvoll aufgeladen ist mit einer funkensprühenden kreativen Strahlkraft. Aus Schmidts Gedanken zu den von mir vorgegebenen Stichworten gehen den entsprechenden Essays jeweils kurze Zitate voraus und bilden die Grundlage meiner Auseinandersetzung, wie man sich das vielleicht auch im Songwritingprozess vorstellen kann: Einer bringt die Idee – und ein anderer beschäftigt sich dann mit der Ausarbeitung. So sind hier Texte entstanden, die das komplexe Werk der Kölner Musiker vor allem aber feiern wollen für das, was es bedeutet: ein einzigartiges musikalisches Kunstwerk!
»Fetzen aus der Musikgeschichte!«
Ein Gespräch mit Irmin Schmidt
Hendrik Otremba





























