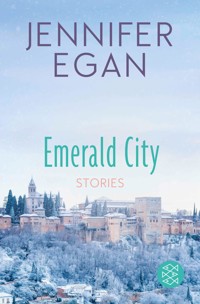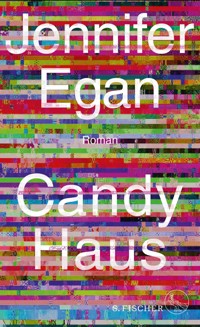
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit ihrem Roman »Der größere Teil der Welt« gelang Jennifer Egan der internationale Durchbruch. Jetzt knüpft sie in ihrem neuen visionären Roman »Candy Haus« über unsere Gegenwart ein schillerndes Netz aus Lebensläufen. Im Mittelpunkt steht der charismatische Bix Bouton, Gründer eines atemberaubenden Start-ups in Amerika. Sein Coup ist eine App, die unsere Erinnerungen ins Netz hochlädt. Ein gefährliches Glück, denn die Erinnerungen werden für andere sichtbar. Und da ist Bennie Salazar, Ex-Punk-Rocker, der als Musikproduzent in Luxus driftet und seinen Sohn an die Sucht verliert … New York, Chicago, Los Angeles – die Wüste, der Regenwald: Mit vor Energie funkelnden Figuren erzählt Egan von der Suche nach Familie und Geborgenheit in einer Zeit, in der die digitale Welt unsere Sehnsüchte auffrisst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jennifer Egan
Candy Haus
Roman
Über dieses Buch
In einem großen visionären Roman über unsere Gegenwart knüpft Jennifer Egan ein schillerndes Netz aus Lebensläufen. Im Mittelpunkt steht der charismatische Bix Bouton, Gründer eines atemberaubenden Start-ups. Sein Coup ist eine App, die unsere Erinnerungen ins Netz hochlädt. Ein gefährliches Glück, denn die Erinnerungen werden für andere sichtbar. Und da ist Bennie Salazar, Ex-Punk-Rocker, der als Musikproduzent in Luxus driftet und seinen Sohn an die Sucht verliert …
New York, Chicago, Los Angeles – die Wüste, der Regenwald: Mit vor Energie funkelnden Figuren erzählt Egan von der Suche nach Familie und Geborgenheit in einer Zeit, in der die digitale Welt unsere Sehnsüchte auffrisst: »das große literarische Ereignis«
The Standard
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Über Jennifer Egan und Henning Ahrens
Jennifer Egan wurde 1962 in Chicago geboren und wuchs in San Francisco auf. Sie lebt heute mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Brooklyn, New York. Neben ihren Romanen und Kurzgeschichten schreibt sie für den New Yorker sowie das New York Times Magazine und lehrt an der Columbia University Creative Writing. Für ihren Roman »Der größere Teil der Welt« erhielt sie 2011 den Pulitzer Prize, den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize. Zuletzt erschien ihr Roman »Manhattan Beach« (2017), der wochenlang auf der New York Times-Bestsellerliste stand.
Henning Ahrens lebt als Schriftsteller und Übersetzer in Frankfurt am Main. Er veröffentlichte diverse Lyrikbände sowie die Romane »Lauf Jäger lauf«, »Langsamer Walzer«, »Tiertage« und »Glantz und Gloria«. Für S. Fischer übersetzte er Romane von Richard Powers, Kevin Powers, Khaled Hosseini. Zuletzt erschien sein Roman »Mitgift«.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Candy House« bei Scribner, an imprint of Simon & Schuster, Inc., New York, USA.
Copyright © 2022 by Jennifer Egan
Für die deutschsprachige Ausgabe: © 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Büro Ziegler
Coverabbildung: nach einer Idee von Jamie Keenan/Keenandesign
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491585-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für meine Schreibgruppe,
meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
Landsmänner und Landsfrauen,
Ruth Danon
Lisa Fugard
Melissa Maxwell
David Rosenstock
Elizabeth Tippens
Mehr als der Himmel fasst – das Hirn –
Legst du sie Seit an Seit –
Umschließt das eine auch den andern –
Und dich – mit Leichtigkeit –
Emily Dickinson
Denn wenn man sie einmal hat,
ist nichts unerträglicher als Freiheit.
James Baldwin, Giovannis Zimmer
Aufbauen
Der Zauber des Vertrauten
1
»Weißt du, wonach ich mich sehne?«, fragte Bix, während er, wie üblich vor dem Schlafengehen, neben dem Bett Schultern und Wirbelsäule dehnte. »Einfach nur zu plaudern.«
Lizzie begegnete seinem Blick über die dunklen Locken Gregorys, ihres Jüngsten, hinweg, den sie gerade stillte. »Ich höre«, murmelte sie.
»Es ist …« Er holte tief Luft. »Ich weiß auch nicht. Heikel.«
Lizzie schnellte in die Senkrechte, und Bix begriff, dass sie alarmiert war. Der abgerutschte Gregory quakte: »Mama! Ich komme nicht mehr ran.« Er war gerade drei geworden.
»Der Junge muss abgestillt werden«, brummte Bix.
»Nein«, entgegnete Gregory und sah Bix trotzig an. »Das will ich nicht.«
Lizzie ließ sich von Gregorys Zerren erweichen und legte sich wieder hin. Bix fragte sich, ob das jüngste ihrer vier Kinder seine Kleinkindphase mit Unterstützung der Mutter bis ins Erwachsenendasein ausdehnen würde. Er legte sich neben die beiden und sah Lizzie beklommen in die Augen.
»Was ist denn los, Liebster?«, flüsterte sie.
»Ach, nichts«, log er, denn was ihn bedrückte, ging zu tief, war zu vielgestaltig für eine Erklärung. Er schob eine Tatsache hinterher: »Ich muss ständig an die East Seventh Street denken. An die Gespräche.«
»Immer noch«, sagte sie leise.
»Immer noch.«
»Aber warum denn?«
Bix wusste auch nicht, warum – zumal er immer nur mit halbem Ohr zugehört hatte, wenn Lizzie und ihre Clique, eingehüllt in eine Kumuluswolke aus Marihuanaqualm, in der East Seventh Street so laut gequatscht hatten wie verirrte Wanderer in einem nebeligen Tal: Was unterscheidet die Liebe von der Lust? Gibt es das Böse? Bix hatte seine Dissertation halb fertig, als er mit Lizzie zusammengezogen war, und derlei Gespräche hatte er schon in der High School und während der ersten Jahre an der Penn geführt. Seine gegenwärtige Nostalgie entsprang dem, was er empfunden hatte, während er, enthoben an seiner SPARCstation sitzend, die durch ein Modem mit dem Viola World Wide Web verbunden war, Lizzie und ihrer Clique gelauscht hatte: die heimliche und berauschende Gewissheit, dass die Welt, die diese Studierenden im Jahr 1992 so eifrig zu verstehen suchten, bald obsolet wäre.
Gregory saugte. Lizzie dämmerte. »Ginge das?«, drängte Bix. »Jetzt ein solches Gespräch zu führen?«
»Jetzt?« Sie wirkte ausgelaugt – wurde vor seinen Augen ausgesaugt! Bix wusste, dass sie um sechs Uhr aufstehen würde, um die Kinder zu versorgen, während er meditierte und anschließend seine Anrufe nach Asien tätigte. Er war auf einmal verzweifelt. Mit wem konnte er so entspannt, offen und studentisch reden wie damals am College? Jede Person, die bei Mandala arbeitete, würde sich irgendwie bemühen, ihm entgegenzukommen. Jede Person, die nicht bei Mandala arbeitete, würde meinen, er verfolge heimliche Absichten, oder glauben, es wäre ein Test – ein Test, dessen Belohnung in einer Anstellung bei Mandala bestünde! Seine Eltern, Schwestern? Er hatte, ganz gleich wie sehr er sie liebte, nie solche Gespräche mit ihnen gehabt.
Sobald Lizzie und Gregory tief und fest schliefen, trug Bix seinen Sohn durch den Flur zu dessen Kinderbett. Er beschloss, sich wieder anzuziehen und rauszugehen. Es war schon nach elf. Es verstieß gegen die Sicherheitsregularien des Vorstands, allein durch New York zu laufen, egal zu welcher Stunde, zumal nach Anbruch der Dunkelheit, und deshalb verzichtete er auf seine Markenzeichen, den just abgelegten, dekonstruierten Zoot Suit (inspiriert von den Ska-Bands, die er zu High-School-Zeiten vergöttert hatte) und den ledernen Trilby, den er seit fünfzehn Jahren, seit seinem Abgang von der NYU, trug, weil er sich nach dem Abschneiden seiner Dreadlocks sonderbar nackt gefühlt hatte. Er grub im Kleiderschrank eine Militärjacke mit Tarnmuster und ein altes Paar Stiefel aus und trat ohne Kopfbedeckung in das nächtliche Chelsea, der kalten Luft trotzend, die über seine Kopfhaut strich – oben war er kahl geworden. Er hatte den Impuls, seinen Hut doch noch zu holen, und wollte in die Kamera winken, damit die Wachleute ihn wieder einließen, als ihm ein Straßenhändler auffiel, der an der Ecke der Seventh Avenue stand. Bix ging durch die Twenty-first Street dorthin, setzte probehalber eine Beanie aus schwarzer Wolle auf und betrachtete sich in einem kleinen, runden Spiegel auf der Seite des Standes. Mit der Beanie sah er stinknormal aus, fand er. Der Verkäufer nahm den Fünf-Dollar-Schein entgegen wie bei allen Kunden, und der Kauf erfüllte Bix’ Herz mit spitzbübischer Freude. Inzwischen musste er damit rechnen, überall erkannt zu werden. Diese Anonymität war ein ganz neues Gefühl.
Früher Oktober, die Kälte war schneidend. Bix folgte der Seventh Avenue in Richtung Uptown und plante, nach ein paar Blocks umzukehren. Doch es tat gut, bei Dunkelheit zu gehen. Es versetzte ihn in seine Zeit in der East Seventh Street zurück: Damals, in ihren Anfangsjahren, waren Lizzies Eltern gelegentlich aus San Antonio zu Besuch gekommen. Sie glaubten, ihre Tochter würde das Apartment mit ihrer Freundin Sasha teilen, auch eine NYU-Anfängerin, eine Täuschung, an der diese mitwirkte, indem sie an dem Abend zu Beginn des Wintersemesters, als Lizzies Eltern das Apartment besichtigten, im Badezimmer die Wäsche wusch. Lizzie entstammte einer Welt, die Schwarze nicht wahrnahm, es sei denn sie arbeiteten als Diener oder Caddys im Country Club der Eltern. Ihre Furcht vor dem elterlichen Entsetzen bei der Entdeckung, dass sie mit ihrem schwarzen Freund zusammenlebte, war so groß, dass Bix während der ersten Besuche aus dem Bett verbannt wurde, obwohl die Alten in einem Hotel in Midtown wohnten! Aber egal; sie hätten es gewittert. Also war Bix durch die Straßen gelatscht und manchmal, unter dem Vorwand, eine Nachtschicht einzulegen, im Ingenieurslabor eingepennt. Dieses Umherirren hatte sich seinem Körper eingeprägt: als zähes Gebot, trotz Missmut und Erschöpfung weiterzugehen. Wenn er daran dachte, mitgespielt zu haben, fühlte er sich mies – obwohl die ausgleichende Gerechtigkeit, wie er fand, darin bestand, dass sich Lizzie nun um jeden Aspekt ihres häuslichen Daseins kümmerte, damit er nach Lust und Laune arbeiten und reisen konnte. All das Gute, das ihm seither widerfahren war, konnte man durchaus als Entschädigung für seine damaligen Wanderungen auffassen. Dennoch: warum? War der Sex wirklich so gut? (Nun, ja.) Hatte er sich dem arkanen Denken seiner weißen Freundin ohne Protest gefügt, weil sein Selbstwertgefühl so gering gewesen war? Hatte es ihm gefallen, ihr verbotenes Geheimnis zu sein?
Nein, nichts von alledem. Die Ursache für seine Langmütigkeit und Geduld hatte im Zauber der Vision bestanden, die er während seiner quälenden Exilnächte mit hypnotischer Klarheit vor Augen gehabt hatte. Lizzie und ihre Clique wussten 1992 nicht einmal ansatzweise, was das Internet war, aber Bix spürte die Vibrationen, mit denen die Fäden eines alles verbindenden, unsichtbaren Netzes die vertraute Welt zu durchziehen begannen, als wären es immer weiter um sich greifende Risse in einer Windschutzscheibe. Das Leben, wie sie es kannten, würde bald in Scherben gehen und hinweggefegt werden, und dann würden alle gemeinsam in eine neue, metaphysische Sphäre emporsteigen. Bix hatte dabei stets an die Gemälde des Jüngsten Gerichts gedacht, die er als Reproduktionen gesammelt hatte, allerdings ohne die Hölle, denn die Schwarzen, so glaubte er, würden in einer körperlosen Sphäre von dem Hass erlöst werden, der sie in der physischen Welt behinderte und hemmte. Sie könnten sich in dieser Sphäre nach Belieben versammeln und bewegen, ohne dem Druck von Typen wie Lizzies Eltern ausgesetzt zu sein: gesichtslose Texaner, die etwas gegen ihn hatten, ohne von seiner Existenz zu wissen. Der Begriff »Soziale Medien«, als Bezeichnung des Geschäftsmodells von Mandala, sollte erst zehn Jahre später geprägt werden, aber Bix hatte das Konzept schon lange vor der Umsetzung im Kopf.
Gottseidank hatte er seine utopische Phantasie damals für sich behalten. Heute, im Jahr 2010, kam sie ihm fast komisch naiv vor, aber ihre grundlegende Struktur hatte sich als tragfähig erwiesen, sowohl in globaler als auch in individueller Hinsicht. 1996 hatten Lizzies Eltern (zugeknöpft) ihrer Hochzeit im Tompkins Square Park beigewohnt, wenn auch nicht zugeknöpfter als Bix’ Eltern, in deren Augen Magier, Jongleure oder wildes Fiedeln nicht zu einer anständigen Eheschließung passten. Mit den Geburten der Kinder entspannten sich alle. Lizzies Vater war im letzten Jahr gestorben, und seither hatte Bix’ Schwiegermutter die Angewohnheit entwickelt, ihn anzurufen, wenn Lizzie schlief, um über die Familie zu reden: Werde Richard, ihr Ältester, reiten lernen? Gingen die Mädchen gern in Broadway-Musicals? Wenn seine Schwiegermutter leibhaftig anwesend war, empfand Bix ihren Texas-Slang als schwere Prüfung, aber wenn ihre Stimme am späten Abend im Telefon ertönte, sorgte das, wie er sich eingestehen musste, für eine leise Befriedigung. Jedes Wort, das sie im Äther wechselten, rief ihm ins Bewusstsein, dass er recht gehabt hatte.
Eines Morgens war es dann schlagartig vorbei mit den Gesprächen in der East Seventh Street. Nach einer durchgefeierten Nacht gingen zwei besonders enge Freunde Lizzies im East River schwimmen, und einer wurde von der Strömung mitgerissen und ertrank. Damals waren Lizzies Eltern zu Besuch gewesen, mit der Folge, dass Bix um ein Haar in diese Tragödie verwickelt worden wäre. In den frühen Morgenstunden war er Rob und Drew im East Village begegnet, sie hatten Ecstasy genommen und waren dann, bei Sonnenaufgang, zu dritt auf der Überführung zum Fluss gegangen. Bix war schon auf dem Heimweg gewesen, als die zwei weiter unten am Ufer spontan beschlossen hatten, ins Wasser zu gehen. Obwohl er im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen jedes Detail wiederholt hatte, waren seine Erinnerungen verblasst. Es war immerhin siebzehn Jahre her. Er hatte die beiden Jungs kaum noch vor Augen.
Er bog nach links auf den Broadway ab und ging bis zur 110th Street – sein erster Spaziergang dieser Art, seit er vor zehn Jahren berühmt geworden war. Er hatte nie viel Zeit im Viertel rund um die Columbia University verbracht, fand die hügeligen Straßen und prachtvollen Vorkriegs-Apartmenthäuser aber reizvoll. Als er zu einem der erhellten Fenster aufsah, konnte er regelrecht hören, wie dahinter hochpotenzierte Ideen köchelten.
Auf dem Weg zur U-Bahn (noch eine Premiere nach zehn Jahren) blieb er vor einem Laternenpfahl stehen, gefiedert mit Zetteln mit Angeboten von gebrauchten Möbeln oder der Bitte um Hilfe bei der Suche nach vermissten Haustieren. Ein gedrucktes Plakat fiel ihm ins Auge: ein Vortrag der Anthropologin Miranda Kline auf dem Campusgelände. Bix war mit Miranda Klines Arbeit umfassend vertraut und sie mit der seinen. Ein Jahr nach der Gründung von Mandala war ihm ihr Buch Muster des Vertrauten in die Hände gefallen. Die darin formulierten Ideen waren in seinem Geist explodiert wie die Tinte eines Kalmars und hatten ihn sehr reich gemacht. Die Tatsache, dass KM (wie Kline in seiner Welt liebevoll tituliert wurde) den Nutzen, den Bix und seinesgleichen aus ihren Theorien zogen, missbilligte, hatte die Faszination, die sie auf ihn ausübte, nur gesteigert.
Man hatte einen handschriftlichen Flyer an das Plakat getackert: »Lasst uns reden! Fachübergreifende große Fragen in verständlicher Sprache.« Drei Wochen nach Klines Vortrag sollte eine Diskussionsrunde stattfinden. Ein Zufall, der Bix’ Herz höherschlagen ließ. Er fotografierte das Plakat, riss danach aus Jux einen der Papierstreifen des »Lasst uns reden!«-Flyers ab und steckte ihn ein, wobei er sich wunderte, dass in dieser neuen, von ihm mitgestalteten Welt bis heute Zettel an Laternenpfähle geheftet wurden.
2
Drei Wochen später fand sich Bix in der achten Etage eines der prächtigen, etwas abgehalfterten Apartmentgebäude im Umkreis der Columbia University wieder – vielleicht in genau jenem, das er von der Straße aus bewundert hatte. Das Apartment entsprach auf angenehme Art dem Bild, das er sich davon gemacht hatte: abgetretene Parkettfußböden, von Schlieren bedeckte weiße Fußleisten, gerahmte Radierungen und kleine Skulpturen (Gastgeberin und Gastgeber hatten jeweils eine Professur für Kunstgeschichte inne). Kunstobjekte hingen an den Wänden und über den Türen, waren in Bücherregale gequetscht worden.
Abgesehen von den Gastgebern und einem weiteren Paar kannten sich alle acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei »Lasst uns reden« nicht. Bix hatte beschlossen, den Vortrag von Miranda Kline nicht zu besuchen (falls er sich überhaupt hätte hineinschmuggeln können); angesichts der Antipathie, die sie ihm entgegenbrachte, wäre es falsch gewesen, hinzugehen, selbst getarnt. Seine jetzige Tarnung hieß »Walter Wade«, Promovend der Elektrotechnik – anders gesagt, Bix vor siebzehn Jahren. Die Chuzpe, sich als Promovend auszugeben, entsprang seiner Überzeugung, mit einundvierzig viel jünger zu wirken als die meisten Weißen. Seine Annahme, alle anderen an der Diskussion Teilnehmenden wären weiß, erwies sich aber als Irrtum: Portia, die Kunstgeschichtsprofessorin war Asiatin, außerdem gab es eine brasilianische Latina, Professorin für Anthrozoologie. Rebecca Amari, die Jüngste in der Runde, eine Soziologiepromovendin (neben »Walter Wade« die einzige andere Studierende), war ethnisch nicht klar einzuordnen, doch er hielt sie für schwarz – es hatte kurz gefunkt, als würden sie einander erkennen. Rebecca war obendrein entwaffnend hübsch, ein Eindruck, den ihre Dick-Tracy-Brille nicht schmälerte, sondern steigerte.
Zum Glück hatte Bix weitere Kniffe der Identitätsverschleierung gemeistert. Er hatte im Netz ein Kopftuch mit daran befestigten Dreadlocks gekauft. Es war sensationell teuer gewesen, aber die Haare wirkten echt, fühlten sich auch so an, und das Gewicht, mit dem sie zwischen seinen Schulterblättern lagen, glich einer geisterhaften Berührung. Dieses Gewicht war ihm jahrelang vertraut gewesen, und es war schön, es wieder zu spüren.
Nachdem alle auf Sofas und Stühlen Platz genommen und sich einander vorgestellt hatten, fragte Bix, der seine Neugier nicht unterdrücken konnte: »Und? Wie war Miranda Kline?«
»Erstaunlich witzig«, sagte Ted Hollander, Portias Kunsthistorikergatte. Er sah aus wie Ende fünfzig, eine Generation älter als Portia. Ihre kleine Tochter war bereits ins Wohnzimmer gestürmt, gejagt von einer babysittenden Studierenden. »Ich hatte angenommen, sie wäre mürrisch, aber sie war fast verspielt.«
»Wenn sie mürrisch ist, dann nur, weil man ihre Ideen klaut«, meinte Fern, Dekanin des Frauenforschungsseminars und, wie Bix fand, selbst ziemlich mürrisch wirkend.
»Man hat ihre Ideen angewandt, wie sie es nie beabsichtigt hatte«, sagte Ted. »Aber ich glaube, nicht mal Kline würde das Diebstahl nennen.«
»Sie bezeichnet es als ›Pervertierung‹, stimmt’s?«, fragte Rebecca zögernd.
»Ich fand sie überraschend schön«, sagte Tessa, eine junge Tanzprofessorin, deren Mann Cyril (Mathematik), ebenfalls anwesend war. »Immerhin ist sie sechzig.«
»Ähm«, warf Ted gutmütig ein. »Sechzig ist noch nicht steinalt.«
»Tut ihre äußere Erscheinung etwas zur Sache?«, wollte Fern herausfordernd von Tessa wissen.
Cyril, der sich stets auf Tessas Seite schlug, reagierte scharf auf diese Frage. »Miranda Kline würde es für relevant halten«, sagte er. »Mehr als die Hälfte der Vertrautheits-Traits, die sie in ihrem Buch nennt, hängen mit Äußerlichkeiten zusammen.«
»Muster des Vertrauten könnte unsere Reaktion auf Miranda Kline sicher erklären«, meinte Tessa.
Obwohl zustimmend gemurmelt wurde, war Bix überzeugt, dass außer ihm nur Cyril und Tessa Klines Meisterwerk kannten, eine schmale Abhandlung, Algorithmen enthaltend, die Einfluss und Vertrauen unter den Angehörigen eines brasilianischen Stammes erläuterten. Man sprach gern vom »Genom der Geneigtheit«.
»Schon traurig«, sagte Portia. »Man kennt Kline weniger als Autorin, sondern vor allem, weil ihr Buch von Social-Media-Unternehmen zweckentfremdet wurde.«
»Wäre es nicht zweckentfremdet worden, dann hätten keine fünfhundert Menschen den Vortrag gehört«, sagte Eamon, Gastdozent und Kulturhistoriker an der University of Edinburgh, der an einem Buch über Produktbesprechungen arbeitete. Bix hatte den Eindruck, dass sein langes Gesicht mit der teilnahmslosen Miene eine unzulässige Erregtheit verbarg wie ein Fertighaus ein Meth-Labor.
»Vielleicht kämpft sie für die ursprünglichen Anliegen ihres Buches, um damit verbunden zu bleiben – es soll ihres bleiben«, sagte Kacia, die brasilianische Anthrozoologieprofessorin.
»Vielleicht hätte sie längst neue Theorien vorgelegt, wenn sie nicht so eifrig damit beschäftigt wäre, die alten zu verteidigen«, konterte Eamon.
»Wie viele fruchtbare Theorien produzieren Forscher und Forscherinnen im Laufe ihres Lebens?«, fragte Cyril.
»Gute Frage«, murmelte Bix und spürte, wie sich eine vertraute Furcht in ihm regte.
»Zumal sie spät begonnen hat«, ergänzte Fern.
»Oder vielleicht Mutter ist«, sagte Portia und sah beklommen zum Spielzeugherd ihrer Tochter, der in einer Ecke des Wohnzimmers stand.
»Genau darum hat Miranda Kline so spät losgelegt«, sagte Fern. »Sie bekam rasch nacheinander zwei Töchter, die noch Windeln trugen, als sie von ihrem Mann verlassen wurde. Er heißt Kline, nicht sie. Er ist Musikproduzent oder so.«
»Das ist echt beschissen.« Bix rang sich diese Vulgarität ab, weil sie Teil seiner Tarnung war. Er war bekannt dafür, nie vulgär zu sein; seine Mutter, die Grundschul-Abschlussklassen in Grammatik unterrichtete, hatte den Stumpfsinn und die Infantilität von verbalem Schmutz dieser Art stets mit einer so bissigen Verachtung bedacht, dass sie das darin enthaltene Provokationspotenzial komplett ausgelöscht hatte. Bix empfand es später als Vorteil, sich durch den Verzicht auf Vulgaritäten von anderen führenden Tech-Köpfen abzuheben, die für ihre unflätigen Tiraden berüchtigt waren.
»Außerdem lebt ihr Mann nicht mehr«, sagte Fern. »Zum Teufel mit ihm.«
»Huh, wir haben eine Erinnye unter uns«, sagte Eamon mit einem vielsagenden Zucken der Augenbrauen. Obwohl von »verständlicher Sprache« die Rede gewesen war, schienen diese Professoren dem akademischen Habitus hilflos ausgeliefert zu sein; Bix malte sich aus, wie Cyril und Tessa, im Bett kuschelnd, mit Begriffen wie »Desideratum« und »rein abstrakt« hantierten.
Rebecca fing seinen Blick auf, und Bix grinste – er fühlte sich so high, als würde er just sein Hemd abstreifen. Im letzten Jahr hatte man ihm anlässlich seines vierzigsten Geburtstags eine Hochglanzbroschüre mit dem Titel »Bixpressiv« überreicht, in der, durch Fotos illustriert, sämtliche Bedeutungen aufgelistet waren, die man mit den subtilen Regungen und Bewegungen seiner Augen, seiner Hände und seiner Körperhaltung verband. Vor Jahren, als einziger schwarzer Promovend im Ingenieurslabor der NYU, hatte er sich dabei ertappt, über jeden Witz seiner Kollegen herzhaft zu lachen und diese im Gegenzug selbst zum Lachen zu bringen, eine Dynamik, die ihn bedrückt und wie ausgehöhlt zurückgelassen hatte. Nach der Promotion stellte er zuerst das Lachen, danach das Lächeln bei der Arbeit ein und kultivierte eine Ausstrahlung hochkonzentrierter Hingabe. Er lauschte, er beobachtete, aber ohne jede äußere Regung. Diese Selbstdisziplin hatte zu einer so intensiven Konzentration geführt, dass er rückblickend überzeugt war, sie habe ihm geholfen, all jene Mächte auszumanövrieren und auszutricksen, die sich anschickten, ihn zu schlucken, zu instrumentalisieren, beiseitezuschieben und durch die weißen Männer zu ersetzen, die alle Welt erwartete. Selbstverständlich hatte man ihn attackiert – von oben und von unten, von innen und von allen Seiten. Manchmal taten das Freunde; manchmal hatte er ihnen vertraut. Aber nie ganz. Bix ahnte jeden Schachzug voraus, der ihn unterminieren oder aus dem Sattel werfen sollte, lange bevor er vollzogen wurde, und wenn dies geschah, hatte er schon den Gegenzug parat. Niemandem gelang es, ihm eine Nasenlänge voraus zu sein. Manchen dieser Leute gab er einen Job, um sich ihre Energie und Gerissenheit für seine eigene Arbeit zunutze zu machen.
Bix’ Vater hatte den Aufstieg seines Sohnes argwöhnisch verfolgt. Eine silberne Armbanduhr tragend, Ruhestandspräsent der Firma für Heiz- und Kühltechnik am Rand Philadelphias, in der er einen leitenden Posten gehabt hatte, verteidigte er 1985 den Beschluss von Bürgermeister Goode, das Haus der MOVE-»Trottel« zu beschießen, die »den Bürgermeister in eine unmögliche Situation gebracht haben« (so sein Vater). Bix war sechzehn gewesen, und durch den Streit, den er wegen der Beschießung und Zerstörung zweier Wohnblocks mit seinem Vater geführt hatte, hatte sich eine Kluft zwischen ihnen aufgetan, die sich nicht mehr überbrücken ließ. Er spürte die Missbilligung seines Vaters bis heute – weil er zu hoch hinauswollte, eine Berühmtheit (also angreifbar) geworden war oder die Vorträge seines alten Herrn nicht beherzigt hatte, die dieser, am Bug eines kleinen Motorboots sitzend, mit dem er vor der Küste Floridas angelte, bis heute gern hielt und deren Refrain in Bix’ Ohren folgendermaßen lautete: Bescheide dich, sonst tut man dir weh.
»Ich frage mich«, sinnierte Rebecca schüchtern, »ob Miranda Kline aufgrund dessen, was mit ihrer Theorie geschehen ist, als tragische Gestalt gelten kann. Im Sinne der antiken Griechen, meine ich.«
»Interessant«, sagte Tessa.
»Schauen wir mal in die Poetik«, sagte Portia, und Bix sah verblüfft zu, wie sich Ted vom Stuhl erhob, um die Buchausgabe zu suchen. Diese Akademiker schienen nicht mal ein BlackBerry zu besitzen, von einem iPhone ganz zu schweigen – und das im Jahr 2010! Er kam sich vor, als hätte er ein geheimes Luddisten-Nest infiltriert! Bix stand auf, als wollte er Ted bei der Suche helfen, obwohl er nur neugierig auf die Wohnung war. Alle Wände hatten eingebaute Bücherregale, selbst die im Flur, und er musterte im Vorbeischlendern die Rücken großformatiger Hardcover-Kunstbände und alter, vergilbter Taschenbücher. Dazwischen standen verblasste, gerahmte Fotografien: kleine Jungs, die zwischen zusammengeschobenem Laub oder Schnee oder üppigem Sommergrün grinsend vor einem maroden Haus hockten. Jungs mit Baseballschlägern, Fußbällen. Wer mochten sie sein? Das Foto eines wesentlich jüngeren Ted Hollander, der einen Jungen in die Höhe stemmte, damit dieser einen Stern auf die Spitze eines Weihnachtsbaums setzen konnte, lieferte die Antwort. Der Professor hatte ein anderes Leben gehabt – in einem Vorort oder auf dem Land, wo er vor der Verbreitung der digitalen Fotografie seine Söhne großgezogen hatte. Ob Portia seine Studentin gewesen war? Der Altersabstand war beträchtlich. Ted musste sein früheres Leben natürlich nicht unbedingt in den Wind geschossen haben. Denkbar war auch, dass er in den Wind geschossen worden war.
Konnte man neu beginnen, ohne alles in den Wind zu schießen?
Diese Frage steigerte die Furcht, die Bix zuvor befallen hatte, und er verschwand ins Bad, um sie abzuschütteln. Über einem wuchtigen Porzellanwaschbecken hing ein fleckiger Spiegel, und er setzte sich auf den Klodeckel, um nicht hineinschauen zu müssen. Er schloss die Augen und konzentrierte sich auf seinen Atem. Seine Ursprungsvision – die leuchtende Sphäre der Verknüpfung –, die er während seiner Jahre in der East Seventh Street entwickelt hatte, war jetzt Mandalas Geschäftsmodell: Sie musste implementiert, ausgebaut, verfeinert, in Geld umgewandelt, verkauft, erhalten, verbessert, aufgefrischt, allgegenwärtig gemacht, standardisiert und globalisiert werden. Diese Arbeit wäre bald getan. Und dann? Er war sich seit langem einer Erhebung bewusst, die sich in mittlerer Entfernung durch seine geistige Landschaft zog. Dahinter wartete die nächste Vision, doch wenn er über die Erhebung zu spähen versuchte, war da nur Weiß. Anfangs hatte er sich dieser fahlen Weite voller Neugier genähert: Handelte es sich um Eisberge? Um eine Vision, die mit dem Klima zusammenhing? Um den Vorhang vor einer dramatischen oder um die leere Leinwand einer kinematographischen Vision? Allmählich ging ihm auf, dass das Weiß keine Substanz war, sondern eine Leerstelle. Es war das Nichts. Bix fehlte eine Vision, die über jene hinausging, die er so gut wie erschöpft hatte.
Eines Sonntagvormittags, einige Monate nach seinem Vierzigsten, er lümmelte mit Lizzie und den Kindern im Bett, verfestigte sich diese Einsicht endgültig, und das blanke Entsetzen, das ihn daraufhin erfasste, ließ ihn ins Bad rennen, wo er sich heimlich erbrach. Das Fehlen einer neuen Vision brachte alles ins Wanken; welchen Wert besaß das, was er erreicht hatte, wenn es nach der Vollendung ins Nichts führte – wenn er sich mit vierzig gezwungen sähe, neue Ideen zu kaufen oder zu klauen? Diese Vorstellung gab ihm das Gefühl, verfolgt, gejagt zu werden. Hatte er tatsächlich zu hoch hinausgewollt? In dem Jahr, das seit jenem entsetzlichen Sonntagvormittag verstrichen war, hatte diese Antivision stets einen Schatten auf ihn geworfen, manchmal schwach, aber durchweg präsent, egal ob er seine Kinder zur Schule brachte oder im Weißen Haus dinierte, was in den anderthalb Jahren, seit Barack und Michelle dort Einzug gehalten hatten, viermal der Fall gewesen war. Ob er vor einem tausendköpfigen Publikum sprach oder Lizzie im Bett zu einem ihrer schwer erreichbaren Orgasmen verhalf – plötzlich war es wieder da, das Dröhnen der unheilvollen Leere, Vorbote eines Nichts, das ihn quälte und erschreckte. Er hatte sich mehr als einmal vorgestellt, an Lizzie geklammert zu wimmern: »Hilf mir. Ich bin am Ende.« Aber so etwas durfte Bix Bouton nicht sagen, niemals und zu niemandem. Er musste sich behaupten; seine Rolle als Ehemann, Vater, Boss, Tech-Ikone, braver Sohn, mächtiger politischer Faktor und hingebungsvoller Sexualpartner ausfüllen. All das passte nicht zu dem Mann, der sich in der Hoffnung auf eine Erleuchtung, die das ihm verbleibende Leben prägen würde, nach seiner Uni-Zeit zurücksehnte.
Als er ins Wohnzimmer zurückkehrte, beugten sich Cyril und Tessa mit einem so sinnlichen Entzücken über ein Buch, als wäre dieses ein Becher voller Eiscreme. »Sie haben es gefunden«, sagte Bix, und Tessa reckte grinsend einen Aristoteles-Band aus der Edition »Meisterwerke« in die Höhe, die seine Eltern zusammen mit ihrer geliebten Encyclopedia Britannica erworben hatten. Bix hatte die Britannica als Kind ehrfurchtsvoll konsultiert und in Schulaufsätzen über Kannibalen, Schierling und Pluto daraus zitiert; die Einträge über Tiere hatte er aus reinem Vergnügen gelesen. Als seine Eltern vor vier Jahren nach Florida in eine kleine Eigentumswohnung gezogen waren – sein Angebot, sie beim Kauf einer größeren zu unterstützen, hatten sie ausgeschlagen, sein Vater aus Stolz, seine Mutter aus Bescheidenheit –, hatte Bix diese Bücher in Kartons getan und vor seinem Kindheitszuhause in West Philadelphia auf den Bürgersteig gestellt. In der neuen Welt, an deren Erschaffung er mitgewirkt hatte, würde man nie wieder ein Lexikon zur Hand nehmen müssen.
»Wenn ich es richtig sehe«, sagte Tessa, »ist Miranda Kline keine tragische Gestalt im Sinne von Aristoteles – aber ich bin natürlich Professorin für zeitgenössischen Tanz, und versiertere Leute haben Millionen Seiten zu diesem Thema geschrieben. Eine wahrhaft tragische Gestalt wäre sie nur dann, wenn die Personen, die sich ihre Theorie angeeignet haben, mit ihr verwandt wären. Das würde den Verrat und die dramatische Ironie betonen.«
»Außerdem hat sie ihre Theorie verkauft, richtig? Oder waren es die Algorithmen?«, fragte Kacia.
»Das ist nach wie vor ein Rätsel«, sagte Portia. »Irgendjemand hat verkauft, aber Kline war es nicht.«
»Es ist ihr geistiges Eigentum«, sagte Fern. »Jemand anderer hätte es schwerlich verkaufen können, richtig?«
Bix, einer der Käufer von Klines Algorithmen, wand sich innerlich wegen seines heiklen Doppelspiels. Zu seiner Erleichterung sagte Ted: »Eine andere Frage: Miranda Klines Algorithmen haben es Social-Media-Unternehmen ermöglicht, Vertrauen und Einfluss zu prognostizieren, und sie haben ein Vermögen damit gemacht. Was ist daran so schlecht?«
Alle drehten sich verdutzt zu ihm um. »Ich sage nicht, dass es nicht schlecht ist«, ergänzte Ted, »aber ich finde, wir müssen es differenziert betrachten. Ein Beispiel: Beim Baseball lässt sich alles rechnerisch erfassen, Schnelligkeit und Art der Schläge, wer die Base erreicht und wie. Das Spiel ist natürlich eine dynamische Interaktion zwischen Menschen, aber diese lässt sich auch durch Ziffern und Symbole erfassen und kann von allen gelesen werden, die sie zu deuten verstehen.«
»Und das kannst du?«, fragte Cyril skeptisch.
»Ja, das kann er«, sagte Portia lachend und legte einen Arm um ihren Mann.
»Meine drei Söhne haben in der Little League gespielt«, sagte Ted. »Man könnte es als Stockholm Syndrom verbuchen.«
»Drei?«, fragte Bix. »Ich habe die Fotos gesehen und dachte, es wären zwei.«
»Das Drama des mittleren Sohns«, sagte Ted. »Alle vergessen den armen Ames. Und ich sage nur, dass die Quantifizierung an sich das Baseball nicht ruiniert. Im Gegenteil, es hilft uns, das Spiel zu verstehen. Warum reagieren wir dann so abwehrend, wenn es um die Quantifizierung unserer selbst geht?«
Bix hatte online recherchiert und wusste, dass Ted Hollander seinen akademischen Durchbruch 1998 gehabt hatte, in jenem Jahr, als Bix Mandala als Unternehmen hatte eintragen lassen. Ted hatte sich schon in der mittleren Phase seiner Karriere befunden, als er das Buch Van Gogh, Maler des Klangs, veröffentlicht hatte, in dem er Bezüge zwischen Van Goghs Pinselführung und den Geräuschen der Geschöpfe herstellte, die den Maler umgeben hatten, etwa Zikaden, Bienen, Grillen oder Spechte – deren mikroskopisch kleine Spuren in der Farbe entdeckt worden waren.
»In diesem Punkt sind Ted und ich uneins«, sagte Portia. »Wenn es darum geht, Menschen zu quantifizieren, um von ihrem Handeln zu profitieren, dann halte ich das für entmenschlichend – ja, sogar für dystopisch im Sinne von Orwell.«
»Wissenschaft ist Quantifizierung«, entgegnete Kacia. »Auf diese Art lösen wir Rätsel und machen Entdeckungen. Und bei jedem neuen Schritt befällt uns die Sorge, wir könnten ›die rote Linie‹ überschreiten. Früher nannte man das Blasphemie, heute bleibt man vager, spricht nur davon, zu viel zu wissen. In meinem Labor haben wir begonnen, das Bewusstsein von Tieren zu externalisieren …«
»Verzeihung?« Bix glaubte, sich verhört zu haben. »Sie tun was?«
»Wir können die Wahrnehmung von Tieren uploaden«, sagte Kacia. »Mit Hilfe von Gehirnsensoren. Ich kann, um ein Beispiel zu nennen, einen Teil des Bewusstseins einer Katze einfangen und dann mit einem Headset durch ihre Augen schauen, als wäre ich sie. Das wird uns Aufschluss über die Wahrnehmungsweise und das Gedächtnis unterschiedlichster Tierarten geben – genau genommen, über ihr Denken.«
Bix war plötzlich wie elektrisiert.
»Die Technologie steckt noch in den Kinderschuhen«, sagte Kacia. »Trotzdem gibt es schon Kontroversen: Überschreiten wir eine rote Linie, indem wir in das Bewusstsein eines fühlenden Geschöpfs eindringen? Öffnen wir die Büchse der Pandora?«
»Womit wir wieder beim Thema freier Wille wären«, sagte Eamon. »Wären wir nur Marionetten, wenn Gott allmächtig wäre? Und was wäre besser, wenn das zuträfe? Es zu wissen oder nicht?«
»Zum Teufel mit Gott«, sagte Fern. »Das Internet beunruhigt mich.«
»Du meinst die allwissende, alles sehende Wesenheit, die, obwohl wir uns einbilden, selbst zu entscheiden, unser Handeln vorhersagt und kontrolliert?« Eamon sagte dies mit einem scheuen Blick auf Rebecca. Er hatte den ganzen Abend mit ihr geflirtet.
»Ah!«, sagte Tessa, indem sie Cyrils Hand ergriff. »Jetzt wird es interessant.«
3
Bix verließ Teds und Portias Apartment in strahlender Zuversicht. Im Laufe der Diskussion hatte er mehrmals gespürt, dass sich etwas in ihm geregt hatte, dass sein Denken auf jene Art angekurbelt worden war, die er von früher kannte. Er fuhr mit Eamon, Cyril und Tessa im Fahrstuhl nach unten, während sich die anderen im Apartment noch Gipsreliefs anschauten, die Ted vor Jahrzehnten aus Neapel mitgebracht hatte. Draußen vor dem Gebäude gab es noch Smalltalk, und Bix harrte aus, weil er nicht wusste, wie er sich abseilen sollte, ohne unhöflich zu sein. Außerdem scheute er davor zurück, sich vor den Augen der anderen in Richtung Downtown zu bewegen; würde ein graduierter Columbia-Student dort wohnen?
Wie sich herausstellte, ging Eamon nach Westen. Cyril und Tessa wiederum nahmen einen Zug nach Inwood, weil sie sich die Mieten im Viertel der Columbia University nicht mehr leisten konnten und als Assistenzprofessoren keine Fakultätswohnung bekamen. Bix dachte mit schlechtem Gewissen an sein fünfstöckiges Stadthaus. Tessa und Cyril hatten erwähnt, keine Kinder zu haben, und das Drahtgestell von Cyrils Brille wurde auf einer Seite von einer Büroklammer zusammengehalten. Andererseits schienen beide einen knisternden Draht zueinander zu haben; Ideen waren ihnen offenbar genug.
Ermutigt durch das Gefühl, als Walter Wade jeden beliebigen Ort aufsuchen zu können, trabte Bix in Richtung Central Park. Die halb entlaubten Bäume, die sich vor dem fahlen Himmel abzeichneten, schreckten ihn jedoch ab, bevor er den Eingang erreichte. Er sehnte sich nach Schnee; er liebte die New Yorker Schneenächte. Er hätte jetzt gern neben Lizzie und jenen Kindern gelegen, die in ihr ozeanisches Bett gespült worden waren, sei es wegen des Stillens, sei es wegen Albträumen. Es war schon nach elf. Er kehrte zum Broadway zurück und stieg in einen Zug der Linie 1, bemerkte dann einen Expresszug in der Ninety-sixth Street und stieg in der Hoffnung um, dieser wäre schneller als ein Local. Er exhumierte eine weitere Requisite aus seinem Walter-Wade-Rucksack: Die Ulysses-Ausgabe, die er während der Arbeit an seiner Dissertation gelesen hatte, um seine literarischen Kenntnisse zu vertiefen. Das konkrete Ergebnis dieser Lektüre war Lizzie gewesen, denn die Mischung aus James Joyce und hüftlangen Dreadlocks hatte ein überwältigend starkes sexuelles Verlangen in ihr ausgelöst (Miranda Kline hätte dies sicher mit einer Formel erklären können). Was Bix betraf, so enthielt diese Formel braune Kunstlederstiefel, die bis über Lizzies Knie gereicht hatten. Er hatte die Ulysses-Ausgabe, deren Abnutzungsspuren nicht der intensiven Lektüre, sondern den Jahren zu verdanken waren, die das Buch auf dem Buckel hatte, als romantisches Souvenir aufbewahrt. Er schlug es auf gut Glück auf.
»… Eureka!, rief Buck Mulligan. Eureka!«
Während des Lesens hatte Bix das Gefühl, angestarrt zu werden, für ihn so alltäglich, dass er nicht reagierte, aber schließlich sah er doch auf. Rebecca Amari saß am anderen Ende des U-Bahnwagens und betrachtete ihn. Er lächelte sie an und hob eine Hand. Sie erwiderte die Geste, und er war erleichtert, dass es okay war, sie freundlich zur Kenntnis zu nehmen, aber weit von ihr entfernt zu sitzen. War das okay? Oder musste ein wortloser Gruß nach einer stundenlangen, lebhaften Diskussion als unsozial gelten? Bix hatte so selten mit Fragen simpler sozialer Etikette zu tun, dass er die Regeln längst vergessen hatte. Im Zweifel die Höflichkeit; diesen Rat seiner penibel höflichen Mutter hatte er zu tief verinnerlicht, um ihn jemals vergessen zu können. Er steckte Ulysses zögernd ein, ging durch den Wagen zu Rebecca und setzte sich neben sie. Das kam ihm sogleich ungehörig vor – sie berührten einander von der Schulter bis zum Knie! Oder war dieser Körperkontakt für U-Bahn-Fahrgäste ganz normal? Das Blut schoss ihm mit so hohem Druck ins Gesicht, dass ihn schwindelte. Er ermahnte sich selbst: Wenn eine stinknormale soziale Interaktion dazu führte, dass er kurz vor einem Herzinfarkt stand, stimmte etwas nicht. Seine Berühmtheit hatte ihn verweichlichen lassen.
»Sie wohnen in Downtown?«, brachte er schließlich hervor.
»Ich treffe mich mit Freunden«, sagte sie. »Und Sie?«
»Ich auch.«
In diesem Moment sah Bix, dass seine Station – Twenty-third Street – am Fenster vorbeizischte; er hatte nicht bedacht, dass er in einen Expresszug gestiegen war. Er fragte sich, ob Rebecca an der nächsten Station aussteigen würde, Fourteenth Street, die auf der Strecke zu dem Viertel lag, das als MALANDA bekannt war, Mandala-Land. Dort hatte Bix im Jahr nach 9/11 einen neuen Campus eröffnet, der sich im Laufe der nächsten acht Jahre auf Fabrikgebäude, Lagerhäuser und ganze Reihenhauszeilen ausgeweitet hatte, bis es schließlich scherzhaft hieß, wenn man unterhalb der West Twentieth Street die Hähne aufdrehe, entströme ihnen Mandala-Wasser. Als sich der Zug der Fourteenth Street näherte, erwog Bix, auszusteigen und zu Fuß nach Hause zu gehen. Andererseits fand er es riskant, ja fast pervers, in seiner Kostümierung über den eigenen Campus zu laufen. Gerade fuhr ein Downtown-Local ein; er beschloss, noch eine Station abzuwarten und dann in einem Upton-Local umzukehren.
»Ist das hier Ihre Station?«, fragte Rebecca, als sie ausstiegen.
»Ich steige um.«
»Oh – ich auch.«
Im nach Süden fahrenden Zug der Linie 1 blieben sie stehen. Bix beschlich ein leiser Argwohn; war es möglich, dass Rebecca ihn erkannt hatte und verfolgte? Andererseits wirkte sie locker, nicht berühmtheitsfiebrig, und sein Argwohn wich der Freude, mit einer hübschen Frau in der U-Bahn unterwegs zu sein. Und dann hatte er einen launigen Einfall: in Downtown auszusteigen und zur alten Wohnung in der East Seventh Street zu gehen! Er könnte zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt zu den Fenstern aufschauen, hinter denen er mit Lizzie gewohnt hatte.
Als er Anstalten machte, in der Christopher Street auszusteigen, fiel ihm auf, dass sich Rebecca auch in Bewegung zu setzen schien. Sie stieg tatsächlich auch aus. »Vielleicht haben wir ja dasselbe Ziel«, meinte sie lachend, als sie die Treppe hinaufgingen.
»Halte ich für unwahrscheinlich«, erwiderte Bix.
Dann bog auch Rebecca nach Osten in die West Fourth Street ein. Bix’ Argwohn erwachte wieder. »Haben Sie Freunde an der NYU?«, fragte er.
»Ein paar.«
»Sie sind verschlossen.«
»Das ist mein Wesen.«
»Paranoid?«
»Vorsichtig.«
Er war froh über den Lärm der Stadt, denn dieser füllte die Stille aus. Rebecca sah unterwegs geradeaus, was es Bix erlaubte, die delikate Symmetrie ihres Gesichts und ihre sommersprossigen, an Schmetterlingsflügel erinnernden Wangenknochen zu betrachten. Vielleicht war sie so vorsichtig, weil sie so hübsch war. Vielleicht trug sie die Hornbrille, um ihre Schönheit zu kaschieren.
Sie wandte sich um und bemerkte seinen Blick. »Echt schräg«, sagte sie. »Sie sehen beinahe aus wie Bix. Sie könnten Brüder sein.«
»Wir sind beide schwarz«, sagte Bix grinsend, eine Erwiderung, die er sich für Weiße zurechtgelegt hatte.
Rebecca lachte. »Meine Mom ist schwarz«, sagte sie. »Halb schwarz, halb indonesisch. Mein Dad ist halb Schwede, halb syrischer Jude. Ich wurde jüdisch erzogen.«
»Für so was gewinnt man Preise, richtig? Bei Wettbewerben um die größte Buntheit?«
»Es ist tatsächlich ein Gewinn. Denn alle glauben, ich wäre eine von ihnen.«
Bix starrte sie an. »Sie haben den Zauber des Vertrauten«, hauchte er ehrfürchtig. Diese Formulierung stammte aus Muster des Vertrauten. Laut Miranda Kline war der Zauber des Vertrauten ein machtvoller Aktivposten, der den wenigen Menschen, die mit ihm gesegnet waren, den beneidenswerten Status eines Universellen Verbündeten verlieh.
»Moment mal«, sagte Rebecca. »Sie waren nicht bei dem Vortrag.«
»Ich … habe das Buch gelesen.«
Sie hatten an der Bowery auf Grün gewartet und passierten stumm den nächsten Block. An der Ecke der Second Avenue fuhr Rebecca zu ihm herum. »Vor drei Jahren, in meinem letzten Jahr am Smith«, stieß sie hervor, »wurden alle Spitzenschülerinnen ›unbestimmbarer ethnischer Herkunft‹ von der Homeland Security vernommen. Vor allem, wenn sie Sprachen studierten.«
»Oha.«
»Sie waren ziemlich hartnäckig«, sagte sie. »Ein Nein ließen sie nicht gelten.«
»Glaube ich gern. Mit Ihrem Zauber des Vertrauten könnten Sie überall arbeiten.«
Als sie sich der First Avenue näherten, begann Bix, sich die liebsten Wegmarken in Erinnerung zu rufen: Benny’s Burritos; das Polonia mit den unglaublichen Suppen; den Zeitungsstand am Tompkins Square Park, der Egg Cream verkaufte. Er fragte sich, ob es die Läden noch gab. An der First Avenue blieb er stehen, um sich zu verabschieden, bevor er links abbog – aber Rebecca wandte sich auch nach Norden. Er konnte seinen schwelenden Argwohn nicht mehr unterdrücken. Er beschleunigte seine Schritte und warf einen Blick auf die lange, graue Avenue, wobei er sich fragte, wie er sie zur Rede stellen konnte.
Rebecca drehte sich zu ihm um: »Sie müssen mir versprechen, nie für diese Leute zu arbeiten«, forderte sie.
Er war überrumpelt. »Ich? Das wäre verrückt. Für welche Leute?« Er war sich seiner Verkleidung nur allzu bewusst.
Kurz vor der Ecke Sixth Street blieb Rebecca stehen. Indem sie ihn forschend musterte, fragte sie: »Schwören Sie, tatsächlich Walter Wer-auch-immer zu sein, Studierender der Elektrotechnik an der Columbia?«
Bix starrte sie mit pochendem Herzen an.
»Scheiße«, sagte Rebecca.
Sie bog rechts in die East Sixth ab. Bix versuchte, Schritt zu halten. Er musste das klarstellen. »Schauen Sie«, sagte er halblaut, »es stimmt. Ich bin … tatsächlich derjenige, nach dem ich aussehe.«
»Bix Bouton?«, rief sie aufgebracht. »Wollen Sie mich verarschen? Sie haben Dreadlocks, verdammt.« Sie beschleunigte, als wollte sie ihm entkommen, ohne rennen zu müssen.
»Doch, ich bin’s«, wiederholte Bix leise, aber beharrlich, obwohl ihm, nach Mitternacht im East Village einer bildhübschen Fremden hinterherlaufend, Zweifel kamen. War er Bix Bouton? War er diese Person jemals gewesen?
»Ich habe damit angefangen«, sagte Rebecca. »Falls Sie das vergessen haben.«
»Sie haben eine Ähnlichkeit bemerkt.«
»Jetzt klingen Sie wie der typische Hochstapler.« Sie lächelte, aber Bix witterte ihre Furcht. Eine brenzlige Situation. Zu seiner Erleichterung verlangsamte sie ihre Schritte und musterte ihn im gelblichen Schein der Straßenbeleuchtung. Sie waren fast bis zur Avenue C gelangt. »Außerdem sehen Sie ihm gar nicht so ähnlich«, erklärte sie schließlich. »Sie haben ein ganz anderes Gesicht.«
»Ja, weil ich lächele. Er lächelt nie.«
»Sie sprechen in der dritten Person von ihm.«
»Mist.«
Sie lachte verächtlich auf. »Bix flucht nicht, das weiß alle Welt.«
»Verdammte Kacke«, hörte Bix sich rufen, aber Sekunden später kehrte sein Argwohn zurück. »So nicht«, sagte er, und ein Unterton veranlasste Rebecca, stehen zu bleiben und zuzuhören. »Sie sind es, die wie aus dem Nichts gekommen ist. Ich glaube, Sie verfolgen mich, seit wir bei Ted und Portia waren. Wie soll ich wissen, dass Sie das Angebot der Homeland Security tatsächlich abgelehnt haben?«
Sie entließ ein erzürntes Lachen. »Sie sind ja geradezu paranoid«, sagte sie, aber das ängstliche Beben ihrer Stimme spiegelte seine Furcht. »Ich habe meine Masterarbeit über Nella Larsen geschrieben«, sagte sie. »Sie können mich alles über sie fragen.«
»Nie von ihr gehört.«
Sie beäugten einander misstrauisch. Das gespenstische Gefühl, das Bix erfasste, erinnerte ihn an den üblen Trip, den er als Teenager nach dem Konsum von Pilzen gehabt hatte. Damals waren er und seine Freunde nach einem Uptones-Konzert in ihrer Angst vorübergehend auseinandergestoben. Er holte dreimal tief Luft, eine Grundtechnik seiner Konzentrationspraxis, und spürte, wie sich die Welt ringsumher stabilisierte. Was auch immer Rebecca sein mochte, sie war noch ein Kind. Er war mindestens fünfzehn Jahre älter als sie.
»Wissen Sie was?«, sagte er, in respektvollem Abstand verharrend. »Ich denke, keiner von uns beiden ist gefährlich.«
Sie schluckte, sah zu ihm auf. »Da stimme ich Ihnen zu.«
»Ich glaube Ihnen, dass Sie Rebecca Amari sind, Studierende an der Columbia mit einem Master in Soziologie.«
»Und ich glaube Ihnen, dass Sie Walter Wer-auch-immer sind, Studierender an der Columbia mit einem Master in Elektrotechnik.«
»Prima«, sagte er. »Damit haben wir einen Vertrag.«
4
Wie sich herausstellte, hatte Rebecca einen Bogen um ihr Ziel geschlagen, eine Bar in der Avenue B, die sie aufsuchte, nachdem sie zu ihrer brüchigen Übereinkunft gelangt waren. Bix lehnte das Angebot ab, sie zu begleiten. Er wollte über ihren Disput nachdenken und den Schaden taxieren. Konnte er weiter an der Diskussionsrunde teilnehmen? Würde Rebecca noch mal dort auftauchen?
Er war mehrere Blocks über das Apartment in der East Seventh Street hinaus und nicht mehr weit von der Überführung der Sixth Street entfernt, die zum East River Park führte. Er erklomm die Stufen und überquerte den FDR, um dann festzustellen, dass sich der Park seit seinem letzten Besuch verändert hatte: kunstvoll gestutzte Büsche, eine malerische, kleine Brücke und joggende Menschen, sogar zu dieser späten Stunde.
Er ging zum Geländer und sah zu, wie die bunten Lichter der Stadt auf dem Fluss tanzten. Hier hatte er seine nächtlichen Runden oft beschlossen, zu einer Stunde, wenn das Licht des Sonnenaufgangs über das ölige Wasser bis in seine Augen schlitterte. Wie konnte man nur auf die Idee kommen, hier zu baden? Diese Frage rief ihm in Erinnerung, dass er an dem Morgen, als Rob ertrunken war, mit diesem und Drew genau an dieser Stelle gestanden hatte. »Guten Morgen, Gentlemen«, hatte er gesagt, wie ihm plötzlich einfiel, einen Arm um beide legend. Er sah Rob wieder vor sich: ein stämmiger, athletischer weißer Junge mit altklugem Grinsen und gequältem, ausweichendem Blick. Wo hatte sich diese Erinnerung all die Jahre verborgen gehalten? Und wo war der Rest, die Stimmen von Rob und Drew, all das, was sie an jenem letzten Morgen von Robs Leben gesagt und getan hatten? Hatte Bix, als er sich verabschiedet hatte, einen Hinweis auf das überhört, was sich zutragen sollte? Sein rätselhaftes Unterbewusstes kam ihm vor wie ein Wal, der unter einem winzigen Schwimmenden im Wasser hing. Wenn er seine Vergangenheit weder wiederfinden noch bergen noch betrachten konnte, dann gehörte sie ihm nicht. Dann wäre sie für immer verloren.
Er schnellte in die Senkrechte, als hätte ihn jemand gerufen. In seinen Gedanken schien sich eine Verknüpfung anzubahnen. Er ließ den Blick flussaufwärts und flussabwärts schweifen. Zwei weiße Frauen, die auf ihn zu joggten, schienen abzuschwenken, als er sich umdrehte. Oder hatte er sich das eingebildet? Er ließ den Moment noch einmal Revue passieren – ein altes, verstörendes Rätsel, jeden frischen Gedanken trübend, der sich bildete. Er war plötzlich so fix und fertig, als wäre er tagelang auf den Beinen gewesen – als hätte er sich so weit von seinem Leben entfernt, dass er nicht mehr dorthin zurückkehren konnte.
Er rief Lizzie per Kurzwahl an, um ihr wieder nahe zu sein, beendete den Anruf jedoch vor dem ersten Klingelton. Sie schlief bestimmt, Gregory an der Brust, das Handy, das an der Steckdose hing, außer Reichweite. Sie würde aus dem Bett springen und erschrocken dorthin hasten. Und wie erklären, warum er sich zu nachtschlafener Zeit an diesem bizarren Ort befand?
Seine Eltern? Sie würden glauben, jemand wäre gestorben.
Bix wählte die Nummer seiner Schwiegermutter. Er hatte sie fast noch nie von sich aus angerufen und bezweifelte, dass sie ranging. Im Grunde wollte er gar nicht, dass sie abnahm.
»Beresford«, erklang ihre Stimme.
»Joan.«
Sie redete jeden mit »Darling« an und wurde von allen »Joanie« genannt. Wenn sie mit Bix telefonierte, benutzte sie jedoch stets seinen vollen Vornamen, und er hielt es umgekehrt genauso.
»Alle wohlauf?«, fragte sie in ihrem lakonischen, schleppenden Tonfall.
»Oh, ja. Alle wohlauf.«
Ein kurzes Schweigen. »Und selbst?«
»Mir … geht’s auch gut.«
»Sei kein Schisser«, sagte Joan, und trotz des Rasenmäherdröhnens konnte er hören, wie sie eine Zigarette anzündete. In San Antonio schien man den Rasen sogar im Dunkeln zu mähen. »Was bedrückt dich?«, fragte sie, Rauch auspustend.
»Ach, nichts«, antwortete er. »Ich frage mich nur … was als Nächstes ansteht.«
»Tun wir das nicht alle.«
»Ich sollte es wissen«, sagte er. »Das ist mein Job.«
»Eine große Frage.«
Er betrachtete die auf dem Wasserspiegel wabernden, flüchtigen Farben. Joans Zigarette knisterte, als sie einen tiefen Zug tat.
»Du klingst besorgt«, sagte sie mit rauchiger Stimme. »Das ist ein besorgtes Schweigen.«
»Ich fürchte, ich schaffe das kein zweites Mal.«
Bix hatte dies, ob so oder anders formuliert, noch nie geäußert, niemandem gegenüber. Im Schweigen, das folgte, bereute er seine Beichte sogleich.
»Blödsinn«, sagte Joan, und er meinte spüren zu können, wie der warme Zigarettenqualm gegen seine Wange brandete. »Du kannst es schaffen, und du wirst es schaffen. Jede Wette, dass du näher dran bist, als du glaubst.«
Ihre Worte, wie nebenbei geäußert, verschafften ihm eine rätselhafte Erleichterung. Was vielleicht daran lag, dass sie in Gesprächen mit ihm immer seinen Taufnamen benutzte, den er selten hörte, vielleicht auch daran, dass es nicht ihre Art war, andere aufzubauen. Vielleicht hätte er die Worte Du kannst und du wirst in diesem Augenblick jedem abgekauft.
»Ich gebe dir jetzt einen guten Rat, Beresford«, sagte Joan. »Und er entspringt der Liebe, die ich im Herzen trage. Bist du bereit?«
Er schloss die Augen und spürte den Wind auf den Lidern. Winzige Wellen leckten unter seinen Füßen an der Brüstung. Es roch nach Ozean: Vögel, Salz, Fisch, und unter alles mischte sich unpassenderweise Joans pfeifender Atem.
»Bereit«, sagte er.
»Ab ins Bett. Und gib meiner verrückten Tochter einen Kuss von mir.«
Das tat er.
Fallstudie: Niemand kam zu Schaden
1
Niemand, das gilt auch für Alfred Hollander persönlich, weiß genau, wann er zum ersten Mal aggressiv – er selbst nennt es »allergisch« – auf das Artifizielle des Fernsehens reagierte. Es begann mit den Nachrichten: das künstliche Lächeln. Diese Frisuren! Waren diese Leute etwa Roboter? Waren sie Bobbleheads? Waren sie zum Leben erweckte Puppen wie jene, die er von Horrorfilmplakaten kannte? Im Beisein Alfreds konnte man keine Nachrichten mehr gucken. Es wurde schwierig, mit ihm gemeinsam Cheers zu schauen. Nach einer Weile zog man es vor, gar nichts mehr mit Alfred zu schauen, der, auf der Couch sitzend, unversehens – und immer noch leicht lispelnd – brüllte: »Wie viel bezahlt man der Frau?« Oder: »Will der Typ uns verarschen?« Das verdarb nur die Laune.
Es genügte nicht, den Fernseher auszuschalten; Alfred war neun, als seine Unduldsamkeit gegenüber allem Künstlichen die Barriere zwischen Leben und Kunst übersprang und Einzug in den Alltag hielt. Er hatte hinter den Vorhang gelugt und gemerkt, auf welche Weise Menschen sich selbst mimten oder – noch raffinierter – Rollen spielten, die sie dem Fernsehen abgeschaut hatten: Gestresste Mutter. Verzagter Vater. Strenge Lehrerin. Motivierender Trainer. Alfred wollte – und konnte – diese Anverwandlungen nicht dulden. »Lass das Getue, dann antworte ich«, teilte er seinem verdutzten Gesprächspartner mit, oder unverblümter: »Das ist doch aufgesetzt.« Hund und Katze der Familie, Theo und Vincent, verlebten ihre Tage, ohne sich zu verstellen. Ebenso die Eichhörnchen, das Rotwild, die Taschenratten und Fische, die die seenreiche Region nördlich von New York bevölkerten, wo Alfred aufwuchs und wo sein Vater, Ted Hollander, an einem lokalen College Kunstgeschichte unterrichtete. Warum taten Leute so, als wären sie eine Person, die sie ohnehin waren?
Das Problem lag auf der Hand: Alfred war schwierig – oder »ein beschissener Albtraum«, um diverse Zeugen zu zitieren. Und es gab ein dramatischeres Problem: Er vergiftete sein Umfeld. Wenn man uns fälschlicherweise bezichtigt, für, sagen wir mal, die Homeland Security zu spionieren oder eine Berühmtheit zu stalken, die wir gar nicht kennen, reagieren wir mit Schuldgefühlen, Angst und dem Bemühen, unsere Unschuld zu beteuern. Anders gesagt: Wir verhalten uns exakt so, wie sich Schnüffler der Homeland Security oder verkappte Stalker verhalten würden. Erwachsene, von Alfred angeblafft, »nicht mit künstlicher Stimme zu sprechen«, versuchten daraufhin, sich natürlicher zu geben, was jedoch das genaue Gegenteil bewirkte: Eltern mimten Eltern; Lehrerinnen mimten Lehrerinnen; Baseballtrainer mimten Baseballtrainer. Und sie sahen zu, sich so rasch wie möglich zu verkrümeln.
Das Familienleben war das Epizentrum von Alfreds Missfallen. Beim Abendessen fühlte er sich »erstickt« durch die stille Dominanz von Miles, dem ältesten Bruder, der organisiert und begabt war, und durch die geübte Unauffälligkeit von Ames, dem mittleren Bruder, der unsichtbar kam und ging und seine wahren Gedanken verbarg. Wenn sich seine Eltern unbefangen nach dem Schultag erkundigten, kläffte Alfred oft: »Darüber kann ich unmöglich reden«, womit er seine Mutter, Susan, der das Beisammensein der Familie wichtig war, jedes Mal vor den Kopf stieß.
Mit elf begann Alfred, bei Urlauben mit der erweiterten Familie eine braune Papiertüte mit Löchern für die Augen über seinen Kopf zu stülpen. Er behielt die Tüte während des ganzen Essens auf und zwängte Truthahn oder Pecan Pie mit der Gabel durch den rechteckigen Mundschlitz. Er wollte die Anwesenden extrem irritieren, um sie zu einer aufrichtigen – allerdings negativen – Reaktion zu provozieren.
»Was macht Alfred denn da?«, fragte ein Großelternteil.
»Ich trage eine Tüte über dem Kopf«, antwortete Alfred dann unter der Tüte.
»Hat er ein Problem mit seinem Aussehen?«
»Ich bin hier, Oma, du kannst mich fragen.«
»Aber ich kann ihn nicht sehen …«
Gewisse, wenn auch dünn gesäte Individuen besitzen die Gabe, für eine Atmosphäre der Natürlichkeit zu sorgen, und nur diesen galt Alfreds Wertschätzung. An erster Stelle stand Jack Stevens, der beste Freund seines Bruders Miles. »Setz die Tüte auf, Alf«, bat Jack, erwartungsvoll glucksend, aber die Tüte war überflüssig, wenn er anwesend war – Jack sorgte dafür, dass sich die ganze Familie entspannte. Jack verbrachte viele Abende im Haus der Hollanders, denn seine Mutter war an Krebs gestorben, als er klein gewesen war. Alfred beschreibt Jack als rowdyhaft, spontan und nach Stimuli lechzend, als jemanden, der Bierfässer an »den Strand« mitnahm, eine kleine Sandkuhle in einem ehemaligen Sommercamp, wo die lokale Jugend gern feierte. Jack war bekannt dafür, in den alten Hütten Cheerleaderinnen zu deflorieren, und gebrochene Herzen wurden (wie Alfred glaubte) stets durch Jacks Gutmütigkeit, seine Fröhlichkeit und den gelegentlichen Kummer des mutterlosen Kindes geheilt, der (auch das glaubte Alfred) sichtbar wurde, wenn Jack auf den See starrte, ein tiefes und eisiges, von Gletschern gebildetes Gewässer, im Herbst von Tausenden Kanadagänsen bevölkert.
Miles und Jack Stevens blieben auf dem College enge Freunde, aber dann kam es zu einem abrupten Bruch. Und da sein Bruder und sein Idol nicht mehr miteinander sprachen, verlor Alfred den Kontakt zu diesem Fixpunkt seiner Kindheit.
Als Student an der SUNY New Paltz baute Alfred einen kleinen Freundeskreis auf, der seine Verachtung für den »Schwachsinn« teilte, der sie umgab. Nachdem er 2004 seinen Abschluss gemacht hatte, empfand er die »Pseudoreife« dieser Freunde jedoch als desillusionierend. Sie taten nach dem Jura-Examen so, als wären sie Anwälte oder im Marketing, in Maschinenbauunternehmen oder jenen Internetfirmen tätig, die nach dem Platzen der Dotcom-Blase gerade wieder Fuß fassten. Hatte ein College-Freund abgenommen, seine Nase korrigieren lassen oder trug farbige Kontaktlinsen, dann kommentierte Alfred diese »Kostümierungen« mit Fragen wie: »Bist du ein Fettklops, der ausnahmsweise schlank ist?« Oder: »Fragst du dich jemals, ob du die richtige Nase ausgesucht hast?« Oder: »Sieht meine Haut durch deine Kontaktlinsen grünlich aus?« Namensänderungen ignorierte er dickfellig. »Anastasia« blieb für ihn die gute, alte Amy, obwohl sie drohte, ihn von der Liste ihrer Hochzeitsgäste zu streichen, falls er sie weiter Amy nenne, was sie nach weiteren Verwarnungen dann auch tat.
Die College-Freunde zerstreuten sich rasant. Alfred war froh, sie los zu sein, fühlte sich aber einsam. Er bewohnte ein Zimmer im Apartment eines alten Ehepaares in der Twenty-eighth Street und sortierte als Gegenleistung ihre Tabletten in Boxen ein, las ihnen E-Mails vor und tippte die diktierten Antworten. Er arbeitete in einer Fahrradwerkstatt und steckte all seine Ersparnisse in eine dreistündige Doku über das Wanderverhalten nordamerikanischer Gänse. Diese, betitelt Das Wanderverhalten nordamerikanischer Gänse, kommentierte er mit einer absolut ungekünstelten Stimme – anders gesagt, vollkommen tonlos. Während der Privatvorstellung in Manhattan, die er finanziert hatte, fielen alle Zuschauer ins Koma. Miles, ein notorisch schlechter Schläfer, musste aus dem Tiefschlaf gerüttelt werden und bat Alfred anschließend um eine DVD der Gänse, die er daheim in Chicago zum Einschlafen einlegen wollte. Alfred, gedemütigt und wütend, verweigerte sie ihm.
2
Ich erfuhr 2010 von der Existenz Alfred Hollanders, ein Jahr nach der Fertigstellung von Das Wanderverhalten nordamerikanischer Gänse. Alfreds Vater, Ted, hatte gemeinsam mit seiner zweiten Frau, Portia (Alfreds Eltern ließen sich in dem Jahr scheiden, als er aufs College kam), zu einer Diskussionsrunde eingeladen, an der ich als Promovendin an der Columbia University teilnahm. Ich bat Alfred per E-Mails mehrmals um ein Interview im Zusammenhang mit meiner Promotion, einer Studie über Authentizität in digitalen Zeiten. Da er nie reagierte, suchte ich die Fahrradwerkstatt auf, in der er tätig war. Er erwies sich als netter Kerl mit erdbeerroten Haaren, in dessen Heiterkeit etwas Feindseliges mitschwang.
»Bei allem gebotenen Respekt, Rebecca Amari«, sagte er in einem Ton, der mir zu unterstellen schien, ich hätte mir den Namen ausgedacht, »warum sollte ich zulassen, dass du meine Ideen für irgendeinen abgehobenen akademischen Scheiß missbrauchst, nur damit du in Amt und Würden kommst?«
Ich erklärte, es gehe mir nicht um Amt und Würden, sondern nur um meine Doktorarbeit, eventuell auch um eine Stelle als Lehrerin, und versicherte, seine Story als seine eigene kenntlich zu machen, zumal ich damit beschäftigt sei, Phänomene, wie er sie beschrieben habe, zu systematisieren und zu kontextualisieren.
»Nichts für ungut, aber dazu brauche ich dich nun wirklich nicht«, entgegnete er.
»Bei allem gebotenen Respekt«, sagte ich, »aber ich denke doch.«
»Und wieso?«
»Weil du außer einem unverdaulichen Film über Gänse noch nichts zustandegebracht hast«, sagte ich. »Nichts für ungut.«
Er legte das Werkzeug ab und sah mich an, den Kopf zur Seite geneigt. »Sind wir uns schon mal begegnet?«, fragte er. »Du kommst mir bekannt vor.«
»Wir haben beide Sommersprossen«, sagte ich und entlockte ihm damit das erste aufrichtige Lächeln. »Vielleicht erinnere ich dich an dich selbst. Außerdem bin ich der einzige andere Mensch auf diesem Planeten, der von Authentizität genauso besessen ist wie du.«
Ein Jahr sollte vergehen, bis ich schließlich von ihm hörte.
Alfreds Vater hatte mir erzählt, sein Sohn habe ein Projekt in Angriff genommen, das noch verstörender und extremer sei als die Tüte-über-der-Rübe-Aktion während seiner Schulzeit. Die Idee kam ihm eines Spätsommermorgens, als er mit seinem Adoptivdackel Maple Tree eine lokale Grundschule aufsuchte. Es war Anmeldungstag, und er teilte den zwei Damen der Schulbehörde mit, er wolle Maple Tree für die Vorschulklasse anmelden. Danach lehnte er sich zurück, um sich an ihrer Verwirrung zu weiden.
»Sie ist echt klug«, sagte er. »Sie lernt bloß auf andere Art.«
»Sie hat keine Sprache, versteht aber alles.«
»Sie sitzt still da und lauscht, vorausgesetzt, Sie werfen ihr alle paar Minuten ein Leckerli hin.«
Die Damen, deren abgerundete Fingernägel mit Malereien verziert waren, die in dieser nuancierten Form höchstens bei Surfbrettern von museumsreifer Qualität zu finden waren, konnten ihr Lachen kaum unterdrücken. »Sie wollen Ihren Hund für die Vorschulklasse anmelden«, wiederholte eine der beiden mit zuckenden Mundwinkeln.
»Und was, wenn andere Kinder auch ein Haustier mitbringen wollen?«, erkundigte sich die andere.
»Ist sie stubenrein? Sie kann ja nicht auf den Fußboden machen …«
»Kennt sie die Buchstaben und Zahlen?«