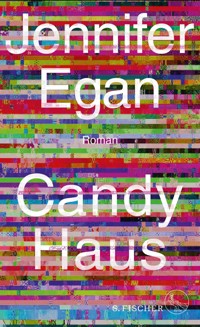9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tauchen Sie ein in das vibrierende New York der 30er und 40er Jahre, folgen Sie einer unvergesslichen Heldin in eine Zeit, in der alles auf dem Spiel steht. New York – von der Marinewerft in Brooklyn zu den schillernden Nachtclubs in Manhattan, von den Villen auf Long Island zu den Absteigen in der Bronx. 1942 sind die Männer an der Front, die Frauen stehen in der Fabrik. Aber Anna möchte ein besseres Leben. Seitdem der Vater verschwunden ist, sorgt sie für ihre Mutter und die pflegebedürftige Schwester. Während Anna den Vater nicht vergessen kann, verfolgt sie bestimmt ihren großen Traum: Unter die gigantischen Kriegsschiffe an den Docks möchte sie tauchen, um sie zu reparieren. Ein Beruf zu gefährlich für eine Frau – genauso wie die New Yorker Unterwelt, in der sich die Spur ihres Vaters verlor. Der Pulitzer-Preisträgerin und New York Times-Bestsellerautorin Jennifer Egan ist ein Meisterwerk mit erzählerischem Sog, mitreißender Atmosphäre und unvergesslichen Figuren gelungen – ein großes Zeitpanorama!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Jennifer Egan
Manhattan Beach
Roman
Über dieses Buch
New York – von der Marinewerft in Brooklyn zu den schillernden Nachtclubs in Manhattan, von den Villen auf Long Island zu den Absteigen in der Bronx. 1942 sind die Männer an der Front, die Frauen stehen in der Fabrik. Aber Anna möchte ein besseres Leben. Seitdem der Vater verschwunden ist, sorgt sie für ihre Mutter und die behinderte Schwester. Während Anna den Vater nicht vergessen kann, verfolgt sie furchtlos ihren großen Traum: Unter die gigantischen Kriegsschiffe an den Docks möchte sie tauchen, um sie zu reparieren. Ein Beruf zu gefährlich für eine Frau – genauso wie die New Yorker Unterwelt, in der sich die Spur ihres Vaters verlor.
Jennifer Egan ist ein Meisterwerk mit erzählerischem Sog, mitreißender Atmosphäre und unvergesslichen Figuren gelungen – ein großes Zeitpanorama!
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jennifer Egan wurde 1962 in Chicago geboren und wuchs in San Francisco auf. Sie lebt heute mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Brooklyn, New York. Neben ihren Romanen und Kurzgeschichten schreibt sie für den New Yorker sowie das New York Times Magazine und lehrt an der Columbia University Creative Writing. Für ihren Roman »Der größere Teil der Welt« erhielt sie 2011 den Pulitzer Prize, den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize. Ihr aktueller Roman »Manhattan Beach« erstürmte gleich bei Erscheinen die New York Times-Bestsellerliste und erhielt hymnische Presse.
Henning Ahrens lebt als Schriftsteller und Übersetzer in Frankfurt am Main. Er veröffentlichte die Lyrikbände ›Stoppelbrand‹, ›Lieblied was kommt‹ und ›Kein Schlaf in Sicht‹ sowie die Romane ›Lauf Jäger lauf‹, ›Langsamer Walzer‹ und ›Tiertage‹. Für S. Fischer übersetzte er Romane von Richard Powers, Kevin Powers, Khaled Hosseini. Zuletzt erschien ›Glantz und Gloria. Ein Trip‹, 2015, der mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet wurde.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel ›Manhattan Beach‹ bei Scribner, an imprint of Simon & Schuster, New York.
© 2017 Jennifer Egan
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490661-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Das Ufer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Schattenwelt
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Die See sehen
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Das Dunkel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Die Reise
18. Kapitel
Fünf Wochen zuvor
19. Kapitel
Der Tauchgang
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Die See, die See
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Der Nebel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Dank
Für Christina, Matthew und Alexandra Egan
und für Robert Egan – unseren Onkel Bob
»Ja, wie jeder weiß, sind Besinnlichkeit und Wasser auf ewig vermählt.«
Herman Melville, Moby Dick
Das Ufer
1
Anna merkte erst, wie nervös ihr Vater war, als sie das Haus von Mr Styles erreichten. Anfangs war sie durch die Fahrt abgelenkt worden, das Dahingleiten auf dem Ocean Parkway, als wären sie nach Coney Island unterwegs, obwohl es vier Tage nach Weihnachten und viel zu kalt für den Strand war. Anschließend das Haus: Ein zweistöckiger Palast aus goldgelbem Backstein mit Fenstern auf allen Seiten und wild flatternden, gelb-grün gestreiften Markisen. Es war das letzte Haus in der Sackgasse, die vor dem Meer endete.
Ihr Vater hielt an der Bordsteinkante und schaltete den Motor des Ford, Model J, aus. »Goldstück«, sagte er, »starr das Haus von Mr Styles nicht so an.«
»Ich starre sein Haus nicht an.«
»Doch, tust du.«
»Nein«, erwiderte sie. »Ich schaue nur sehr genau hin.«
»Genau das ist Anstarren«, sagte er.
»Nein, ist es nicht.«
Er fuhr zu ihr herum. »Starr nicht.«
Da begriff sie. Sie hörte ihn rau schlucken und spürte, wie sich in ihrem Bauch eine leise Sorge regte. Sie erlebte ihren Vater selten nervös. Zerstreut, das schon. Geistesabwesend, sicher.
»Warum mag Mr Styles nicht angestarrt werden?«, fragte sie.
»Das mag niemand.«
»Das hast du mir noch nie gesagt.«
»Möchtest du nach Hause?«
»Nein, lieber nicht.«
»Ich kann dich heimfahren.«
»Wenn ich weiter heimlich hinschaue?«
»Wenn du dafür sorgst, dass die Kopfschmerzen, die ich jetzt schon habe, noch schlimmer werden.«
»Wenn du mich jetzt heimfährst«, sagte Anna, »wärst du schrecklich spät dran.«
Sie hatte Angst vor einer Ohrfeige. Ihr Vater hatte sie einmal geschlagen. Damals hatte sie ein Sturzbach von Flüchen entlassen, die sie im Hafen aufgeschnappt hatte, und seine Hand hatte ihre Wange so unvermittelt getroffen wie einen Peitschenhieb. Dieser Schlag, der ihr bis heute in den Knochen saß, hatte allerdings die unerwartete Folge gehabt, dass sie wie aus Trotz mutiger geworden war.
Ihr Vater rieb sich die Stirn, sah dann auf. Seine Nervosität war verflogen; sie hatte ihn beruhigt.
»Anna«, sagte er. »Du weißt, was ich hier tun muss.«
»O ja.«
»Ich muss mit Mr Styles reden, und du musst währenddessen sehr nett zu seinen Kindern sein.«
»Ich weiß, Papa.«
»Ja, sicher, das weißt du.«
Die Sonne trieb ihr Tränen in die weit geöffneten Augen, als sie aus dem Ford stieg. Bis zum Börsenkrach war das Auto ihr Eigentum gewesen. Nun gehörte es der Gewerkschaft, die es ihrem Vater lieh, wenn er in ihren Diensten unterwegs war. Anna begleitete ihn gern, wenn sie keine Schule hatte – zu Rennbahnen, Kommunionsfrühstücken, Kirchenveranstaltungen und Bürogebäuden, in denen sie im Fahrstuhl ganz nach oben fuhren, manchmal sogar in Restaurants. Aber in einem Privathaus war sie noch nie gewesen.
Nach dem Klingeln öffnete Mrs Styles, eine Frau mit den modellierten Augenbrauen eines Filmstars und leuchtend rot geschminkten, vollen Lippen. Der Glamour von Mrs Styles überrumpelte Anna, die ihre Mutter für die schönste aller Frauen hielt.
»Ich hatte gehofft, Mrs Kerrigan begrüßen zu dürfen«, sagte Mrs Styles mit rauchiger Stimme und umschloss die Hand von Annas Vater mit beiden Händen. Worauf er erwiderte, seine jüngere Tochter sei erkrankt, und seine Frau müsse sie zu Hause pflegen.
Mr Styles war nicht in Sicht.
Anna nahm höflich, aber (wie sie hoffte) unbeeindruckt ein Glas Limonade von einem Tablett entgegen, das eine farbige Dienerin in hellblauer Uniform brachte. Sie sah sich im roten, von ihrer Mutter genähten Kleid im blitzblanken Holzfußboden der Eingangshalle gespiegelt. Durch die Fenster eines angrenzenden Zimmers war das im Schein der fahlen Wintersonne glitzernde Meer zu sehen.
Mr Styles’ Tochter Tabatha war erst acht – drei Jahre jünger als Anna. Trotzdem ließ sich Anna von ihr bei der Hand in ein »Kinderzimmer« im Souterrain führen, das nur zum Spielen gedacht war und Berge von Spielzeug beherbergte. Anna entdeckte sofort eine Flossie-Flirt-Puppe, mehrere große Teddybären und ein Schaukelpferd. In diesem Kinderzimmer gab es sogar eine »Kinderfrau«, eine sommersprossige Person mit rauer Stimme, deren gewaltiger Busen das Wollkleid zu sprengen drohte. Breites Gesicht und fröhliches Augenzwinkern legten nahe, dass sie Irin war, und Anna witterte das Risiko, durchschaut zu werden. Sie beschloss, Distanz zu wahren.
Zwei kleine Jungs – vielleicht Zwillinge, auf jeden Fall zum Verwechseln ähnlich – kämpften mit den Gleisteilen einer Elektroeisenbahn. Anna hockte sich neben die losen Gleise, nicht zuletzt, um der Kinderfrau aus dem Weg zu gehen, die sich geweigert hatte, den beiden zu helfen. Sie spürte die Logik der Mechanik in den Fingerspitzen; es ging so leicht, dass sie dachte: Wer das nicht schafft, hat es nie wirklich probiert. Die Leute sahen immer hin, was beim Zusammenbauen genauso sinnlos war wie der umgekehrte Versuch, ein Gemälde durch Betasten zu verstehen. Anna befestigte das Gleisteil, das den Jungs Probleme bereitet hatte, und holte weitere aus der frisch geöffneten Schachtel. Es war eine Eisenbahn der Firma Lionel, und sie spürte die Qualität der Gleise an der Entschiedenheit, mit der sie sich verbanden. Beim Arbeiten linste Anna hin und wieder zur Flossie-Flirt-Puppe, die ganz hinten in ein Regal gequetscht worden war. Vor zwei Jahren hatte sie sich eine solche Puppe so inbrünstig gewünscht, dass ihre Verzweiflung immer noch nachhallte. Sie empfand es als schmerzhaft und verstörend, dass ihre alte Sehnsucht ausgerechnet hier neu erwachte.
Tabatha hatte ihr Weihnachtsgeschenk im Arm, eine Shirley-Temple-Puppe, die sie in einen Fuchspelzmantel gehüllt hatte. Sie sah wie gebannt zu, während Anna die Gleise ihrer Brüder zusammensetzte. »Wo wohnst du?«, fragte sie.
»Nicht weit weg.«
»Am Strand?«
»In der Nähe.«
»Darf ich dich zu Hause besuchen?«
»Klar«, sagte Anna, die die Gleise so rasch zusammensetzte, wie sie ihr von den Jungs gereicht wurden. Die Acht war fast fertig.
»Hast du Brüder?«, fragte Tabatha.
»Eine Schwester«, antwortete Anna. »Sie ist so alt wie du, also acht, aber sie ist gemein. Weil sie so hübsch ist.«
Tabatha wirkte alarmiert. »Wie hübsch?«
»Bildhübsch«, erwiderte Anna ernst und fügte hinzu: »Sie sieht aus wie unsere Mutter, und die hat bei den Follies getanzt.« Sekunden später begriff sie, dass diese Prahlerei ein Fehler gewesen war. Gib Tatsachen nur dann preis, wenn du keine andere Wahl hast. Sie hatte die Stimme ihres Vaters im Ohr.
Das Mittagessen wurde von der farbigen Dienerin an einem Tisch im Spielzimmer serviert. Alle saßen wie Erwachsene auf Stühlchen, Stoffservietten im Schoß. Anna schaute mehrmals verstohlen zur Flossie-Flirt-Puppe und zerbrach sich den Kopf über eine Ausrede, die es ihr erlaubte, diese zu halten, ohne ihr Interesse zu verraten. Sie wollte die Puppe nur einmal im Arm haben, dann wäre sie schon zufrieden.
Weil sie brav gewesen waren, erlaubte ihnen die Kinderfrau nach dem Essen, sich in Mantel und Mütze zu hüllen und durch eine Hintertür auf den Weg zu stürmen, der auf der Rückseite des Hauses von Mr Styles zu einem Privatstrand führte. Der Sand senkte sich in einem langen, schneebestäubten Bogen zum Meer ab. Anna war im Winter schon oft an den Hafenanlagen gewesen, aber nie am Strand. Winzige Wellen pulsierten unter einer dünnen Eisschicht, die mit einem Knacken zerbrach, wenn sie darauf trat. Möwen mit weißen Bäuchen kreischten im stürmischen Wind und gingen in den Sturzflug. Die Jungs hatten ihre Buck-Rogers-Strahlenpistolen mitgenommen, aber der böige Wind verwandelte ihre Schüsse und Todeskämpfe in eine Pantomime.
Der Anblick des Meeres löste in Anna jedes Mal ein ganz bestimmtes Gefühl aus: eine elektrisierende Mischung aus Furcht und Verlockung. Was wäre zu sehen, wenn die Wassermassen plötzlich verschwänden? Eine Landschaft der verlorenen Dinge: gesunkene Schiffe, verborgene Schätze, Gold und Edelsteine, das Bettelarmband, das von ihrem Handgelenk gerutscht und in einen Gully gefallen war. Leichen, fügte ihr Vater stets lachend hinzu. Für ihn war das Meer eine Einöde.
Anna sah die neben ihr stehende, zitternde Tabby an (wie Tabatha auch genannt wurde). Sie hätte ihre Gefühle gern formuliert. Fremden gegenüber fiel es ihr leichter, sich zu öffnen. Stattdessen wiederholte sie, was ihr Vater beim Anblick eines leeren Horizonts immer sagte: »Kein Schiff in Sicht.«
Die Jungen rannten mit ihren Spielpistolen über den Sand zur Brandung, verfolgt von der keuchenden Kinderfrau. »Bleibt mir ja vom Wasser weg, Phillip und John-Martin«, krächzte sie verblüffend laut. »Habt ihr verstanden?« Sie warf Anna, die beide dorthin gelockt hatte, einen strengen Blick zu und trieb die Zwillinge zum Haus.
»Deine Schuhe werden nass«, sagte Tabby mit klappernden Zähnen.
»Sollen wir sie ausziehen?«, fragte Anna. »Um die Kälte zu spüren?«
»Ich will sie gar nicht spüren!«
»Ich schon.«
Tabby sah zu, wie Anna die Schnallen ihrer Kunstlederschuhe löste, die sie sich mit Zara Klein teilte, die unten im Haus wohnte. Sie zog die Wollstrümpfe aus und stellte die weißen und knochigen, für ihr Alter recht großen Füße in das eisige Wasser. Jeder Fuß schickte einen Strauß qualvoller Gefühle bis zu ihrem Herzen, das vor Schmerz aufloderte. Ein überraschend schönes Gefühl, wie Anna fand.
»Und? Wie ist es?«, fragte Tabby.
»Kalt«, antwortete Anna. »Eisig, eisig kalt.« Sie musste sich mächtig zusammenreißen, um ihr Erschaudern zu verbergen, ein Widerstand, der die seltsame Erregung noch weiter steigerte. Als sie einen Blick zum Haus warf, sah sie zwei Männer in dunklen Mänteln auf dem gepflasterten Weg weiter oben am Strand. Es war so stürmisch, dass sich beide den Hut auf den Kopf drückten wie Schauspieler in einem Stummfilm. »Sind das unsere Papas?«
»Daddy bespricht Geschäftliches gern draußen«, sagte Tabby. »Fern von neugierigen Ohren.«
Anna empfand ein wohlwollendes Mitgefühl für die kleine Tabatha, die von den Geschäften ihres Vaters ausgeschlossen war, während sie selbst nach Belieben zuhören durfte. Sie erfuhr wenig Interessantes. Der Job ihres Vaters bestand darin, Grüße oder gute Wünsche von einem Gewerkschafter an einen anderen, teils auch an befreundete Außenstehende, zu übermitteln. Diese Grüße gingen stets mit einem Umschlag, manchmal auch mit einem Päckchen einher, das ihr Vater wie nebenbei übergab oder in Empfang nahm – wenn man nicht genau hinsah, bemerkte man es gar nicht. Im Laufe der Jahre hatte er Anna viel erzählt, ohne zu ahnen, dass er etwas erzählte, und sie hatte viel mitbekommen, ohne zu merken, dass sie etwas mitbekam.
Sie war überrascht, dass ihr Vater so vertraut und lebhaft mit Mr Styles sprach. Sie waren offenbar Freunde. Trotz allem.
Die Männer schlugen eine andere Richtung ein und schritten durch den Sand auf Anna und Tabby zu. Anna trat aus dem Wasser, konnte die Schuhe aber nicht mehr rechtzeitig anziehen, weil sie zu weit weg standen. Mr Styles war ein imposanter Mann, der Brillantine im Haar hatte, wie unter der Hutkrempe zu erkennen war. »Ist das Ihre Tochter?«, fragte er. »Ein Mädchen, das bei diesen arktischen Temperaturen nicht mal Strümpfe braucht?«
Anna spürte das Missfallen ihres Vaters. »So ist es«, sagte er. »Gib Mr Styles die Hand, Anna.«
»Freut mich sehr, Sie kennenzulernen«, sagte sie, drückte die Hand so kräftig, wie sie es von ihrem Vater gelernt hatte, und bemühte sich, die Augen nicht zusammenzukneifen, als sie zu ihm aufsah. Mr Styles wirkte jünger als ihr Vater, sein Gesicht hatte weder Falten noch Schatten. Er strahlte etwas Hellwaches aus, eine summende Energie, die sogar durch seinen im Wind flatternden Mantel spürbar war. Er schien auf etwas zu warten, das ihn zu einer Reaktion veranlasste oder amüsierte. Nun war Anna dieses Etwas.
Mr Styles hockte sich neben sie in den Sand und sah ihr in die Augen. »Warum die nackten Füße?«, fragte er. »Frierst du nicht oder willst du angeben?«
Anna blieb stumm. Beides war falsch; eher wollte sie Tabby beeindrucken und vor ein Rätsel stellen. Aber auch dafür fehlten ihr die Worte. »Warum sollte ich angeben?«, erwiderte sie. »Ich bin fast zwölf.«
»Und wie fühlt es sich an?« Sie konnte sogar bei diesem Wind Pfefferminz und Alkohol in seinem Atem riechen. Dann wurde ihr bewusst, dass ihr Vater ihr Gespräch nicht hören konnte.
»Tut nur am Anfang weh«, antwortete sie. »Nach einer Weile spürt man nichts mehr.«
Mr Styles grinste, als wäre ihre Antwort ein Ball, den er mit Vergnügen auffing. »Worte fürs Leben«, sagte er und richtete sich wieder zu seiner gigantischen Größe auf. »Sie ist stark«, bemerkte er zu Annas Vater.
»Ja, ist sie.« Ihr Vater wich ihrem Blick aus.
Mr Styles fegte Sand von seiner Hose und wandte sich zum Gehen. Er hatte den Moment ausgekostet und wartete auf den nächsten. »Sie sind stärker als wir«, hörte sie ihn zu ihrem Vater sagen. »Ein Glück für uns, dass sie das nicht ahnen.« Anna glaubte, er würde sich noch einmal nach ihr umdrehen, aber er schien sie bereits vergessen zu haben.
Dexter Styles spürte, wie Sand in seine Oxford-Schuhe drang, als er zum Weg zurückstapfte. Die Zähigkeit, die er in Ed Kerrigan gespürt hatte, war in dessen dunkeläugiger Tochter zur vollen Entfaltung gelangt. Ein Beweis für das, was er seit langem glaubte: Ein Mann verrät sich durch seine Kinder. Aus diesem Grund machte Dexter selten Geschäfte mit jemandem, ohne zuvor dessen Familie kennengelernt zu haben. Er wünschte sich, seine Tabby wäre auch barfuß gelaufen.
Kerrigan fuhr einen niagarablauen Duesenberg, Modell J, Baujahr 1928, der sowohl von einem ausgezeichneten Geschmack als auch von den rosigen Aussichten zeugte, die er vor dem Börsenkrach gehabt hatte. Außerdem hatte er einen exzellenten Schneider. Gleichzeitig strahlte der Mann aber etwas Rätselhaftes aus, das nicht zu seiner Kleidung, seinem Auto und seiner schlichten, aber wortgewandten Konversation passen wollte. Da war ein Schatten, eine Sorge. Andererseits: Wer hatte keine? Oder mehrere?
Beim Erreichen des Pfades wurde Dexter klar, dass er beschlossen hatte, Kerrigan einzustellen, vorausgesetzt, sie konnten sich auf annehmbare Bedingungen einigen.
»Sagen Sie mal«, fragte er, »könnten Sie mich kurz zu einem alten Freund fahren?«
»Aber sicher«, antwortete Kerrigan.
»Ihre Frau erwartet Sie nicht?«
»Nicht vor dem Abendessen.«
»Und Ihre Tochter? Wird sie sich keine Sorgen machen?«
Kerrigan lachte. »Anna? Es ist ihr Job, mir Sorgen zu machen.«
Anna erwartete jeden Moment, von ihrem Vater gerufen zu werden, stattdessen erschien die empört schnaufende Kinderfrau und beorderte sie aus der Kälte. Das Licht hatte sich verändert, im Kinderzimmer war es bedrückend dunkel. Dort sorgte ein Holzofen für Wärme. Sie aßen Walnusskekse und schauten zu, wie der Zug, aus dessen Miniaturschornstein echter Dampf quoll, über die von Anna gebaute Acht raste. Ein solches Spielzeug hatte sie noch nie gesehen, es musste unglaublich teuer gewesen sein. Sie hatte die Nase voll von diesem Besuch. Er dauerte viel länger als normal, und Anna war erschöpft, weil sie auf die anderen Kinder hatte eingehen müssen. Schließlich ließen die Jungs den fahrenden Zug links liegen und sahen sich Bilderbücher an. Die Kinderfrau war in einem Schaukelstuhl eingenickt. Tabby lag auf einem Flechtteppich und richtete ihr neues Kaleidoskop auf die Lampe.
Anna fragte möglichst desinteressiert: »Darf ich mal deine Flossie Flirt halten?«
Tabby deutete ihre Einwilligung an, und Anna holte die Puppe vorsichtig aus dem Regal. Flossie-Flirt-Puppen gab es in vier Größen, und dies war die zweitkleinste – kein Neugeborenes, sondern ein etwas größeres Baby mit blauen, überrascht dreinschauenden Augen. Anna drehte die Puppe auf die Seite, und wie die Zeitungswerbung versprach, glitten die blauen Pupillen in die Augenwinkel, als würden sie Anna im Blick behalten. Sie war auf einmal so glücklich, dass sie fast gelacht hätte. Die Lippen der Puppe bildeten ein perfektes »O«. Man hatte zwei weiße Zähne zwischen die Lippen gemalt.
Tabby, die Annas Freude zu spüren schien, sprang auf. »Du kannst sie haben«, rief sie. »Ich spiele sowieso nicht mehr damit.«
Anna musste dieses Angebot erst einmal verdauen. Sie hatte sich an Weihnachten vor zwei Jahren sehnlichst eine Flossie Flirt gewünscht, aber nicht gewagt, darum zu bitten – es waren keine Schiffe mehr eingelaufen, und sie hatten kein Geld. Nun sehnte sie sich wieder schmerzhaft nach der Puppe, und obwohl sie wusste, dass sie das Angebot ablehnen musste, kam sie ins Wanken.
»Danke«, sagte sie schließlich. »Aber ich habe eine größere zu Hause. Ich wollte nur mal schauen, wie die kleinere so ist.« Sie zwang sich mit einer gewaltigen Anstrengung, die Flossie Flirt wieder ins Regal zu setzen, ließ ihre Hand aber auf einem Bein liegen, bis sie den Blick der Kinderfrau spürte. Sie wandte sich gespielt gleichgültig ab.
Zu spät. Die Kinderfrau hatte es gesehen und wusste Bescheid. Als Tabby von ihrer Mutter aus dem Zimmer gerufen wurde, griff sie nach der Puppe und drückte sie Anna fast gewaltsam in die Arme. »Nimm sie, Liebes«, flüsterte sie eindringlich. »Das macht ihr nichts aus – sie ertrinkt in Spielzeug. Und ihre Brüder auch.«
Anna war hin- und hergerissen und bildete sich kurz ein, es gäbe vielleicht doch eine Möglichkeit, die Puppe unbemerkt mitzunehmen. Aber der Gedanke an die Reaktion ihres Vaters sorgte für eine Verhärtung. »Nein, danke«, sagte sie kühl. »Ich bin schon zu alt für Puppen.« Sie verließ das Kinderzimmer, ohne sich noch einmal umzudrehen. Das Mitgefühl der Kinderfrau hatte sie aber in Versuchung gebracht, und sie stieg die Treppe mit weichen Knien hinauf.
Beim Anblick ihres Vaters in der Eingangshalle konnte Anna den Impuls, zu ihm zu laufen und wie früher seine Beine zu umschlingen, nur schwer unterdrücken. Er trug seinen Mantel. Mrs Styles verabschiedete ihn. »Beim nächsten Mal bringst du deine Schwester mit«, sagte sie zu Anna und gab ihr einen moschusduftenden Kuss auf die Wange. Anna versprach es. Draußen schimmerte ihr Auto matt in der späten Nachmittagssonne. Früher, als es noch ihnen gehört hatte, hatte es immer richtig geglänzt; die Jungs der Gewerkschaft polierten den Wagen nicht oft genug.
Während sie sich von Mr Styles’ Haus entfernten, suchte Anna nach einer pfiffigen Bemerkung, die ihren Vater entwaffnete – eine der Bemerkungen, mit denen sie ihn früher ungewollt zum Lachen gebracht hatte. Inzwischen ertappte sie sich manchmal bei dem Wunsch, wieder wie damals zu sein. Sie schien eine gewisse Frische oder Unschuld verloren zu haben.
»Mr Styles hatte sein Geld offenbar nicht in Aktien angelegt«, sagte sie schließlich.
Er zog sie mit einem leisen Lachen an sich. »Mr Styles braucht keine Aktien. Er besitzt Nachtclubs. Unter anderem.«
»Ist er in der Gewerkschaft?«
»O nein. Er hat nichts mit der Gewerkschaft zu tun.«
Das überraschte sie. Im Allgemeinen trugen Gewerkschafter Hüte, Schauermänner Mützen. Manche, so auch ihr Vater, trugen beides, je nach Bedarf. Anna konnte sich ihren Vater nicht mit der Hakenstange eines Schauermanns vorstellen, wenn er so gut gekleidet war wie jetzt. Ihre Mutter, die zu Hause im Akkord Näharbeiten verrichtete, legte exotische Federn zur Seite, mit denen sie die Hüte ihres Mannes ausstaffierte. Sie nähte seine Anzüge nach der neuesten Mode um und versuchte, seine hagere Gestalt in ein vorteilhaftes Licht zu rücken – er hatte an Gewicht verloren, seit die Schiffe ausblieben, und bewegte sich nicht mehr so viel.
Ihr Vater lenkte mit einer Hand, die Zigarette zwischen zwei Fingern, den anderen Arm um Anna gelegt. Sie lehnte sich an ihn. Am Ende waren sie immer zu zweit unterwegs, und Anna trieb in einer Strömung schläfriger Zufriedenheit. Im Auto nahm sie neben dem Zigarettenrauch ihres Vaters etwas Neues wahr, einen lehmigen Geruch, den sie nicht einordnen konnte.
»Wieso die nackten Füße, Goldstück?«, fragte er erwartungsgemäß.
»Um das Wasser zu spüren.«
»Das machen nur kleine Mädchen.«
»Tabatha ist acht, und sie hat es nicht getan.«
»Sie war vernünftig.«
»Mr Styles hat es aber gefallen.«
»Du weißt nicht, wie er darüber gedacht hat.«
»Doch. Er hat mit mir gesprochen, als du uns nicht hören konntest.«
»Ist mir aufgefallen«, erwiderte er und warf ihr einen Blick zu. »Was hat er gesagt?«
Sie kehrte in Gedanken zu dem Sand zurück, zu der Kälte, dem Schmerz in ihren Füßen und dem neugierig vor ihr hockenden Mann – und all das vermischte sich mit ihrer Sehnsucht nach der Flossie-Flirt-Puppe. »Er hält mich für stark«, antwortete sie mit einem Kloß im Hals. Ihre Augen wurden feucht.
»Bist du ja auch, Goldstück«, sagte er und küsste sie auf den Kopf. »Das sieht ein Blinder.«
An einer Ampel klopfte er eine weitere Zigarette aus der Schachtel Raleigh. Anna schaute hinein, aber sie hatte den Coupon schon herausgefischt. Ihr Vater musste mehr rauchen, fand sie; sie hatte jetzt achtundsiebzig Coupons, aber reizvolle Angebote gab es erst ab hundertfünfundzwanzig. Für achthundert bekam man einen individuell gestalteten Kasten mit einem Silberbesteck für sechs Personen, für siebenhundert einen elektrischen Toaster, Zahlen, die sie für utopisch hielt. Der Prämienkatalog enthielt kaum Spielzeug – nur einen Pandabären von Frank Buck und eine Betsy-Wetsy-Puppe mit kompletter Babyausstattung, beides für zweihundertfünfzig, beides unter ihrer Würde. Sie fand die Dartscheibe verlockend, »für ältere Kinder und Erwachsene«, konnte sich aber nicht vorstellen, die Pfeile in ihrer kleinen Wohnung zu werfen. Was, wenn Lydia getroffen wurde?
Über den Zeltlagern der Arbeitslosen im Prospekt Park stieg Rauch auf. Sie wären gleich zu Hause. »Ah, hätte ich fast vergessen«, sagte ihr Vater. »Schau mal, was ich hier habe.« Er zog eine Papiertüte aus dem Mantel und reichte sie Anna. Die knallroten Tomaten darin verströmten den herben, erdigen Geruch, den sie bemerkt hatte.
»Woher stammen die«, fragte sie staunend, »im Winter?«
»Mr Styles hat einen Freund, der sie in einem Glashäuschen anbaut. Er hat es mir gezeigt. Wir überraschen Mama damit, hm?«
»Du warst unterwegs? Während ich in Mr Styles’ Haus war?« Sie war erstaunt und verletzt. Sie begleitete ihn seit Jahren auf seinen Touren, und er hatte sie nie allein gelassen. Er war stets in Sichtweite gewesen.
»Nur ganz kurz, Goldstück. Du hast mich doch gar nicht vermisst.«
»War es weit weg?«
»Nein, nicht sehr weit.«
»Doch, ich habe dich vermisst.« Sie bildete sich plötzlich ein, gemerkt zu haben, dass er fort gewesen war, die Leere seiner Abwesenheit gespürt zu haben.
»Firlefanz«, sagte er und gab ihr wieder einen Kuss. »Du hast dich doch prächtig amüsiert.«
2
Die zusammengefaltete Evening Journal unter dem Arm, hielt Eddie Kerrigan schnaufend vor seiner Wohnungstür inne. Er hatte Anna schon nach oben geschickt, während er noch die Zeitung kaufen, vor allem jedoch die Heimkehr hinauszögern wollte. Die Wärme der unermüdlichen Heizkörper entwich unter der Tür in den Flur und verstärkte einen Geruch nach Leber und Zwiebeln, der im dritten Stock aus der Wohnung der Feeneys drang. Seine eigene Wohnung lag im sechsten Stock – genaugenommen im fünften, denn eigentlich durfte man nicht so hoch bauen. Um damit durchzukommen, hatte ein genialer Bauunternehmer die Idee gehabt, den zweiten Stock in den ersten umzutaufen. Dies wurde durch den größten Vorzug des Gebäudes allerdings mehr als wettgemacht: Ein Heizkessel im Keller pumpte Dampf in die Heizkörper aller Zimmer.
Er stutzte, als das laute Lachen seiner Schwester hinter der Tür erklang. Offenbar war Brianne früher als erwartet aus Kuba zurückgekehrt. Eddie stieß die Tür auf, die in den mehrfach überstrichenen Angeln quietschte. Agnes, seine Frau, saß in einem gelben, kurzärmeligen Kleid am Küchentisch (im sechsten Stock war das ganze Jahr Sommer). Und tatsächlich: Brianne saß ihr gegenüber, gebräunt und mit einem fast leeren Glas in der Hand – wie es mit Briannes Gläsern nun mal so war.
»Hallo, Schatz«, sagte Agnes, die gerade einen Berg Damenkappen mit Ziermünzen bestickte. »Du bist spät dran.«
Sie küsste ihn, und Eddie, der die Hände auf ihre Hüften legte, spürte die Regung, die sie trotz allem stets in ihm weckte. Ein Hauch der Apfelsinenringe, mit denen sie den Weihnachtsbaum geschmückt hatten, stieg ihm in die Nase, und dort, im Wohnzimmer, in der Nähe des Baumes, spürte er Lydias Anwesenheit. Er drehte sich nicht um. Er musste sich zuerst innerlich darauf vorbereiten. Seine Frau zu küssen war ein guter Anfang. Sie füllte ein Glas des exotischen Rums, ein Mitbringsel von Brianne, mit Selterswasser auf – das war sogar ein ausgezeichneter Anfang.
Agnes trank abends nichts mehr; sie sei dann zu müde, meinte sie. Eddie stellte seiner Schwester das frisch gefüllte, um einen Eiswürfel ergänzte Cocktailglas hin und stieß mit ihr an. »Wie war die Reise?«
»Großartig«, antwortete Brianne lachend, »jedenfalls, bis sie schrecklich wurde. Ich bin mit dem Dampfer heimgekehrt.«
»Nicht ganz so schick wie eine Yacht. Sag mal – das schmeckt ja köstlich.«
»Der Dampfer war das Beste überhaupt! Ich habe an Bord einen neuen Freund gefunden, einen Pfundskerl.«
»Hat er Arbeit?«
»Er ist Trompeter in einer Band«, antwortete Brianne. »Ja, ich weiß, ich weiß, Bruderherz, sag’s lieber nicht. Er ist unglaublich süß.«
Alles wie gehabt. Seine drei Jahre ältere Schwester – genauer Halbschwester, denn sie hatten unterschiedliche Mütter und waren getrennt voneinander aufgewachsen – glich einem schicken Auto, das immer kurz vor dem Kollaps stand, weil es von seinem tollkühnen Fahrer zu schnell gefahren wurde. Brianne war früher eine strahlende Schönheit gewesen; heute sah sie bei ungünstigem Licht aus wie eine Neununddreißigjährige, die auf die Fünfzig ging.
Im Wohnzimmer erklang ein Stöhnen, das Eddie traf wie ein Tritt in die Magengrube. Jetzt, dachte er, bevor Agnes ihn auffordern musste. Er stand auf und ging zu dem Sessel, in dem Lydia hing wie ein Schluck Wasser, mit Kissen im Rücken, als wäre sie eine Greisin – sie hatte nicht die Kraft, sich aufrecht zu halten. Als Eddie näher kam, setzte sie ihr schiefes Lächeln auf. Ihr Kopf lag auf der Brust, die Hände waren so schlaff wie gebrochene Flügel. Ihre blauen Augen suchten die seinen: strahlende Augen, ungetrübt von ihrer Behinderung.
»Hallo, Liddy«, sagte er steif. »Wie war dein Tag, meine Kleine?«
Sie konnte nicht antworten, und er musste sich zwingen, nicht spöttisch zu klingen. Wenn Lydia redete, auf ihre Art, dann brabbelte sie unverständlich – die Ärzte nannten das Echolalie. Trotzdem kam es ihm sonderbar vor, nicht mit ihr zu reden. Was sollte man sonst mit einer Achtjährigen anfangen, die nicht aus eigener Kraft sitzen, geschweige denn gehen konnte? Streicheln und begrüßen – das dauerte nur fünfzehn Sekunden. Und dann? Agnes würde mit Argusaugen darauf lauern, dass er seiner jüngeren Tochter seine Zuneigung bewies. Eddie kniete sich neben Lydia und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Ihre goldenen, lockigen Haare dufteten nach dem teuren Shampoo, auf den Agnes bestand. Ihre Haut war so weich wie die eines Kleinkinds. Je älter Lydia wurde, desto größer die Versuchung, sich auszumalen, wie sie ohne ihre Behinderung ausgesehen hätte. Eine Schönheit. Noch schöner als Agnes – bestimmt schöner als Anna. Ein sinnloser Gedanke.
»Wie war dein Tag, meine Kleine?«, flüsterte er wieder, nahm Lydia in die Arme und setzte sich in den Sessel, spürte ihr Gewicht auf seiner Brust. Anna, von ihrer Mutter darauf trainiert, dieses Miteinander genau zu beobachten, lehnte sich gegen ihn. Ihre Hingabe zu Lydia verwirrte Eddie, denn Lydia konnte fast nichts zurückgeben. Anna zog ihrer Schwester die Strümpfe aus und kitzelte sie unter den weichen, krummen Füßen, bis sie in Eds Armen zappelte und auf ihre sonderbare Art lachte. Er hasste das. Er ging lieber davon aus, dass Lydia dachte und fühlte wie ein Tier, das nur auf sein Überleben bedacht war, aber dem widersprach das Lachen, das ihr das Kitzeln entlockte. Er wurde wütend – zuerst auf Lydia, danach auf sich selbst, weil er ihr diese kleine Freude missgönnte. So erging es ihm auch, wenn sie sabberte, was sie natürlich nicht absichtlich tat: Dann wurde er wütend, hätte ihr am liebsten eine gescheuert, und danach quälten ihn Schuldgefühle. Seine jüngere Tochter löste abwechselnd Wut und Selbsthass in ihm aus, und am Ende fühlte er sich ausgepumpt und abgestumpft.
Trotzdem konnte es so herrlich sein. Draußen breitete sich die bläuliche Dämmerung aus, Briannes Rum trübte sein Denken auf angenehme Art, seine Töchter schmiegten sich an ihn wie Kätzchen. Im Radio erklang Ellington, die Monatsmiete war bezahlt; es könnte ihnen schlechter gehen – und vielen Leuten ging es gegen Ende des Jahres 1934 tatsächlich schlechter. Eine benebelnde Aussicht auf Glück zerrte mit schläfriger Schwere an Eddie. Doch sein Widerwille riss ihn zurück in die Realität: Nein, ich kann das nicht akzeptieren, das reicht nicht, um glücklich zu sein. Er sprang so plötzlich auf, dass Lydia erschrak, und bettete seine wimmernde Tochter wieder auf den Sessel. Nichts war, wie es sein sollte – nicht einmal ansatzweise. Eddie vertrat Gesetz und Ordnung (was er sich oft selbstironisch in Erinnerung rief), und hier waren zu viele Gesetze gebrochen worden. Er zog sich zurück, er sonderte sich ab, und für diese Verweigerung des Glücks wurde er belohnt: mit einem Stich des Schmerzes und der Einsamkeit.
Er musste einen besonderen, extrem teuren Rollstuhl kaufen. Mit einer Tochter wie Lydia brauchte man eigentlich das Vermögen eines Dexter Styles – aber hatten Männer wie er solche Kinder? Während ihrer ersten Lebensjahre, sie hatten sich damals noch für reich gehalten, war Lydia von Agnes allwöchentlich zu einer Klinik der New York University gefahren worden, wo sie von einer Frau mit Mineralbädern, Lederriemen und Flaschenzügen behandelt worden war, Letzteres, um die Muskeln zu stärken. All dies überstieg jetzt ihre Verhältnisse. Der Stuhl würde es Lydia wenigstens erlauben, aufrecht zu sitzen, aus dem Fenster zu schauen, ein Teil der vertikalen Welt zu sein. Agnes glaubte fest an die Verwandlungskraft des Stuhls, und Eddie meinte, wenigstens so tun zu müssen, als würde er ihre Zuversicht teilen. Vielleicht tat er das sogar. Der Stuhl war jedenfalls der Anlass dafür, dass er die Bekanntschaft von Dexter Styles gesucht hatte.
Agnes räumte Kappen und Kettchen mit Ziermünzen vom Tisch und deckte ihn für vier Personen. Sie hätte Lydia gern auf ihren Schoß gesetzt, aber dann wäre Eddie das Abendessen verdorben worden. Also ließ sie ihre jüngere Tochter im Wohnzimmer sitzen und warf ihre Aufmerksamkeit wie ein Seil nach ihr aus. So mit ihrer Tochter verbunden, spürte Agnes die Vibrationen von Lydias Bewusstsein und Neugier; das gab ihr die Gewissheit, nicht allein zu sein. Sie hoffte, dass Lydia umgekehrt ihre brennende Liebe und Hingabe spürte. Diese Verbindung bedeutete natürlich, dass Agnes unaufmerksam war – abgelenkt, wie Eddie oft sagte. Doch ihr blieb keine andere Wahl, denn er kümmerte sich zu wenig.
Brianne unterhielt sie mit Geschichten über ihr Zerwürfnis mit Bert, während sie den Schmortopf mit Bohnen und Würstchen aßen. Die Beziehung hatte den ersten Knacks bekommen, als sie ihn vor den Bahamas aus Versehen von seiner Yacht in haiverseuchte Gewässer gestoßen hatte. »So schnell ist noch keiner geschwommen«, sagte sie. »Das war olympiareif, glaubt mir. Auf Deck ist er dann zusammengeklappt, und als ich ihn aufrichten und in die Arme nehmen wollte – denn er hatte nach Tagen endlich mal wieder was Lustiges getan –, was hat er da gemacht? Er wollte mir eins auf die Nase geben.«
»Und dann?«, rief Anna aufgeregter, als ihrem Vater lieb war. Seine Schwester war ein äußerst schlechter Einfluss, nur wusste er nicht recht, was er dagegen tun oder wie er sie zügeln sollte.
»Ich bin natürlich ausgewichen, und er wäre beinahe wieder ins Wasser gepurzelt. Männer, die reich auf die Welt kommen, haben keinen blassen Schimmer, wie man kämpft. Das können nur die armen Schlucker. Wie du, Bruderherz.«
»Wir besitzen aber keine Yacht«, erwiderte er.
»Was für ein Jammer«, sagte Brianne. »Mit Yachtmütze wärst du todschick.«
»Du vergisst, dass ich eine Abneigung gegen Boote habe.«
»Wenn man mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wird, verweichlicht man«, meinte Brianne. »Und es dauert nicht lange, dann sind diese Burschen an jeder Stelle weich, wenn ihr versteht, was ich meine. Weich in der Birne«, ergänzte sie bei Eddies strafendem Blick.
»Und der Trompeter?«, fragte er.
»Oh, er ist ein Schätzchen. Zum Knuddeln, wirklich. Locken wie Rudy Vallée.«
Sie würde bald wieder Geld brauchen. Ihre Zeit als Tänzerin war lange vorbei, und ihre Beaus waren schon immer ihre Haupteinnahmequelle gewesen. Inzwischen gab es kaum noch Männer mit Geld in der Tasche, und einer Frau mit Tränensäcken und Hüftspeck fiel es nicht mehr so leicht, sich jemanden zu angeln. Eddie kratzte immer Geld zusammen, wenn seine Schwester ihn anpumpte, selbst wenn er dafür beim Itzig etwas leihen musste. Er dachte mit Grausen daran, was andernfalls aus ihr würde.
»Der Trompeter hat sogar ziemlich gut gefüllte Taschen«, sagte Brianne. »Er tritt immer wieder in Clubs von Dexter Styles auf.«
Der Name überrumpelte Eddie. Er hatte ihn noch nie aus dem Mund von Brianne oder jemand anderem gehört – hatte nicht einmal daran gedacht, sich darauf gefasst zu machen. Er spürte das Zögern der gegenübersitzenden Anna. Würde sie erzählen, dass sie den Tag bei genau diesem Mann in dessen Haus in Manhattan Beach verbracht hatten? Eddie wagte es nicht, sie anzuschauen. Und sein langes Schweigen nötigte Anna, den Mund zu halten.
»Das ist doch schon mal was«, sagte er schließlich zu seiner Schwester.
»Guter, alter Eddie«, seufzte Brianne. »Der unverwüstliche Optimist.«
Die Uhr im Wohnzimmer schlug sieben, was bedeutete, dass es schon fast Viertel nach war. »Papa«, sagte Anna. »Du hast die Überraschung vergessen.«
Eddie, soeben haarscharf davongekommen, begriff zunächst nicht, was sie meinte. Dann fiel es ihm ein, und er stand vom Tisch auf und ging zu seinem aufgehängten Mantel. Während er versuchte, sich wieder zu beruhigen, und so tat, als würde er in den Taschen kramen, staunte er über seine Anna. Sie war gut, ja, sogar besser als gut. Er kippte die Tüte um, ließ die Tomaten auf den Tisch kullern. Seine Frau und seine Schwester waren völlig verblüfft. »Wo hast du die bekommen? Und wie?«, fragten sie durcheinander. »Von wem?«
Eddie suchte noch nach einer Erklärung, da antwortete Anna aalglatt: »Einer der Gewerkschafter hat ein Gewächshaus.«
»Die leben wie die Maden im Speck, diese Burschen von der Gewerkschaft«, meinte Brianne. »Und das trotz Wirtschaftskrise.«
»Gerade deshalb«, fügte Agnes trocken hinzu, aber sie freute sich insgeheim. Wenn Eddie immer noch etwas zugeschoben wurde, hieß das, dass er gebraucht wurde – und dafür gab es keine Garantie. Sie holte Salz und Schälmesser und begann, die Tomaten auf einem Schneidebrett zu zerteilen. Saft und Samen liefen auf das Öltuch. Brianne und Agnes aßen die Tomatenstückchen mit entzückten Seufzern.
»Truthahn zu Weihnachten, und nun dies – offenbar steht eine Wahl an«, sagte Brianne und leckte sich Saft von den Fingern.
»Dunellen will Stadtrat werden«, sagte Agnes.
»Der Geizhals? Gott steh uns bei. Na, los, Eddie, koste auch mal eine.«
Als er es schließlich tat, staunte er über den intensiven, salzig-sauer-süßen Geschmack. Anna begegnete seinem Blick ohne jede Spur eines verschwörerischen Grinsens. Das hatte sie gut gemacht, besser als erhofft, und trotzdem merkte Eddie, dass ihn eine Sorge quälte – oder holte ihn eine Sorge ein, die ihn früher am Tag belastet hatte?
Während Anna ihrer Mutter half, den Tisch abzuräumen und das Geschirr zu spülen, schenkte sich Brianne Rum nach, und Eddie öffnete das zur Feuertreppe führende Fenster und stieg hinaus, um eine zu rauchen. Er schloss das Fenster hinter sich, damit Lydia keinen Zug abbekam. Gelber Laternenschein tränkte die dunkle Straße. Da stand der herrliche Duesenberg, der ihm einmal gehört hatte. Er war erleichtert, als ihm einfiel, dass er das Auto noch abgeben musste und dadurch der Wohnung entkäme. Dunellen erlaubte ihm nicht, den Wagen über Nacht zu behalten.
Während Eddie rauchte, erwachte seine Sorge um Anna, als hätte er diese in die Tasche gesteckt wie einen Stein, den er nun in Ruhe untersuchen konnte. Er hatte ihr auf Coney Island das Schwimmen beigebracht, war mit ihr in Der öffentliche Feind, Der kleine Cäsar und Scarface gewesen (missbilligend beäugt von den Platzanweisern), hatte ihr Egg-Creams, Charlotte russes und Kaffee spendiert, den sie mit seiner Erlaubnis schon seit dem siebten Lebensjahr trank. Sie hätte ebenso gut ein Junge sein können: Ihre Strümpfe waren voller Straßenstaub, ihre Alltagskleider genaugenommen kurze Hosen. Sie war eine Draufgängerin, ein Unkraut, das überall gedieh und nicht auszurotten war. Sie pumpte so zuverlässig Leben in ihn hinein, wie Lydia es ihm entzog.
Aber sie hatte bei Tisch gerade eine glatte Lüge erzählt. Das war nicht gut, denn ein solches Verhalten konnte sie auf die schiefe Bahn bringen. Während des Strandspaziergangs mit Styles hatte er plötzlich begriffen, dass Anna vielleicht nicht bildhübsch, aber faszinierend war. Sie war fast zwölf – kein kleines Kind mehr, obwohl er sie noch so sah. Der Schatten dieser Erkenntnis hatte ihn den ganzen Tag belastet.
Die Schlussfolgerung lag auf der Hand: Er durfte Anna nicht mehr mitnehmen. Vielleicht nicht sofort, aber bald. Dieser Gedanke erhöhte seine innere Leere noch weiter.
Wieder in der Wohnung, drückte ihm Brianne einen feuchten, nach Rum riechenden Kuss auf die Wange und brach auf, um ihren Trompeter zu treffen. Seine Frau wechselte die Windel von Lydia, die auf einem Brett auf der Badewanne lag. Eddie umschlang sie von hinten und legte sein Kinn auf ihre Schulter, versuchte, die alte Unbeschwertheit wiederzufinden, bildete sich kurz ein, die Uhr zurückdrehen zu können. Agnes wollte aber nur, dass er Lydia küsste und die Windel mit der Sicherheitsnadel schloss, ohne sie zu stechen. Eddie hätte es fast getan – er wollte, war schon fast dabei –, unterließ es dann aber, und der Impuls verflog. Er ließ Agnes los, enttäuscht von sich selbst, und sie wechselte die Windel allein. Auch sie hatte den Sog des früheren Lebens gespürt. Wenn sie sich umdrehte, Eddie küsste, ihn überraschte, Lydia kurz vergaß – wäre das so schlimm? Sie stellte sich vor, es zu tun, brachte es aber nicht fertig. Ihr altes Leben lag neben den Kostümen für die Follies zusammengefaltet in einer Kiste und setzte Staub an. Eines Tages würde sie die Kiste vielleicht unter dem Bett hervorziehen und öffnen. Aber nicht jetzt. Lydia war zu stark auf sie angewiesen.
Eddie betrat das Zimmer, das Anna mit Lydia teilte. Es ging zur Straße; er schlief mit Agnes im Zimmer neben dem Luftschacht, in dem es ungut nach Schimmel und nasser Asche stank. Anna brütete über ihrem Prämienkatalog. Ihre Besessenheit von dieser winzigen Broschüre mit den vielen überbewerteten Dingen verwirrte ihn, aber er setzte sich auf das schmale Bett und gab ihr den Coupon aus seiner neuen Schachtel Raleigh. Sie betrachtete einen Bridgetisch mit Intarsien, der »auch bei ständigem Gebrauch nicht abnutzt«.
»Was meinst du?«, fragte sie.
»Siebenhundertfünfzig Coupons? Wenn wir den wollen, muss sogar Lydia mit Rauchen anfangen.«
Das brachte sie zum Lachen. Sie fand es herrlich, wenn er Lydia mit einschloss. Sie schlug eine andere Seite auf: Eine Herrenarmbanduhr. »Die könnte ich dir besorgen, Papa«, sagte sie. »Immerhin bist du es, der all die Zigaretten qualmt.«
Er war gerührt. »Ich habe doch meine Taschenuhr. Du bist die Sammlerin, also solltest du dir etwas gönnen.« Er blätterte im Katalog nach Spielzeug.
»Eine Betsy-Wetsy-Puppe?«, meinte sie verächtlich.
Ihr Tonfall traf ihn, und er schlug eine Seite mit Puderdosen und Seidenstrümpfen auf.
»Für Mama?«, fragte sie.
»Für dich. Weil du jetzt zu alt für Puppen bist.«
Zu seiner Erleichterung lachte sie schallend. »Das Zeug will ich bestimmt nicht haben«, sagte sie und kehrte zu Gläsern, einem Toaster, einer Elektrolampe zurück. »Es sollte etwas sein, das die ganze Familie benutzen kann«, sagte sie, als wären sie keine Kleinfamilie, sondern eine ganze Sippe wie die Feeneys, deren acht kerngesunde Kinder zwei Wohnungen bevölkerten und der Familie das Monopol auf eines der Klos im dritten Stock sicherten.
»Es war richtig von dir, Goldstück«, sagte er leise. »Mr Styles beim Essen nicht zu erwähnen. Am besten, du nimmst seinen Namen nie mehr in den Mund.«
»Außer dir gegenüber?«
»Nicht einmal das. Ich werde ihn auch nicht mehr nennen. Wir dürfen ihn denken, aber nicht aussprechen. Verstanden?«
Er machte sich auf ihr unvermeidliches Gelächter gefasst, aber Anna fand seine List offenbar aufregend. »Ja!«
»Gut. Über wen haben wir gerade gesprochen?«
Kurzes Schweigen. »Mr Namenlos«, antwortete sie schließlich.
»Braves Mädchen.«
»Verheiratet mit Mrs Namenlos.«
»Bingo.«
Anna spürte, wie sie vergaß, eingelullt durch das Vergnügen, ein Geheimnis mit ihrem Vater zu teilen und ihm so eine Freude zu machen. Der Tag mit Tabatha und Mr Styles verwandelte sich in einen der Träume, die zerfransen und sich auflösen, noch während man sie festhalten will.
»Und sie lebten im Land Namenlos«, sagte sie und stellte sich ein Schloss am Meer vor, das in einem Nebel des Vergessens versank.
»Ganz genau«, sagte ihr Vater. »Ganz genau. War traumhaft schön, oder?«
3
Eddies Erleichterung beim Verlassen der Wohnung war das genaue Gegenteil der Erleichterung, die ihn früher bei der Heimkehr erfüllt hatte. Endlich durfte er rauchen. Er riss im Erdgeschoss ein Streichholz am Schuh an und entfachte eine Zigarette, froh darüber, auf dem Weg nach unten keinem Nachbarn begegnet zu sein. Er hasste sie wegen ihrer Reaktionen auf Lydia. Bei den frommen und wohltätigen Feeneys war es Mitleid. Bei Mrs Baxter, deren Hausschuhe wie Kakerlaken hinter der Tür trippelten, wenn Schritte auf der Treppe ertönten, perverse Neugier. Bei Lutz und Boyle, den greisen Junggesellen, die Wand an Wand wohnten, aber seit zehn Jahren kein einziges Wort mehr gewechselt hatten, Ekel (Boyle) und Zorn (Lutz). »Müsste sie nicht in einem Heim sein?«, hatte Lutz einmal dreist gefragt. Und Eddie hatte entgegnet: »Sie denn nicht auch?«
Vor dem Haus in der Kälte stehend, hörte er Gemurmel und Geraschel, jemand pfiff mit einer Kippe im Mund. Bei dem Ruf »Alle frei!« begriff er, dass es Jungs waren, die Ringolevio spielten: Zwei Teams, die versuchten, einander gefangen zu nehmen. Dieses Mietshaus hatte eine ebenso bunte Einwohnerschaft wie der ganze Block – Italiener, Polen, Juden, alles außer Negern –, aber diese Szene hätte sich genauso gut im katholischen Kinderheim in der Bronx abspielen können, in dem er aufgewachsen war. Egal, wohin man ging, überall wimmelte es von Jungs.
Eddie stieg in den Duesenberg, ließ den Motor an und horchte dabei auf das vibrierende Heulen, das ihm neulich aufgefallen war, ein ungutes Geräusch. Dunellen ruinierte das Auto – wie alles, was er anfasste, Eddie eingeschlossen. Während er das Gaspedal durchtrat und die Ohren spitzte, sah er zum milden Licht in den Wohnzimmerfenstern auf. Dort war seine Familie. Eddie blieb manchmal im Flur stehen, bevor er die Wohnung betrat, und lauschte der ausgelassenen Fröhlichkeit hinter der geschlossenen Tür. Er war jedes Mal überrascht. Habe ich mir das nur eingebildet?, fragte er sich im Nachhinein. Oder waren sie ohne ihn unbeschwerter, vielleicht sogar glücklicher?
Wenn ihr Vater die Wohnung verließ, glaubte Anna zunächst immer, er hätte alles Leben mitgenommen. Beim Ticken der Wohnzimmeruhr musste sie die Zähne zusammenbeißen. Ein schmerzhaftes Gefühl der Nutzlosigkeit, fast eine Wut, pochte in ihren Fingern und Handgelenken, während sie Kunstperlen auf einen mit vielen Federn besetzten Kopfschmuck nähte. Ihre Mutter versah die insgesamt fünfundfünfzig Damenkappen mit Ziermünzen, aber die schwierigsten Näharbeiten musste Anna erledigen. Sie war nicht stolz auf ihre Fingerfertigkeit. Mit den Händen zu arbeiten hieß, Befehlsempfängerin zu sein – ihre Mutter nahm die Befehle von Pearl Gratzky entgegen, einer Kostümbildnerin, die sie von den Follies kannte und die für Broadway-Shows, manchmal auch für Hollywoodfilme engagiert wurde. Mrs Gratzkys Mann war bettlägerig. Er hatte im Krieg eine tiefe Wunde auf einer Seite des Oberkörpers davongetragen, die jetzt, sechzehn Jahre später, noch immer nicht verheilt war – eine Tatsache, die man oft bemühte, um das hysterische Geschrei zu erklären, in das Pearl ausbrach, wenn eine Arbeit nicht zu ihrer Zufriedenheit erledigt worden war. Annas Mutter hatte Mr Gratzky nie gesehen.
Als Lydia aus ihrem Halbschlaf erwachte, schüttelten Anna und ihre Mutter ihre Mattigkeit ab. Lydia saß mit einem Lätzchen auf Annas Schoß und wurde von ihrer Mutter mit dem täglich frisch zubereiteten Brei aus Gemüse und Hackfleisch gefüttert. Lydia wirkte hellwach; sie sah und hörte und verstand. Nachts teilte Anna ihrer Schwester im Flüsterton Geheimnisse mit. Nur Lydia wusste, dass Anna vor einigen Wochen, sie hatte fertige Näharbeiten abliefern wollen und Pearl nicht angetroffen, das Loch in Mr Gratzkys Seite gesehen hatte. Von einem Wagemut beflügelt, der ihr eigentlich nicht entsprach, hatte Anna die Zimmertür des Bettlägerigen aufgestoßen – ein überraschend großer Mann mit markantem, schwer geprüftem Gesicht – und darum gebeten, die Wunde sehen zu dürfen. Mr Gratzky hatte sein Pyjamaoberteil hochgezogen, den Gazeverband gelüpft und ihr eine kleine, kreisförmige Wunde gezeigt, rosig und glänzend wie ein Babymund.
Nachdem Lydia aufgegessen hatte, drehte Anna am Regler des Radios, bis sie das Martell Orchestra fand, das konventionelle Tanzmusik spielte. Sie begann zögernd, mit ihrer Mutter zu tanzen und erwartete, dass der unter ihnen wohnende Mr Praeger mit dem Besenstiel gegen die Decke pochte. Aber wie so oft an Samstagabenden schien er einem illegalen Boxkampf beizuwohnen. Sie drehten die Lautstärke auf, und Annas Mutter tanzte ungewohnt selbstvergessen und ungestüm. Das weckte in Anna die vage Erinnerung daran, sie vor vielen Jahren auf der Bühne gesehen zu haben: Als ferne, schimmernde, in buntes Licht getauchte Vision. Ihre Mutter beherrschte alle Tänze – Baltimore Buzz, Tango, Black Bottom, Cake Walk –, aber inzwischen tanzte sie nur noch zu Hause mit Anna und Lydia.
Anna tanzte mit Lydia in den Armen, bis die Schlaffheit ihrer Schwester zu einem Teil des Tanzes wurde. Sie bekamen rote Wangen; die Haare ihrer Mutter lösten sich, und sie öffnete den obersten Knopf ihres Kleides. Sie knallte gegen das Fenster vor der Feuertreppe, und durch den Knacks im Glas drang eisige Luft, die sie zum Husten brachte. In der kleinen Wohnung herrschte eine Ausgelassenheit, die in Anwesenheit ihres Vaters unmöglich zu sein schien; sie glich einer Sprache, die sich in Gebrabbel verwandelte, wenn er zuhörte.
Als sie alle durch das Tanzen erhitzt waren, hob Anna das Brett von der Badewanne und ließ Wasser einlaufen. Sie zogen Lydia aus und setzten sie hinein, bevor das Wasser abkühlte. Von der Schwerkraft erlöst, entfaltete sich ihr schiefer und schlaffer Körper in seiner ganzen Üppigkeit. Ihre Mutter hielt sie unter den Armen, während Anna das teure Flieder-Shampoo in Kopfhaut und Haare massierte. Lydia schaute beide aus ihren klaren, blauen Augen hingerissen an. Schaum sammelte sich auf ihren Schläfen. Das Beste für Lydia aufzusparen, als wäre sie eine Prinzessin, der dieser Tribut zustand, sorgte für eine schmerzhafte Befriedigung.
Anna und ihre Mutter mussten Lydia mit vereinten Kräften aus dem erkaltenden Wasser hieven. Seifenblasen schillerten auf ihrem verkrüppelten Körper, der auf verstörende Art so schön war wie das Innere eines Ohres. Sie hüllten sie in ein Handtuch, trugen sie zu ihrem Bett und trockneten sie auf der Tagesdecke ab, puderten ihre Haut mit Cashmere-Bouquet-Talkum. Ihr baumwollenes Nachthemd war mit Brüsseler Spitzen verziert. Ihre nassen Locken dufteten nach Flieder. Nachdem sie Lydia zugedeckt hatten, legten sich Anna und ihre Mutter auf jeweils eine Seite und verschränkten über ihren Körper hinweg die Hände, damit sie vor dem Einschlafen nicht aus dem Bett fiel.
Wenn Anna aus der Welt ihres Vaters in die von Lydia und ihrer Mutter wechselte, hatte sie stets das Gefühl, in ein erfüllteres Leben einzutauchen. Und wenn sie wieder bei ihrem Vater war, seine Hand hielt, während sie sich in die Stadt wagten, wechselte sie erneut die Welten, dachte manchmal überhaupt nicht mehr an Lydia und ihre Mutter. Sie bewegte sich hin und her, tiefer – immer tiefer –, bis sie glaubte, es könne nicht noch weiter nach unten gehen. Ein Irrtum, wie sich jedes Mal zeigte. Sie war noch immer nicht auf Grund gestoßen.
Eddie parkte den Duesenberg vor Sonny’s West Shore Bar and Grill, dicht bei den Piers. An diesem Samstagabend, drei Tage vor Silvester, war alles totenstill – was bewies, dass weder in dieser noch in der letzten Woche ein Schiff angelegt hatte.
Er grüßte Matty Flynn, den weißhaarigen Barkeeper, und ging über die Sägespäne in die Ecke links hinten, wo John Dunellen unter einem Plakat, das den Boxer Jimmy Braddock in Kampfmontur zeigte, seine inoffiziellen Geschäfte abwickelte. Er war ein Hüne mit brutal wirkenden Hafenarbeiterhänden, obwohl er seit über zehn Jahren kein Schiff mehr beladen oder entladen hatte. Trotz seines geschniegelten Äußeren wirkte er so morsch und eingesunken wie ein nach zu langer Liegezeit verrosteter Frachter. Er wurde von einer Schar Stiefellecker, Bittsteller und kleinerer Schieber umringt, die ihm seinen Anteil brachten und dafür seinen Segen bekamen. Wegen der ausbleibenden Schiffe liefen ihre Schiebereien glänzend – und die Schauermänner waren verzweifelt.
»Ed«, murmelte Dunellen, als Eddie auf einen Stuhl glitt.
»Dunny.«
Dunellen gab Flynn durch einen Wink zu verstehen, Eddie ein Genesee-Bier und ein Glas Roggenwhisky zu bringen. Dann saß er da, scheinbar zerstreut, tatsächlich aber einem kleinen, leise laufenden Radio lauschend, das er stets bei sich trug (es passte in einen Koffer). Dunellen verfolgte Pferderennen, Boxkämpfe, Ballsportarten – alles, worauf man wetten konnte, aber seine Vorliebe galt dem Boxen. Er unterstützte zwei Junioren im Fliegengewicht.
»Hast du der Braut meine Glückwünsche überbracht?«, fragte Dunellen kryptisch, weil Lonergan zuhörte, ein neuer, für die Glücksspiele zuständiger Mann.
»Zu heikel«, erwiderte Eddie. »Ich warte bis nach Neujahr.«
Dunellen brummte zustimmend. »Hauptsache, alles geht glatt.«
Der Empfänger dieser Sendung war ein Senator, und die Übergabe hätte eigentlich tagsüber stattfinden sollen, während des Auszugs aus der Saint Patrick’s Cathedral. Der Vater der Braut, Dare Dooling, war ein Bankier, der Kardinal Hayes nahestand. Dieser hatte die Ehe persönlich geschlossen.
»War gar nicht heikel«, wandte Lonergan ein. »Gab zwar Ordnungshüter, aber es waren unsere Ordnungshüter.«
»Du warst da?« Eddie war verblüfft. Er mochte Lonergan nicht, der durch seine langen Zähne immer etwas höhnisch wirkte.
»Meine Ma war die Kinderfrau der Braut«, antwortete Lonergan stolz. »Ich habe dich nirgendwo gesehen, Kerrigan.«
»Typisch Eddie.« Dunellen lachte leise. »Man sieht ihn nur, wenn er gesehen werden will.« Er ließ seinen Blick zu Eddie gleiten, und Eddie fühlte eine Verbundenheit mit seinem alten Freund, eine Art von Verwandtschaft, wie er sie für Brianne nie empfunden hatte. Eddie hatte Dunellen und einem anderen Jungen aus dem katholischen Heim das Leben gerettet – hatte die zwei brüllenden, würgenden Jungs am Rockaway Beach aus einer starken Rückströmung gezogen. Dies wurde selten erwähnt, war aber stets präsent.
»Nächstes Mal schaue ich genauer hin«, meinte Lonergan säuerlich. »Komm, ich gebe dir einen aus.«
»Einen Scheiß tust du«, donnerte Dunellen, und sein Wutausbruch weckte die flüchtige Aufmerksamkeit der zwei Dumpfbacken, die ihm auf Schritt und Tritt folgten. Dunellen hielt diese stumpfnasigen Riesen stets auf Abstand, weil sie den onkelhaften Eindruck untergruben, den er gern erweckte.
»Du weißt nicht, wie Eddie Kerrigan außerhalb dieser Bar ist – kapiert? Wie zur Hölle würde es denn aussehen, wenn er mit den oberen Zehntausend plaudert und im nächsten Moment mit einem Hornochsen wie dir quatscht? Geht dich einen Scheißdreck an, wohin Eddie geht. Steck deine Nase nicht in fremde Angelegenheiten.«
»Entschuldige, Boss«, murmelte Lonergan, dem eine tiefe Röte in die Wangen stieg. Eddie spürte seinen klebrigen Neid und hätte am liebsten laut gelacht. Lonergan beneidete ihn! Sicher, Eddie war gut gekleidet (was Agnes zu verdanken war) und fand bei Dunellen Gehör, aber er war ein Niemand ersten Ranges. Die Bezeichnung »Geldbote« traf den Nagel auf den Kopf: Es war ein Laufbursche, der einen Beutel mit gewissem Inhalt (natürlich Geld, aber das ging ihn nichts an) von einem Mann zum anderen brachte, weil beide offiziell nichts miteinander zu tun haben durften. Der ideale Geldbote war keiner Seite verpflichtet, verhielt und kleidete sich neutral und konnte diesen Transaktionen das Geheimniskrämerische nehmen. Eddie Kerrigan war der ideale Bote. Er schien überall daheim zu sein – auf der Rennbahn, in Tanzhallen, Theatern oder bei Treffen der Holy Name Society. Er wirkte nett, hatte einen neutralen Akzent und viel Übung darin, die Welten zu wechseln. Eddie konnte die Übergabe in einen Nachgedanken verwandeln: Mensch, hätte ich fast vergessen, hier, von unserem gemeinsamen Freund – Oh, besten Dank.
Dunellen zahlte ihm für seine Mühen den Mindestlohn: Mit Glück zwanzig Dollar pro Woche, eine Summe, die – mit dem Erlös aus Agnes’ Akkordarbeit – gerade eben verhinderte, dass sie die einzigen verbliebenen Wertsachen zum Pfandleiher bringen mussten: seine Taschenuhr, die er mit ins Grab nehmen wollte; das Radio; und die Wanduhr, ein Hochzeitsgeschenk von Brianne. Die Hakenstange eines Schauermanns hatte nie besser ausgesehen.
»Irgendwas in Quarantäne?«, fragte Eddie und meinte damit Schiffe, die eines der drei Piers anlaufen sollten, die Dunellen kontrollierte.
»Vielleicht für ein, zwei Tage. Aus Havanna.«
»Für eines deiner Piers?«
»Für eines der unseren«, erwiderte Dunellen. »Wieso, Eddie? Willst du Geld pumpen?«
»Von dem sicher nicht.« Nat, der Kredithai, der gerade Darts spielte, verlangte fünfundzwanzig Prozent pro Woche.
»Eddie, Eddie«, sagte Dunellen rügend. »Ich schiebe dir deinen Wochenlohn rüber.«
Eddie hatte eigentlich nach einem Drink verschwinden wollen, aber Lonergan hatte ihn provoziert, und deshalb hielt er es für klüger, noch zu bleiben. Was hieß, mit Dunellen zu saufen, der dreimal so breit war wie Eddie und obendrein ein Holzbein hatte. Eddie schielte zur Tür, als wollte er Maggie, Dunellens Schreckschraube von Eheweib, herbeizaubern, damit sie ihren Mann aus der Bar schleifte, als wäre dieser ein Hafenarbeiter, der seinen Lohn versoff, und kein lokaler Gewerkschaftsboss mit Ambitionen auf ein Stadtratsamt. Doch Maggie blieb aus, und schließlich grölte Eddie gemeinsam mit Dunellen und anderen, die sich Tränen aus den Augen wischten, den Text von »The Black Velvet Band«. Schließlich verabschiedete sich Lonergan und ging.
»Du magst ihn nicht«, sagte Dunellen – er hätte das Gespräch genauso eröffnet, wenn Eddie zuerst gegangen wäre.
»Er ist in Ordnung.«
»Hältst du ihn für ehrlich?«
»Ich schätze, er spielt sauber.«
»Ja, dafür hast du ein Näschen«, meinte Dunellen. »Du hättest ein Bulle werden sollen.«
Eddie zuckte mit den Schultern, rollte die Zigarette zwischen zwei Fingern.
»Du denkst wie einer.«
»Da hätte ich schon wahnsinnig sein müssen. Und welche Art von Bulle wäre ich wohl geworden?«
Dunellen wandte Eddie die zerklüftete Topographie seines Gesichts zu und sah ihn scharf an. »Liegt der Wahnsinn nicht im Auge des Betrachters?«
»Denke schon.«
»Sie können keine Bullen entlassen, nicht mal während einer Wirtschaftskrise.«
»Da ist was dran.«
Dunellen schien abzuschalten. Seine Versonnenheit verleitete manche Leute dazu, ihn zu unterschätzen oder sich zu viel herauszunehmen – ein Fehler. Er glich den giftigen Fischen, von denen Eddie mal gehört hatte, Fische, die sich äußerlich den Felsen anglichen, um ihre Beute zu täuschen. Eddie wollte sich gerade erheben, da sah Dunellen ihn wieder an, schickte ihm einen feuchten, flehenden Blick. »Tancredo«, stöhnte er. »Dieser beschissene Itaker mischt sich in die Boxkämpfe ein.«
Wenn Eddie auf Dunellens Besessenheit von den Itakern einginge, würde ihn das mindestens dreißig Minuten kosten. »Was machen deine Jungs?«, fragte er, um von dem Thema abzulenken.
Bei der Erwähnung seiner Boxer entspannte sich Dunellens Gesicht wie ein kaltes Steak, das über einer Flamme brutzelte. »Großartig«, murmelte er und winkte zu Eddies Entsetzen nach einer weiteren Runde. »Einfach großartig. Sie sind schnell, sie sind klug, und sie hören zu. Du solltest mal sehen, wie sie sich bewegen, Ed.«
Dunellen war kinderlos, sehr ungewöhnlich in seinem Milieu, in dem der Durchschnittsmann vier bis zehn Sprösslinge hatte. Ob Maggies zänkisches Wesen die Ursache oder das Resultat ihrer unfruchtbaren Ehe war, blieb umstritten. Eines stand aber fest: Hätte Dunellen seine Söhne genauso verhätschelt wie seine Fliegengewichtler (er hatte immer zwei), dann hätten ihn alle verspottet. Wenn sie boxten, krümmte und wand er sich wie eine alte Jungfer, die miterleben muss, wie ihr Schoßhündchen einen Dobermann attackiert. Die grüne Sonnenblende, die er im Ring trug, konnte die Tränen, die seinen kleinen, grausamen Augen entströmten, nicht verbergen.
»Tancredo hat sie im Visier«, sagte er mit bebender Stimme. »Meine Jungs. Er wird es so einrichten, dass sie keine Chance haben.«
Eddie verstand Dunnys Prophezeiung sogar im betrunkenen Zustand: Dieser verteufelte Tancredo, wer auch immer er sein mochte, verlangte Kohle dafür, dass er Dunellens Fliegengewichtler in den Ring, vielleicht sogar gewinnen ließ – gewisse Boxarenen wurden vom Syndikat kontrolliert. Es war ein Handel, wie ihn Dunellen bei jeder Transaktion auf seinen Piers erzwang: Wenn man nicht blechte, war die Arbeitslosigkeit das angenehmste Schicksal, das einem drohte.
»Sie haben meine Eier im Schraubstock, Ed. Diese Itaker. Ich tue nachts kein Auge mehr zu.«
Dunellen glaubte felsenfest, das Itaker-Syndikat sei nicht nur auf Profit und Existenzsicherung aus, sondern verfolge ein höheres Ziel: Die Vernichtung aller Iren. Diese Theorie basierte auf bestimmten Vorkommnissen, die er so unermüdlich durchkaute, als wären es die Stationen des Kreuzwegs: Die Auflösung der Tammany-Gesellschaft durch Bürgermeister La Guardia, das Valentinstag-Massaker in Chicago (sieben tote Iren) und, vor nicht allzu langer Zeit, die Morde an Legs Diamond, Vincent Coll und anderen. Scheißegal, dass alle Toten Killer gewesen waren. Scheißegal, dass das Syndikat nicht nur aus Itakern bestand oder dass Dunellens Erzfeinde durch die Bank auch von der grünen Insel stammten: Bosse rivalisierender Piers, korrupte Personalchefs, Gegner innerhalb der Gewerkschaft – alles Leute, die Dunellen mit freundlicher Unterstützung seiner Schläger jederzeit mir-nichts-dir-nichts verschwinden lassen konnte; bei Tauwetter würden sie dann mausetot und aufgedunsen vom Grund des Hudson River aufsteigen und wie eine Bootsparade auf den Frühlingsfluten dümpeln. In Dunellens Augen nahm die Bedrohung durch das Itaker-Syndikat biblische, ja geradezu kosmische Ausmaße an. Wenn sich Dunellen wieder in seinen Wahn verstieg, bestand die einzige Bedrohung für Eddie meist in tödlicher Langeweile – nur hatte er den heutigen Tag dummerweise in Gesellschaft eines Syndikat-Bosses verbracht.
»Dir geht was durch den Kopf«, sagte Dunellen und schaute Eddie durchdringend an. »Spuck’s aus.«
In dem zerstreuten, angetrunkenen Fleischberg namens John Dunellen flackerte ein übernatürliches Gespür. Es hatte den Anschein, als würde er seine Wahrnehmungen an sein Radio übermitteln, das sie dann verstärkte. Das war der Dunellen, den die meisten Menschen erst zur Kenntnis nahmen, wenn es zu spät war – derjenige, der Gedanken lesen konnte. Wenn man ihn belog, konnte man rasch ins Messer laufen.
»Ja, du hast recht, Dunny«, sagte Eddie. »Ich wäre gern ein Cop geworden.«