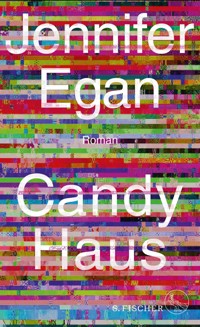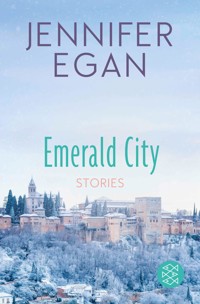12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Achtzig Titanschrauben halten das Gesicht des Models Charlotte Swenson nach einem schweren Autounfall zusammen. Zwar immer noch schön, erinnert nichts mehr an ihr früheres Aussehen. Als sie nach ihrem Krankenhausaufenthalt in ihr Apartment im 25. Stock zurückkehrt, ist sie wie eine Fremde in New York, jener Stadt, die ihr früher die Welt bedeutete. Doch was, wenn die Öffentlichkeit längst von makelloser Schönheit gelangweilt ist und echtes Blut sehen will? Mit erzählerischer Brillanz und satirischer Hellsichtigkeit hinterfragt Jennifer Egan unsere obsessive Image-Kultur und den Maßstab ihrer Werte. Ein kühl hypnotisierender Thriller im Stile David Lynchs über »das irrsinnige Treiben auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten und den blindwütigen Hass derjenigen, die nicht mittanzen dürfen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 791
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jennifer Egan
Look at me
Roman
Über dieses Buch
Achtzig Titanschrauben halten das Gesicht des Models Charlotte Swenson nach einem schweren Autounfall zusammen. Zwar immer noch schön, erinnert nichts mehr an ihr früheres Aussehen. Als sie nach ihrem Krankenhausaufenthalt in ihr Apartment im 25. Stock zurückkehrt, ist sie wie eine Fremde in New York, jener Stadt, die ihr früher die Welt bedeutete. Doch was, wenn die Öffentlichkeit längst von makelloser Schönheit gelangweilt ist und echtes Blut sehen will?
Mit erzählerischer Brillanz und satirischer Hellsichtigkeit hinterfragt Jennifer Egan unsere obsessive Image-Kultur und den Maßstab ihrer Werte. Ein kühl hypnotisierender Thriller im Stile David Lynchs über »das irrsinnige Treiben auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten und den blindwütigen Hass derjenigen, die nicht mittanzen dürfen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Über Autorin und Übersetzerin
Jennifer Egan wurde 1962 in Chicago geboren und wuchs in San Francisco auf. Sie lebt heute mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Brooklyn, New York. Neben ihren Romanen und Kurzgeschichten schreibt sie für den New Yorker sowie das New York Times Magazine und lehrt an der Columbia University Creative Writing. Für ihren Roman »Der größere Teil der Welt« erhielt sie 2011 den Pulitzer Prize, den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize. Zuletzt erschien ihr Roman »Manhattan Beach« (2017), der wochenlang auf der New York Times-Bestsellerliste stand.
Dr. Gabriele Haefs, geboren 1953, studierte Sprachwissenschaft in Bonn und Hamburg. Sie übersetzt aus dem Norwegischen, Dänischen, Schwedischen, Englischen, Niederländischen und Gälischen, u.a. Werke von Jostein Gaarder, Håkan Nesser und Anne Holt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Neuausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Look at me« bei Nan A. Talese, Doubleday, New York
© 2001 by Jennifer Egan
© der deutschen Übersetzung: Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung GmbH, Frankfurt am Main 2002
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: Thomas Krüsselmann
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490778-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
TEIL 1 Doppelleben
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
TEIL 2 Der Spiegelsaal
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
TEIL 3 Das Leben danach
20. KAPITEL
NACHWORT
DANKSAGUNGEN
Zum Gedenken
D.E.E.
W.D.K.
Wir schreiten durch uns selbst dahin, Räubern begegnend, Geistern, Riesen, alten Männern, jungen Männern, Weibern, Witwen, warmen Brüdern. Doch imgrunde uns selbst.
James Joyce, Ulysses
TEIL 1Doppelleben
1. KAPITEL
Nach dem Unfall wurde ich weniger sichtbar. Ich meine das nicht in dem naheliegenden Sinn, dass ich weniger Partys besucht und mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hätte. Oder nicht genau das. Ich meine, dass es nach dem Unfall schwieriger wurde, mich zu sehen.
In meiner Erinnerung hat der Unfall eine schroffe, schwindelerregende Schönheit angenommen: weißes Sonnenlicht, eine langsame Umdrehung in der Luft, wie in der Überschlagschaukel (die ich immer schon geliebt habe), bei der ich spüre, wie mein Körper sich schneller als das entgegenkommende Fahrzeug und auf dieses Fahrzeug zubewegt. Dann ein lauter Blitz, als ich durch die Windschutzscheibe ins Freie geschleudert werde, blutüberströmt, verängstigt und ohne zu begreifen.
Tatsache ist jedoch, dass ich mich an nichts erinnere. Der Unfall geschah in einer Augustnacht, während eines Regengusses, auf einer einsamen Highwaystrecke, die durch Mais- und Sojabohnenfelder führt, ungefähr zwanzig Meilen vor Rockford, Illinois, meiner Heimatstadt. Ich stieg auf die Bremsen, und mein Gesicht kollidierte mit der Windschutzscheibe, worauf ich sofort das Bewusstsein verlor. Auf diese Weise wurde mir der abenteuerliche Anblick erspart, wie mein Wagen von der Straße ins Maisfeld geschleudert wurde, sich mehrere Male überschlug, in Flammen aufging und dann explodierte. Der Airbag blies sich nicht auf; ich hätte den Hersteller natürlich verklagen können, aber da ich meinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, war es vermutlich gut, dass er sich nicht aufblies, sonst hätte er mich vielleicht geköpft, was alles gewissermaßen noch schlimmer gemacht hätte. Die bruchsichere Windschutzscheibe dagegen hielt den Zusammenstoß mit meinem Kopf auf, weshalb ich kaum sichtbare Narben davongetragen habe, obwohl fast jeder Knochen meines Kopfes gebrochen war.
Ich verdanke mein Leben dem, was man einen »barmherzigen Samariter« nennt, jemandem, der mich so rasch aus dem lodernden Wrack zog, dass nur meine Haare versengt wurden, jemandem, der mich sanft am Feldrand ablegte, einen Krankenwagen bestellte, meine Lage präzise beschrieb und sich dann mit einer Bescheidenheit, die mir als pervers erscheint, um nicht zu sagen als unamerikanisch, unerkannt davonstahl, statt sich für diese Heldentaten loben zu lassen. Ein vorüberkommender Autofahrer, der es eilig hatte, oder so.
Der Krankenwagen brachte mich ins Rockford Memorial Hospital, wo ich in die Hände eines gewissen Dr. Hans Fabermann fiel, eines hervorragenden plastischen Chirurgen. Als ich vierzehn Stunden später aus der Bewusstlosigkeit erwachte, saß Dr. Fabermann neben mir, ein älterer Herr mit breitem, muskulösem Kiefer und weißen Haarbüscheln in beiden Ohren, was ich in dieser Nacht allerdings kaum registrierte – ich konnte nämlich so gut wie nichts sehen. Gelassen erklärte Dr. Fabermann, ich hätte Glück gehabt; ich hatte mehrere Rippen, einen Arm und ein Bein gebrochen, hatte aber keine nennenswerten inneren Verletzungen davongetragen. Mein Gesicht befand sich mitten in dem, was er als »goldene Phase« bezeichnete, die Zeit, ehe die »groteske Schwellung« einsetzt. Wenn er sofort operierte, könnte er sich um meine »krasse Asymmetrie« kümmern – nämlich die Tatsache, dass meine Wangenknochen von meiner oberen Schädelhälfte und mein Unterkiefer von meiner »Gesichtsmitte« getrennt waren. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder was mir passiert sein mochte. Mein Gesicht war betäubt, ich sah verwischt und doppelt und hatte ein seltsames Gefühl im Mund, als seien meine Zähne oben und unten gleichermaßen durcheinandergeraten. Ich spürte eine Hand auf meiner und sah, dass meine Schwester Grace neben dem Bett saß. Sie strahlte eine so schreckliche Angst aus, und das erweckte in mir den vertrauten Wunsch, sie zu beruhigen, wie damals, wenn Grace sich während eines Gewitters im Bett an mich kuschelte, im Duft der Zedern, der feuchten Blätter … alles in Ordnung, wollte ich sagen. Jetzt ist die goldene Phase.
»Wenn wir jetzt nicht operieren, müssen wir fünf oder sechs Tage warten, bis die Schwellung zurückgegangen ist«, sagte Dr. Fabermann.
Ich versuchte zu sprechen, zuzustimmen, aber kein beweglicher Teil meines Kopfes mochte sich rühren. Ich stieß so ein ersticktes Gurgeln aus, wie wir es von Gestalten in Filmen kennen, die an ihren Kriegsverletzungen sterben. Dann schloss ich die Augen. Doch Dr. Fabermann hatte offenbar verstanden, denn ich wurde noch in dieser Nacht operiert.
Nach einer zwölfstündigen Operation, bei der achtzig Titanschrauben in meine zerschmetterten Gesichtsknochen eingelassen wurden, um sie zusammenzuhalten und miteinander zu verbinden; nachdem mein Kopf oben vom einen Ohr bis zum anderen aufgeschlitzt worden war, damit Dr. Fabermann die Haut von meiner Stirn schälen und meine Wangenknochen wieder an meiner oberen Schädelhälfte befestigen konnte; nachdem in meinem Mund Einschnitte gemacht worden waren, um meinen Ober- und meinen Unterkiefer zu verbinden; nach elf Tagen, in denen meine Schwester wie ein verängstigter Engel um mein Krankenhausbett flatterte, während ihr Mann, Frank Jones, den ich hasste und der mich hasste, mit meinen beiden Nichten und meinem Neffen zu Hause blieb – wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen.
Ich fand mich an einem seltenen Kreuzweg wieder. Meine Jugend hatte ich mit dem Warten auf eine Gelegenheit verbracht, Rockford, Illinois, verlassen zu können, und hatte gleich die erste genutzt. Ich war nur selten zu Besuch gekommen, zum Kummer meiner Eltern und meiner Schwester, und meine Besuche waren spontan, streitsüchtig und kurz gewesen. In meinem wirklichen Leben, so, wie ich es sah, hatte ich meine Beziehung zu Rockford aktiv verbergen können, ich hatte immer behauptet, aus Chicago zu stammen, wenn ich überhaupt soviel erzählt hatte. Doch sosehr ich mich nach dem Unfall danach sehnte, nach New York zurückzukehren, barfuß über den flauschigen weißen Teppichboden meiner im 25. Stock gelegenen Wohnung mit Blick auf den East River zu tappen, war es durch die Tatsache, dass ich allein lebte, unmöglich. Mein rechtes Bein und mein linker Arm steckten im Gipsverband. Mein Gesicht trat soeben in die »wütende Heilphase« ein, schwarze Blutergüsse zogen sich bis zu meiner Brust hinab, das Weiße in meinen Augen war zu scheußlichem Rot geworden; ich besaß einen geschwollenen Kopf von der Größe eines Basketballs, bei dem sich eine Wundnaht über die Schädelspitze zog (was ein Fortschritt war im Vergleich zu den Klammern, die zuerst dort gesessen hatten). Mein Kopf war teilweise rasiert, und die noch vorhandenen Haare waren angekokelt, stanken und gingen büschelweise aus. Schmerzen waren glücklicherweise nicht das Problem; Nervenverletzungen sorgten für weitgehende Betäubung, vor allem von den Augen abwärts, nur litt ich unter quälenden Kopfschmerzen. Ich wäre gern in der Nähe von Dr. Fabermann geblieben, obwohl er mit der typischen Bescheidenheit des Mittleren Westens meinte, dass ich in New York Kollegen finden könnte, die ebenso gut oder noch besser wären als er. Aber New York war für die Starken, und ich war schwach – so schwach! Ich schlief fast die ganze Zeit. Es kam mir nur richtig vor, meine Schwäche an einem Ort zu pflegen, den ich immer schon mit den Lahmen und den Nutzlosen assoziiert hatte.
Und so, zur Verwirrung meiner Freunde und Kolleginnen zu Hause und zum Kummer meiner Schwester, deren Mann mich nicht unter seinem Dach sehen wollte (nicht, dass ich das ertragen hätte), wurde ich bei einer alten Freundin unserer Eltern untergebracht, Mary Cunningham, die in der Nähe unseres Elternhauses auf dem Ostufer des Rock River in der Ridgewood Road lebte. Meine Eltern waren schon längst nach Arizona übergesiedelt, wo ein Emphysem langsam die Lunge meines Vaters zersetzte und wo meine Mutter inzwischen an die Macht gewisser seltsam geformter Steine glaubte, die sie auf seiner röchelnden Brust verteilte, wenn er schlief. »Bitte, lass mich kommen«, flehte meine Mutter mich am Telefon an, nachdem sie heilende Beutel mit Kräutern, Federn und Zähnen gefüllt hatte. Aber nein, sagte ich, bitte, bleib du bei Dad. »Mach dir keine Sorgen um mich«, bat ich sie, »Grace kümmert sich doch um mich«, und noch in meiner krächzenden fremden Stimme hörte ich eine Entschiedenheit, die mir vertraut war – und meiner Mutter zweifellos auch. Ich würde schon zurechtkommen. Das hatte ich immer schon geschafft.
Mrs. Cunningham war eine alte Frau geworden, seit sie mit dem Besen die Kinder aus der Nachbarschaft weggejagt hatte, wenn die versuchten, das Gewimmel von Goldfischen aus dem trüben Teich in ihrem Hinterhof zu fangen. Die Fische, oder deren Nachkommen, waren noch immer vorhanden, sie tauchten als weißgoldene Flecken zwischen dem Gewirr von Moos und Seerosen auf. Das Haus stank nach Staub und toten Blumen, die Schränke waren vollgestopft mit alten Hüten. Die Gegenwart von Mrs. Cunninghams verstorbenem Mann und ihren Kindern, die jetzt weit entfernt lebten, füllte das Haus noch immer, schlief in der mit Zedernmöbeln gefüllten Mansarde, weshalb sie, eine alte Frau mit Hüftproblemen, trotzdem noch dort lebte und sich die vielen Treppen hochschleppte, während ihre verwitweten, bridgespielenden Freundinnen schon längst in fesche Wohnungen umgezogen waren. Sie steckte mich in einem der Zimmer ihrer Töchter ins Bett und schien diese zweite Mutterschaft zu genießen; sie brachte mir Tee und Saft, die ich aus einer Schnabeltasse trank, streifte mir gestrickte Bettschuhe über die Füße und fütterte mich mit Aprikosenpüree, das ich gierig verschlang. Sie ließ den Gärtnerjungen den Fernseher auf mein Zimmer tragen und legte sich abends auf das Ehebett neben mich, wobei ihre wachsbleichen, von dicken Adern überzogenen Waden unter ihrem gesteppten Bademantel hervorlugten. Zusammen sahen wir uns die Lokalnachrichten an, denen ich entnehmen konnte, dass auch in Rockford Drogengangs die Straßen beherrschten und Schießereien im Vorüberfahren den Alltag prägten.
»Wenn ich da an früher denke«, murmelte Mrs. Cunningham dann, und mit früher meinte sie die Nachkriegsjahre, als sie und ihr Mann Ralph Rockford vor allen anderen Städten in den USA als den idealen Ort erwählt hatten, um sich ein Heim zu schaffen. Zur »wohlhabendsten Gemeinde der Nation« hatte ein vergessener Weiser namens Roger Babson Rockford offenbar salbungsvoll ausgerufen. Mary Cunningham ging sogar so weit, einen verstaubten dicken Band auf mein Bett zu wuchten und mit ihrem krummen, zitternden Zeigefinger auf dieses Zitat zu zeigen. Ich spürte ihre Verbitterung, ihre Empörung über diesen schwerwiegenden Irrtum, der sie nun, in ihrer Einsamkeit, aufgrund von Erinnerungen und Erfahrungen dazu zwang, einen Ort zu lieben, den sie inzwischen verachtete.
Erst nach vier Wochen konnte ich das Haus zu einem anderen Zweck verlassen als dem, meine diversen Gliedmaßen in Graces Wagen zu schleppen und mich zu Dr. Fabermann und seinem Sozius Dr. Pine bringen zu lassen, der sich um meine gebrochenen Knochen kümmerte. Als er meinen Beingips mit Bolzen versehen hatte, die das Gehen ermöglichten, wagte ich mich zum ersten Mal ins Freie, geschützt von einer Sonnenbrille im Zebrastreifengestell, die Mary Cunningham in den sechziger Jahren getragen hatte, um, begleitet von Mary, schwungvoll durch meine alte Nachbarschaft zu marschieren. Ich hatte diesen Teil der Stadt nicht mehr besucht, seit Grace aufs College gekommen war, denn damals hatten meine Eltern im Osten der Stadt, in der Nähe des Interstate Highway, ein kleineres Grundstück und das Pferd Daffodil gekauft, auf dem mein Vater geritten war, solange sein Atem ihm das erlaubte.
Doch jetzt war Ende September; ich hatte die Tage in dem besessenen Glauben gezählt, dass ich nicht wirklich verloren sein könnte, solange ich die Zeit maß. Wir wanderten durch eine warme Brise auf das Haus am Brownwood Drive zu, wo ich mehrere tausend Nächte verbracht und dabei ins Spinngewebe der Ulmen geschaut hatte, die langsam an der Niederländischen Ulmenkrankheit eingingen, wo ich in einem Kellerraum, dessen Betonboden von orangefarbenen Plastikplanen bedeckt war, Schallplatten gehört hatte, wo ich im Ballkleid vor dem Spiegel gestanden hatte, während meine Mutter an den Blütenblättern aus Kunstseide herumzupfte – und an das ich trotz allem kaum noch gedacht habe, seit ich es verlassen hatte. Und da stand nun das Haus: flach, im Farmhaus-Stil, bedeckt mit gelben Ziegeln, die von außen aufgeklebt worden sein mussten, während ein Viereck aus frischem grünen Rasen wie eine Serviette unter seinem Kinn saß. Dieses Haus unterschied sich so wenig von zehntausend anderen in Rockford, dass ich mich zu Mary Cunningham umdrehte und sagte: »Bist du sicher, dass es das richtige ist?«
Sie machte ein verwirrtes Gesicht, dann lachte sie, sicher beim Gedanken daran, dass ich im Moment noch schlechter sah als sie und dass ich mit Schmerzmitteln zugedröhnt war.
Und doch, als wir uns umdrehten, um zurückzugehen, sah ich plötzlich ein Bild vor mir, bei dem es sich wohl um eine Erinnerung handelte: dieses Haus vor dem frühen Morgenhimmel, als ich von Ellen Metcalfs Haus, wo ich die Nacht verbracht hatte, darauf zulief. Das Gefühl, es dort zu sehen – mein Haus, mit allem, was ich kannte. Die Erinnerung traf mich wie ein unerwarteter Schlag oder wie ein Kuss. Ich kniff die Augen zu, um mich davon zu erholen.
In der folgenden Woche humpelte ich auf Krücken zum Rock River, auf dessen Ostufer ein Park und ein Pfad für Jogger dahinmäandern. Ich starrte den Pfad hungrig an und sehnte mich nach einem Besuch im weiter nördlich gelegenen Rosengarten mit dem Ententeich, doch ich wusste, dass ich dazu noch nicht stark genug war. Statt dessen ging ich in die Telefonzelle auf dem Parkplatz neben dem YMCA, um meinen Anrufbeantworter abzuhören, weil das mit Mrs. Cunninghams Telefonen nicht ging.
Der Unfall lag inzwischen sieben Wochen zurück, und die Nachricht, die meine Schwester auf meinen Wunsch auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen hatte und die von meiner Notlage berichtete, ohne zu verraten, dass ich mich nicht in meiner Wohnung aufhielt – denn sie sollte nicht ausgeraubt werden, das hätte mich nun wirklich fertiggemacht –, hatte einen Strom von Mitteilungen besorgter Bekannter ausgelöst, die Grace pflichtbewusst aufbewahrt hatte. Doch einige hatte sie noch nicht aufgenommen. Eine stammte von Oscar, meinem Agenten, der durch eine Polyphonie von klingelnden Telefonen, die mir jetzt wie aus einer anderen Welt erschienen, hindurch schrie: »Wollte nur mal nach dem Rechten sehen, Herzchen. Melde dich, wenn du die Gabe der Rede wiedererlangt hast.« Er habe jeden Tag angerufen, erzählte meine Schwester. Oscar liebte mich heiß und innig, obwohl ich meiner Agentur Femme schon seit Jahren kaum noch etwas eingebracht hatte.
Der zweite Anruf stammte von einem gewissen Anthony Halliday, der sich als Privatdetektiv ausgab. Grace hatte bereits zwei Nachrichten von ihm aufgenommen. Da ich noch nie mit einem Privatdetektiv gesprochen hatte, wählte ich seine Nummer aus purer Neugier.
»Detektei Anthony Halliday«, eine unsichere, fast kindliche weibliche Stimme. Kein Profi, dachte ich, eine Aushilfe. »Er ist im Moment nicht im Haus«, sagte sie. »Kann ich ihm etwas ausrichten?«
Ich wollte Mary Cunninghams Telefonnummer nicht hergeben, vor allem, weil sie eine freundliche alte Dame war und nicht meine Sekretärin, und weil die Vorstellung, dass New York und seine Bewohner in ihr Mausoleum von Haus einfallen könnten, pervers und unvorstellbar wirkte. »Ich würde lieber noch einmal anrufen«, sagte ich. »Wann kann ich ihn am besten erreichen?«
Sie zögerte. »Kann er Sie wirklich nicht zurückrufen?«
»Hören Sie«, sagte ich. »Wenn er mit mir sprechen …«
»Er ist – äh, in der Klinik«, sagte sie rasch.
Ich lachte. Mein erstes echtes Lachen seit dem Unfall. Sofort tat mein Hals weh. »Sagen Sie ihm, dass wir dann schon zu zweit sind«, kicherte ich. »Schade, dass wir nicht in derselben Klinik liegen, dann könnten wir uns im Foyer treffen.«
Sie lachte nervös. »Ich glaube, das mit der Klinik durfte ich nicht sagen.«
»Es ist keine Schande, in der Klinik zu liegen«, versicherte ich ihr voller Überzeugung. »Es sei denn, es handele sich um eine psychiatrische Klinik …«
Tiefes Schweigen. Anthony Halliday, ein Privatdetektiv, mit dem ich noch nie gesprochen hatte, befand sich in einer psychiatrischen Klinik.
»Vielleicht nächste Woche?« fragte sie zaghaft.
»Ich melde mich.«
Doch schon, als ich zu Mary Cunningham zurückhumpelte, spürte ich, wie dieser Entschluss mir entglitt wie die Listen, die wir vor dem Einschlafen machen.
An diesem Abend kam Grace zu Besuch und zog sich einen Stuhl zwischen die beiden Betten, wo Mary Cunningham und ich es uns wie üblich gemütlich gemacht hatten und New York Police Department Blue sahen. Als ein Mann mit einem blutig geschlagenen Gesicht in eine Zelle geschoben wurde, hielt Grace sich die Augen zu und bat mich, den Sender zu wechseln. »Mach du das«, erwiderte ich. »Ich bin hier die Invalidin.«
»Tut mir leid«, sagte sie und ging lammfromm zum Fernseher – vermutlich einem der letzten auf der Welt, die per Hand bedient wurden. »Ich sollte nicht diejenige sein, die hier weint.«
»Du weinst für uns beide«, sagte ich.
»Es kommt mir nur so komisch vor, dass du nach Rockford gekommen bist, ohne mir Bescheid zu sagen«, schmollte sie und ließ die Sender durchlaufen. Sie hatte das schon ein dutzendmal gesagt, vermutlich in dem Glauben, dass ich unfallfrei eingetroffen wäre, wenn sie nur gewusst hätte, dass ich unterwegs war. Und sosehr ich diese Art von Fragen auch hasste (um ehrlich zu sein, hasste ich alle Fragen), waren sie mir doch sehr viel lieber als das Thema, das Grace nicht anzuschneiden wagte: wie würde ich wohl aussehen, wenn das hier alles vorüber wäre? Und was sollte dann aus mir werden?
»Ich wollte dich überraschen«, sagte ich.
»Meine Güte, und du kannst dich noch immer nicht erinnern, was passiert ist«, staunte Mary Cunningham. »War da ein Tier auf der Straße, Liebes, oder warst du müde? Bist du vielleicht für einen Moment eingenickt?«
»Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern«, sagte ich. Aus irgendeinem Grund hielt ich mir die Ohren zu.
»Sie hatte immer schon ein lausiges Gedächtnis«, sagte Grace.
Das stimmte – ich hatte ein lausiges Gedächtnis, und an Rockford konnte ich mich am allerwenigsten erinnern. Und doch trieben Langeweile und Stillstand meiner derzeitigen Lebensumstände mich dazu, auf dieselbe planlose Art und Weise zurückzublicken, in der ein Mensch in einem alten Haus am Ende auf dem Dachboden auftaucht und einige Kartons öffnet. Bisweilen hatte ich das Gefühl, in frühen Kindheitserinnerungen an Rockford zu ertrinken: an eine weiche, sinnliche Welt aus klebrigem grünen Rasen und heftigen Gewittern, aus Bergen von glitzerndem Schnee im Winter. In meiner frühen Jugend hatte ich in der Schule eine Hausarbeit über Rockfords industrielle Leistungen verfasst und dazu in der Stadtbücherei alles über einen mechanischen Kornbinder, eine Strickmaschine für nahtlose Socken, das geölte »Universalgelenk«, dessen Zweck ich vergessen habe, über die »Seite-an-Seite«-Kombination aus Schreibtisch und Bücherregal, über Mähdrescher und ihre Bestandteile gelesen. Ich erinnerte mich daran, dass ich voller Spannung immer weiter las, in Erwartung des Moments, in dem Rockford im Triumph hervortreten würde, beneidet von der ganzen industrialisierten Welt. Ich sah diesen glorreichen Moment durch die Erfindung des Automobils näher rücken, denn elf Firmen aus Rockford hatten Autos entwickelt, und eine, die Tarkington Motor Company, hatte einen Prototyp vorgestellt, der in den zwanziger Jahren auf einer Automobilausstellung in Chicago großen Applaus geerntet hatte. Aber nichts da – die Investoren hatten sich zurückgezogen, der Wagen war niemals in Produktion gegangen, und angesichts dieses Fehlschlags gerann meine Erregung zu etwas Schwererem. Es sollte keine Scheinwerfer geben, Rockford sollte eine Stadt bleiben, die bekannt war wegen ihrer Bohrmaschinen, ihrer Antriebswellen, ihrer Gelenke, ihrer Sägen, wasserdichten Verschlüsse, Zündkerzen, Dichtungsringe – »Autozubehör«, wie diese Dinge heißen; und wegen ihrer Landmaschinen, kurz gesagt, wegen langweiliger, unsichtbarer Dinge, die kein Mensch auf der Welt kannte oder jemals interessant finden würde.
Nachdem ich zwei Tage lang gelesen hatte, wanderte ich von der Bücherei in die leere »Innenstadt«, die auf dem anderen Flussufer unserem Haus gegenüberlag, denn fast aller Handel war in die Einkaufszentren auf dem Ostufer verlegt worden, in die Nähe des Interstate. Meine Mutter hupte auf dem Parkplatz auf der anderen Straßenseite. Aber ich blieb einen Moment stehen, ich umklammerte meine Büchertasche und ließ mich von Kleinheit und Magerkeit dieses vergessenen Ortes erfüllen. Rockford, das sah ich jetzt, war eine Stadt der Verlierer, ein Ort, der dem Ruhm niemals nahe gekommen war, obwohl er das wieder und wieder versucht hatte. Ein Ort, den Mechaniker wegen seines Universalgelenks priesen, war keiner, an dem ich bleiben konnte. Das erkannte ich schon mit zwölf Jahren, es war mein erster klarer Moment der Selbsterkenntnis. Ich war nicht Rockford – ich war sein Gegenteil, was immer das sein mochte. Ich erkannte das alles, als ich vor der Stadtbücherei auf der Straße stand. Dann überquerte ich die Straße und stieg zu meiner Mutter ins Auto.
Mein Vater war Elektriker, ein Mann, der durch die Mauern zu den dahinter verborgenen Stromkreisen durchdrang, einer, der mit seinen Fingern Drähte flocht und die Lichter angehen ließ. Als Kind hatte ich seiner Arbeit Zauberkräfte zugeschrieben und mich mit Halsketten geschmückt, die er aus Schrauben, Unterlegscheiben und bunten Drähten hergestellt hatte. Aber nach der Bücherei erschien mir die Aussicht auf das Leben meines Vaters – und das meiner Mutter – klein, ernst und sinnlos zu sein, zu tief berührt von diesem Ort, an dem sie beide ihr Leben verbracht hatten. Ich wuchs heran mit dem Wunsch, von dort fortzugehen. Und Grace klammerte sich derweil an mich, denn sie wusste, dass ich gehen und sie bleiben würde.
Und hier saß ich nun wieder in Rockford und stritt mich mit meiner Schwester darüber, wer einen anderen Fernsehsender einschalten sollte, während mein Kopf voller Titanbolzen und Schrauben war, die durchaus hier hätten erfunden sein können. Ich fand das auf düstere Weise komisch, eine der kleinen Ironien des Lebens.
»Die Mädchen möchten dich so gern sehen«, sagte Grace, um unsere permanente Diskussion über meine Nichten wiederzubeleben. »Bitte, lass sie doch herkommen.«
»Sie bilden sich ein, dass sie mich sehen möchten«, korrigierte ich.
»Charlotte, hör doch auf damit«, sagte sie und drückte mir die Hand. »Sie lieben dich so sehr.«
»Noch nicht.«
Nicht, dass ich Allison und Pammy nicht hätte sehen wollen. Im Gegenteil, nur zu gern hätte ich an ihrem zerzausten Haar geschnuppert und gespürt, wie sie gegen mich stießen, wie Kinder das ganz spontan tun. Doch für sie war ich die aufregende Tante Charlotte, das Model, das sie manchmal entdeckten, grinsend, eine Hand auf eine Hüfte gestemmt, in Katalogen, die unaufgefordert in ihren Briefkästen landeten (denn so tief war ich inzwischen gesunken), oder das durch den Hintergrund einer Tampaxwerbung wanderte. Das Model, das auf Coney Island Cyclone Deos empfahl: (Das! Ist! Stress!), das in hohen Wasserstiefeln die Angelrute schwenkte und die Verdienste eines pilzverhindernden Fußpuders anpries. Ich war die Brünette mit dem Koboldgesicht, die sich wie von einem Baum gefallen auf einem Buick fläzte. Die mit der Brille, die errötend das Trauma schilderte, bei einer Aufsichtsratssitzung einen Wind gelassen zu haben. Die ihrem sommersprossigen Sohn mit Vitaminen angereichertes Müsli aufzwang. Das alles war ich eben auch. Es war etwas ganz anderes als die transzendente Existenz, die ich mir einst ausgemalt hatte. Aber für meine kleinen Nichten verkörperte ich einen mythischen Aufstieg.
Ich wollte sie in Frieden an mich glauben lassen, sagte ich mir, ungehindert von meinem derzeitigen grotesken Äußeren. Ich hätte mich geschämt, wenn sie mich gesehen hätten.
Eines Nachmittags ging ich zum Cedar-Bluffs-Friedhof und pflanzte mein Hinterteil auf einen Grabstein, der der Stelle, an der ich immer mit Ellen Metcalf gesessen hatte, so nahe kam, wie ich mich überhaupt erinnern konnte. Ich steckte mir eine Merit an, meine erste seit dem Unfall, und schlug damit Dr. Fabermanns Warnung in den Wind, Rauchen könne die Heilung der Knochen verzögern. Vor und manchmal auch nach dem Abendessen hatten Ellen und ich uns an diese Grabsteine gelehnt, unter uns Legionen von toten Schweden, von Olsens, Lofgrens, Larsens, Swensons wie mir selber, und hatten Kool geraucht, was wir für ein Gegenmittel gegen die sommerliche Hitze gehalten hatten. Wir hatten über den Verlust unserer Jungfräulichkeit gesprochen – nein, nicht über den Verlust, nicht über die Glücklosigkeit, die in diesem Wort lag, denn in einem Feuer der Ekstase wollten wir sie hergeben, das uns für immer verändern sollte.
Ich versuchte, mich an den Klang von Ellens Stimme zu erinnern. Aber das ging nicht, so, als sei sie eine Phantasiefreundin gewesen, eine Projektion meiner selbst. Einmal waren wir von der East High School den ganzen Weg zu der Apotheke neben dem Piggly Wiggly gegangen, um dort vor den Kinderspielzeugen aus Plastik stehenzubleiben. Und um dann festzustellen, als wir einander fragend anschauten, was wir hier eigentlich wollten, dass keine von uns das wusste, dass wir uns einfach nur gegenseitig gefolgt waren.
Nach dem nächsten Besuch beim Arzt bat ich Grace, an der East High School vorbeizufahren. Einem ziemlich großkotzigen Gebäude, so kam es mir jetzt vor, riesig und senffarben, mit Hunderten von gekippten Fenstern, die im Sonnenlicht funkelten. Als ich vor der breiten, leeren Treppe stand, kam mir eine andere Erinnerung: die, als ich Ellen Metcalf zum erstenmal außerhalb der Schule gesehen hatte, ein Mädchen mit olivbrauner Haut und langen schwarzen Haaren. Wie sie dort stand, exotisch, allein, und wie sehr ich mir gewünscht hatte, so zu werden wie sie – dieses Gefühl überkam mich mit aller Macht. Später erzählte mir Ellen, welchen Eindruck ich auf sie gemacht hatte: »Ich wusste sofort, dass du nicht hierhergehörtest.« Das größtmögliche Lob.
Ihr Vater hatte eine Firma, die Düngemittel herstellte, ihre Mutter war eine Halbinvalidin, eingeschlossen in einem verdunkelten Elternschlafzimmer, verzehrt von einer Krankheit, deren genaue Beschaffenheit niemand so recht zu kennen schien. Sie lebten in einem geräumigen Haus, das nur wenige Blocks von meinem viel kleineren entfernt war. Ellen existierte in einem Zustand einsamer Erhabenheit, wie das letzte überlebende Mitglied irgendeiner königlichen Familie; ihr Bruder Moose war ein Jahr zuvor auf die Universität von Michigan gegangen. Ich wusste allerlei über Moose. Er war einer dieser High School Boys, deren sportliche und romantische Heldentaten die weiblichen Teenager zu epischer Dichtung inspirieren, die dann in ihrer Abwesenheit sehnsuchtsvoll rezitiert wird. Ich war ihm nur einmal begegnet, für einen kurzen, erregenden Moment, an einem Sommernachmittag, als ich auf dem Rasen vor unserem Haus Golf übte und mit dem Schläger einen Sprenger-Kopf traf, was einen offenen Mustang, der gerade vorüberfuhr, mit einem wilden Sturzbach füllte. Der Fahrer sprang heraus, er schüttelte das Wasser aus seinen langen Haaren; ein älterer Junge, sonnengebräunt in einem makellosen weißen T-Shirt, der über den Rasen schlenderte wie jemand, der sich in seinem ganzen Leben noch nicht beeilt hatte. Als ich meine Entschuldigungen stotterte und dabei versuchte, das schäumende Crescendo des Wassers mit meinem Fuß aufzuhalten, schaute er sich im Garten um und fragte: »Wasserhahn ist wo, hinter der Hecke? Stell mal ab und lass mich nachsehen.«
Als ich diesen Auftrag ausgeführt hatte, hatte er den Sprenger-Kopf auseinandergenommen und schüttelte die rostigen Bestandteile in seiner Hand wie Würfel. Er war so darin vertieft, dass ich ihn genauer ansehen konnte; einen wunderbaren Jungen voller Selbstvertrauen, dessen Anziehungskraft von seiner Neandertaler-Kopfform auf seltsame Weise noch betont wurde. Zwanzig Minuten später hatte er den Sprenger-Kopf repariert, war zu seinem Wagen zurückgeschlendert und mit einem Winken davongefahren, und erst dann kam ein älteres Mädchen von gegenüber angestürzt und teilte mir atemlos mit, in wessen göttlicher Gesellschaft ich mich da befunden hatte.
Doch Moose war nicht mehr da. Ellen war allein, zurückgelassen an einem Ort, der ihr ebenso trostlos vorkam wie mir. Alles Gute war aus dieser lausigen Stadt verschwunden, dieser Heimat der Mähdrescher und der Kugellager, und uns blieb nichts anderes übrig, als die wenigen verbliebenen Amüsements auszukosten. Wir sprachen über unsere Lust – wo genau in uns die ihren Sitz hatte; in unserem Magen, glaubten wir, obwohl Ellen sagte, sie spüre sie auch hinten im Mund.
Im Oktober entfernte Dr. Pine die letzten Gipsreste von meinem Leib. Als Mary Cunningham ihren Hof harkte, trottete ich mit einer Tube voll grünem Gift hinter ihr her, schob deren Rüssel in das Auge jeglichen Unkrauts, das ich entdecken konnte, und drückte zu. Rockford war gerade besessen von der Sucht nach Laubsäcken mit Kürbisgesichtern; auf jeder Rasenfläche thronte mindestens ein grinsender, mit Blättern gemästeter orangefarbener Sack. Während ich Jagd auf das Unkraut machte, versuchte ich, mich an alle meine sexuellen Beutestücke aus jenem Schuljahr mit Ellen zu erinnern. Jeff Heinz: ein schüchterner, kräftiger Footballspieler, dessen elegante Bewegungen ihn schon von der ganzen nachlässigen Spielerbande auf dem Platz unterschieden. Jeff und ich besuchten denselben Chemiekurs, und ich konnte mich in die Rolle der Laborpartnerin einschleichen, indem ich dicht an ihn herantrat und sein Handgelenk streifte, während wir uns angesichts der Becher voller bunter Flüssigkeiten den Kopf zerbrachen. Das war alles. Ellen hatte derweil einen Freund an Land gezogen, Michael Ippen, mit dem sie es wohl bald machen würde. Also gab ich Jeff Heinz auf, der es bis zur Brown University brachte (ein ungewöhnlicher Schritt für einen Jungen aus Rockford), von wo ein oder zwei Jahre später die aufregende Nachricht durchsickerte, er sei schwul. Ich hätte gern mit Ellen darüber gekichert, aber inzwischen redeten wir nicht mehr miteinander.
Benji Gustafsen: blond, reizend, Waschbrettbauch, dessen ganze Intelligenz sich offenbar zu seiner Fähigkeit bündelte, kleine uralte Gegenstände zu reparieren – Dosenöffner, Toaster, Staubsauger. Für Benjis Freunde und Nachbarn war das ein großer Vorteil, nicht jedoch für diejenigen, die versuchten, mit ihm ein Gespräch zu führen. Aber es ging mir ja nicht um Gespräche, und ich verlor meine Jungfräulichkeit an Benji in seiner schmuddeligen Kellerwerkstatt, nur zwei Tage, nachdem Ellen ihre auf dem quietschenden Bett von dessen Bruder an Micheal Ippen verloren hatte.
Wir wischten den Schnee von unseren Lieblingsgrabsteinen und hockten in der frühen Dunkelheit in unsere Parkas gewickelt da, mit Blick nach Westen, auf die Autobahn, die sich am Rock River dahinzog.
»Das Bett hatte eine kratzige Decke«, sagte Ellen.
»Auf dem Boden lagen haufenweise McDonald’s-Tüten«, sagte ich. »Es stank wie Katzenpisse.«
»Hat es weh getan?«
»Wie die Hölle. Und ich hab geblutet.«
»Bei der ganzen Katzenpisse«, sagte sie, »ist ihm das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.«
Wir reichten unsere letzte Kool hin und her. Ellen rutschte vom Grabstein und legte sich auf dem Rücken in den Schnee.
»Wird dein Kopf nicht kalt?« fragte ich.
»Ja«, sagte sie. »Aber die Sterne!«
Ich legte mich neben sie. Sie hatte recht, die Sterne. Nachdem ich es mit Benji getan hatte, fragte ich mich plötzlich voller Entsetzen – wer ist dieser Typ eigentlich, der sich wie ein Hund reckte, bis seine Knochen knackten? Aber dann dachte ich an Ellen, wie ich es ihr erzählen, wie ich mich ausdrücken würde, und das Entsetzen gerann zu einer Art Zuneigung.
Marcus Sealander: ein tätowierter Motorradfahrer, dessen gefährlich aussehende Lederweste ausgerechnet einen Schmerbauch verbarg. Wir machten es im Stehen. Marcus hatte die unangenehme Angewohnheit, meine Schultern gegen die Mauer zu knallen, als errege es ihn, sich vorzustellen, wie mein Rückgrat zerbrach, weshalb er keine zweite Chance bekam. Ellen machte es derweil zweimal mit Louis Gasto, einem seltsamen Jungen, der mit Flüssigklebstoff Hunderte von Bierdosen an die Wand des elterlichen Musikzimmers gepappt hatte. Sie machten es unten, zwischen den Dosen, und Ellen hatte beim ersten Mal den Eindruck, sie könne möglicherweise, ganz eventuell, etwas dabei empfinden, doch dann hatte Louis sich von ihr gewälzt und stand laut pissend im Badezimmer, und damit war der Fall erledigt. Das zweite Mal war noch schlimmer gewesen – vorbei in glatten vier Minuten.
Tom Ashlock. Lenny Bergstrom. Arthur Blixt. Stephen Finn. Im Frühling galten wir als Nutten, als Sirenen, die Mädchen und Jungen gleichermaßen erschreckten, als wir vergeblich jemanden suchten, der uns befriedigen könnte. Als an diesem Weihnachtsfest Moose nach Hause kaum, verließ Ellen mich, um diesem heiligen Stern zu folgen; eine brutale Enttäuschung, da ich gehofft hatte, an seiner Gesellschaft teilhaben zu dürfen. Drei einsame Wochen lang bekam ich sie kaum zu sehen. Mooses Abreise nahm ihr zunächst allen Lebensmut, doch dann schlug die Alchimie zwischen uns wieder zu, und wir planten unsere Errettung aus der erdrückenden Banalität, die uns umgab wie diese schrumpfenden, mit Wasser gefüllten Kammern, aus denen Fernsehhelden entkommen mussten. Die Straßen, der Himmel, der miese Mond. Was war bloß los mit diesen Jungs?
Jungs. Wir rollten uns auf die Seite und starrten einander zwischen den Grabsteinen an. Der Schnee war geschmolzen und gab ein Pappmaché aus dem verfaulten Laub des letzten Jahres preis. Uns kam eine Erkenntnis: das Problem waren die Jungs – zu jung, zu unerfahren, um uns das empfinden zu lassen, wonach wir uns sehnten und worauf wir einen Anspruch hatten; Männer dagegen, mit ihrer jahrelangen Erfahrung, die würden genau wissen, was sie zu tun hatten. Und Männer zu finden könnte nicht so schwer sein: Mr. Polhill, Ellens Fahrlehrer, beugte sich dauernd über ihren Tisch und schnupperte an ihren Haaren, und ich … wie alt er wohl sein musste?
»Alt«, sagte Ellen. »Über dreißig.«
Im Sommer des Vorjahres hatte ich einen Mann dabei ertappt, wie er mich am Swimmingpool des Country Club beobachtete. Ein Ausländer – Franzose, glaube ich, der einen engsitzenden kleinen Badeanzug trug, wie die Jungs aus unserer Schwimm-Mannschaft. Ich hatte ihn damals unangenehm gefunden, aber jetzt änderte ich meine Meinung: er war Franzose, er war ein Mann, er war perfekt.
Mr. Polhill bot galant seinen Privatwagen an, als Ellen ihn nach der Schule um eine zusätzliche Fahrstunde bat, danach schlug er einen kleinen Umweg vor. Mehr wollte sie mir nicht erzählen. Sie war von einer Verschlossenheit, wie ich sie bei ihr nie erlebt hatte; ich wartete auf dem Friedhof, aber sie kam nicht, und als ich sie in der Schule stellte, wollte sie sich nicht äußern.
Ich dagegen konnte, durch eine Freundin meiner Mutter, die Mrs. Lafant kannte, die Frau aus Rockford, die mit dem Franzosen verheiratet war, für Freitagabend bei ihm einen Posten als Babysitterin bekommen, wo zwei Gören das engsitzende, tief ausgeschnittene Kleid, das ich zu Mr. Lafants Erbauung angezogen hatte, mit Eiscreme bekleckerten. Als er mich später nach Hause fuhr, rutschte ich auf dem Vordersitz ganz dicht heran. Er schien es nicht glauben zu können. »Du bist ein wunderbares Mädchen«, hauchte er vorsichtig mit seiner phantastischen Aussprache. Als ich noch weiter an ihn heranrückte, streichelte er meine Haare, und ich schloss die Augen und machte sie erst wieder auf, als ich merkte, wie schnell Mr. Lafant plötzlich fuhr. Mit kreischenden Bremsen kam er irgendwo in der Nähe der Spring Creek Road zum Stehen, würgte den Motor ab und schaltete die Scheinwerfer aus. Ich brauchte einige Minuten, um mich an die Dunkelheit zu gewöhnen, und dann entdeckte ich Mr. Lafants erigierten Penis, der sich aus seinen Hosen herauskämpfte wie ein Maulwurf aus einem Tunnel. Seine Hand, die Sekunden vorher noch zärtlich meine Haare gestreichelt hatte, schob jetzt meinen Kopf reichlich energisch darauf zu. Ich hatte Angst. Seine offenkundige Eile machte alles noch schlimmer; als ich mich zappelnd widersetzte, packte er meinen Hinterkopf und drückte mich weiter nach unten, wobei er (auch das fiel mir auf) auf seine Uhr schaute, zweifellos, um zu berechnen, wieviel Zeit ihm noch blieb, ehe seine Frau sich Gedanken machen würde. Eine Welle des Ekels durchfuhr mich. »Nein«, kreischte ich. »Nein, nein«, worauf mein Arbeitgeber in Panik geriet. »Sei still«, flehte er und schob den neugierigen Penis außer Sichtweite. In drückendem Schweigen fuhr er mich nach Hause; in seinem Gesicht zuckte ein wütender Muskel. Ich sprang aus dem Wagen, und er jagte wortlos davon, wobei seine Reifen in unserer stillen Straße zu kläffen schienen.
Ich wäre ja sofort zu Ellen hinübergestürzt, doch meine Mutter hatte den Wagen gehört und stapfte in Pantoffeln und Schlafrock auf den Rasen. »Das war aber nicht nett von ihm«, erklärte sie. »Er hätte warten müssen, bis du im Haus bist.«
Am nächsten Morgen stand Ellen schon vor der Tür ihres großen leeren Hauses und führte mich mit demselben gleichgültigen Blick nach oben, den sie die ganze Woche hindurch gezeigt hatte. Im Fernsehen lief die Lucille-Ball-Show.
»Also, hast du es gemacht?« fragte sie, ohne den Fernseher aus den Augen zu lassen.
»Er wollte nicht«, sagte ich. »Ich sollte ihm einen blasen.«
Jetzt wandte Ellen sich mir voller Interesse zu.
»Das konnte ich nicht«, gab ich zu. »Es war einfach ekelhaft.« Dann fragte ich instinktiv: »Wollte Mr. Polhill … das auch?«
Ellen brach in Tränen aus. Ich hatte sie noch nie weinen sehen und stand jetzt ganz dicht vor ihr, fast hätte ich sie in den Arm genommen, wie ich das mit Grace machte, wenn die weinte, aber ich zögerte. Ellen war nicht wie Grace. »Hast du es gemacht?« flüsterte ich.
»Ich hab’s versucht«, sagte sie, »aber nach ungefähr drei Sekunden, da ist er … du weißt schon, er …«
»Nein! Nein!«
»In meinem Mund«, schluchzte sie.
»O mein Gott!«
»Und dann habe ich mich erbrochen. Über ihn und das ganze Bett.«
Ich schwieg angesichts dieser entsetzlichen Szene, die ich deutlich vor mir sah, doch zugleich fand ich das alles auch auf seltsame Weise komisch. Mein Mund verzog sich ganz von selbst zu einem Lächeln, worauf Ellens Weinen in Lachen umschlug, in hysterisches Lachen, während ihr noch immer die Tränen über die Wangen liefen. Ich lachte jetzt ganz offen und teilte Ellens zwerchfellerschütternde Heiterkeit, bis ich dann auch in Tränen ausbrach. »Das muss doch tödlich für ihn gewesen sein«, schluchzte ich.
»Er ist ins Badezimmer gestürzt und hat die Tür abgeschlossen«, sagte sie, und wir krümmten uns vor Lachen und machten uns (wie sich später herausstellte) beide dabei die Hosen nass.
Nachdem wir geduscht und uns umgezogen und unsere Jeans und Unterwäsche in Ellens Waschmaschine gestopft hatten, steckten wir drei Old Styles in eine Tasche und gingen damit und einem Päckchen Kool auf den Friedhof. »Vergiss die Männer«, sagte Ellen. »Die sind doch alle pervers.«
»Die Guten machen es nicht mit uns«, stimmte ich zu. »Die wollen es nur mit ihren Frauen.«
Wir tranken das bittere kalte Bier. Es war so warm, dass wir keine Jacken mehr brauchten. Wir waren frisch und sauber, doch von irgendwo in uns – oder von unter uns, so kam es uns fast vor, von den toten Schweden – kam ein geradezu greifbares Gewicht. Das Gewicht unserer Langeweile, unserer Ungeduld.
»Ich weiß die Antwort«, sagte Ellen, aber ohne die Begeisterung, die unsere früheren Inspirationen begleitet hatte.
»Was?«
»Moose.«
Moose. Er würde noch diesen Monat, erzählte sie, für die Sommerferien von der Universität von Michigan herüberkommen, zusammen mit drei Freunden. Er würde einige Wochen lang mit diesen Freunden Feste feiern und Wasserski laufen und dabei das Getriebe seines geselligen Lebens neu ölen, ehe er für den Rest des Sommers in der Fabrik seines Vaters arbeitete. Und die Freunde wären zweifellos die feinsten Exemplare, die die Universität von Michigan oder überhaupt eine Universität zu bieten hätte. Keine Männer, keine Knaben. Erfahren, aber nicht pervers.
Und doch fand ich die bloße Vorstellung einer weiteren sexuellen Unternehmung ermüdend, trotz der heldenhaften Anziehungskraft von Ellens Bruder und seiner geheiligten Tafelrunde. Außerdem hatte ich Angst, Ellen nach seiner Rückkehr wieder zu verlieren, wie zu Weihnachten.
An seinem ersten Samstag zu Hause lugten wir durch den Gitterzaun des Country Club zum Fluss hinüber, wo Moose und seine Freunde – Marco, Amos, Todd – nacheinander durch das bräunliche Wasser huckelten, jeweils angekündigt vom Aufheulen von Mooses Bootsmotor. Selbst auf diese Entfernung bot Ellens Bruder einen hinreißenden Anblick: ein durchtrainierter, athletisch aussehender Mann in leuchtend grüner Badehose, bei weitem der beste Wasserskiläufer der Gruppe. Aber er fuhr am wenigsten, er feuerte die anderen lieber vom Steuer seines Bootes aus an.
»Welchen willst du?« fragte Ellen.
»Mit oder ohne Moose?«
Sie musterte mich mit einem seltsamen Blick und schüttelte dann energisch den Kopf. »Marco«, sagte ich kleinlaut.
»Ich nehme Todd«, sagte Ellen, was mich verwirrte, er war der bleichste der drei, eckig und adrett, auf eine Weise, die mich an meinen Vater erinnerte.
Moose wollte an diesem Abend auf eine Party in einer der großen Villen an der National Avenue, im Norden der Innenstadt; Ellen und ich wollten dort auftauchen, es mit den Männern unserer Wahl irgendwo im Haus machen und uns danach am Swimmingpool des Country Club treffen.
Die Party verlief in enttäuschender Routine: Tom Petty, der die Anlage irgendeines Vaters überanstrengte, und eine Bande von betrunkenen, grölenden Typen, die älter als unsere Klassenkameraden waren, sich ansonsten aber nicht von denen unterschieden. Endlich konnte ich Moose wieder aus nächster Nähe beobachten, in der Küche, wo er und ein anderer versuchten, mit Topfschwämmen den Inhalt einer Konservendose vom klebrigen Linoleum zu entfernen. Moose war eine überwältigende Erscheinung, seine breiten Schultern bewegten sich unter seinem weißen T-Shirt wie die Tasten eines Klaviers, als er seinem Gegner mit geschickter Schwammarbeit das Katzenfutter wegnahm; seine Unterarme waren glatt und sonnenbraun, sein Aussehen eine hinreißende Mischung aus Schönheit, Verruchtheit und vager Verlegenheit. Und von noch etwas anderem: dem Bewusstsein – seines eigenen und dem aller anderen, der vielen Bewunderer, die sich im Raum zusammenscharten, um einen Blick auf ihn zu werfen –, dass er etwas Besonderes war. Ein Star.
Als er uns – genauer gesagt, Ellen – entdeckte, schied Moose aus dem Spiel aus. »Schwesterchen«, sagte er, ließ den Schwamm los und legte ihr den Arm um die Schultern. In seiner Umarmung sah Ellen kindlich aus, fröhlich – gelassen auf eine Weise, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Die Menge umschloss sie wie ein Lächeln. Und ich sah mit eifersüchtiger Faszination zu.
Später, auf der anderen Seite eines in unwirkliches Licht getauchten Hofes, machten Ellen und ich uns mit einer Hingabe, die an Achtlosigkeit grenzte, über Mooses Freunde her. Moose warf ätzende Blicke in meine Richtung, doch als die Party voranschritt, verlor er uns aus den Augen. Am Ende schlichen Marco und ich eine schmale Treppe zu einem der Gästezimmer im dritten Stock hoch, das nach Mottenkugeln stank. Er riss mir die Kleider vom Leib und wollte sich gerade über mich senken, wie ein Kran, der ein altes Auto auf andere alte Autos setzt, als ich zurückfuhr. »Nein«, sagte ich. »Halt, Moment!«, denn die Erinnerung an Mr. Lafant machte mir zu schaffen. Es war zu schnell, ich kannte diesen Typ doch gar nicht. Ich hatte vergessen, was ich mit ihm tun wollte und warum. Marco, verwirrt angesichts dieses Ausbruchs von Sittsamkeit nach meinem nuttenhaften Benehmen davor, ging pissen.
Ich floh aus dem Zimmer und jagte aus dem Haus, stürzte am Fluss entlang zum Country Club und fühlte mich bereits wiederbelebt von der Aussicht, Ellen zu sehen und mit ihr, wie immer, Jammergeschichten austauschen zu können. Nur, dachte ich, während ich noch immer dahinjagte, was, wenn ihre keine Jammergeschichte ist? Was, wenn sie und Todd jetzt endlich das gefunden haben, wonach wir schon so lange suchen? Diese Vorstellung war einfach entsetzlich.
Das eiserne Tor zum Clubgelände war verschlossen, womit wir nicht gerechnet hatten. Ich stand davor und fragte mich, was ich jetzt tun sollte. Endlich zog ich mich über den Zaun und fiel auf der anderen Seite auf den Boden. Der Club war unter dem hellen Mond und den Wolkenfetzen von ungeheurer Stille. Das warme Gras des Golfgeländes federte unter meinen Füßen. Ich rannte die Betontreppe zum Swimmingpool hinunter, dessen türkisfarbener Boden das Mondlicht einfing, und ich sah, dass sich im Wasser etwas bewegte und dass Ellen dieses Etwas war. Ich empfand eine solch heftige Freude, dass ich laut ihren Namen rief, sie legte lachend den Finger auf die Lippen, und ich sah ihre Kleider am Beckenrand und streifte meine ab und ließ mich in das nasse, schwere Schweigen sinken. Ich spürte, wie das Wasser sich bewegte, als Ellen vorüberschwamm, wie ihre langen Haare über meine Haut strichen. Wir tauchten auf und kicherten.
»Also, was ist passiert?« fragte ich mit sanfter Stimme.
»Womit?«
Ich starrte sie an. »Todd!«
»Ach, der konnte nicht«, sagte Ellen mit einer Gleichgültigkeit, die mich überglücklich machte. »Zu betrunken.«
Aber wir grinsten. Es gab kein Gefühl von Versagen, es gab nur diese Erleichterung, als hätten wir uns endlich aus einem grauenhaften Schicksal befreit. Wir schwammen ans seichte Beckenende und schauten zum Himmel hoch. Luft und Wasser schienen dieselbe Temperatur zu haben, zwei unterschiedliche Versionen derselben Substanz. Es war seltsam und gut, in dem Becken nackt zu sein, wo eigentlich Badehauben vorgeschrieben waren. Wolken zogen am Mond vorbei, milchig und geheimnisvoll, und ich hörte unten auf dem Fluss ein Boot und dachte, ich bin glücklich. Das hier ist Glück – warum sollte ich etwas anderes suchen? Ellen ließ sich auf dem Rücken treiben, das Wasser umspülte ihre Brüste, und niemand hatte für mich jemals so schön ausgesehen. Ich streckte die Hand nach ihr aus. Damit schien sie schon gerechnet zu haben, und sie griff nach mir. Wir standen im Wasser und küssten uns. Jedes Verlangen, das ich je empfunden hatte, drängte sich in mir zusammen und verlangte nach Erlösung. Ich berührte sie unter Wasser. Sie fühlte sich fremd und vertraut an – wie eine andere, aber wie ich. Ellen zuckte zusammen und schloss die Augen. Dieses eine Mal wusste ich nicht weiter. Sie klammerte sich an mich, dann brach sie zusammen, zitternd, die Arme um meinen Hals gelegt. Als sie lachte, hörte ich ihre Zähne klappern. Wir gingen zur Treppe und setzten uns hin, unsere Körper waren im Wasser, unsere Köpfe und Hälse nicht, und ich nahm ihre Hand und legte sie auf meinen Körper. Sie war vorsichtig, ängstlich, aber ich ließ meine Hand auf ihrer liegen, bis mein Herz aussetzte und mein Kopf gegen die Betonmauer hinter mir knallte. Da lagen wir nun, mein Kopf hämmerte, eine Beule entwickelte sich, die eine Woche lang weh tun würde, und als wir im Wasser zu frösteln begannen, stiegen wir aus dem Becken, trockneten uns mit unseren Kleidern ab, legten sie auf das Gras, legten uns darauf und fingen wieder an, diesmal jedoch langsamer. Doch die Intensität war entsetzlich – wir bringen uns gegenseitig um, dachte ich. Wir bringen etwas um. Danach lagen wir im Halbschlaf da, bis Ellen endlich sagte: »Wir könnten diesen Arschlöchern so einiges zeigen«, und wir lachten und zogen uns an und gingen zurück zu Ellens Haus und redeten unbefangen dabei, als sei nichts passiert. Wir waren die besten Freundinnen.
Wir schliefen nackt in Ellens schmalem Bett, pressten uns aneinander, ihre Haare waren überall, und ich hatte wieder dieses Gefühl, wie bei unserer ersten Berührung, dass sie weniger ein anderer Mensch war als eine Variante meiner selbst, dass wir zusammen eine Einheit ergaben. Ich erwachte in der Morgendämmerung und wäre gern gegangen, solange alles noch so schön war. Das war seltsam, denn es war Sonntag, und normalerweise hätten wir uns Pfannkuchen gemacht und Zeichentrickfilme angesehen und vermutlich den ganzen Tag miteinander verbracht. Aber ich ließ Ellen weiterschlafen und ging durch die Maisonne nach Hause, und als ich mich meinem Haus näherte, diesem flachen, unscheinbaren gelben Haus, das von der nackten Morgensonne fast weiß gebleicht wurde, erschien mir das, was mit Ellen passiert war, doch reichlich seltsam zu sein. Ich konnte es fast nicht mehr glauben. Aber ich erinnerte mich an das Gefühl, das körperliche Gefühl, ich spürte die Hitze in meinem Bauch und wollte nichts anderes als sie nur wiedersehen, sie wiederhaben. Bin ich eine Lesbe, fragte ich mich ungläubig. Ich hatte mich nie zu einem anderen Mädchen hingezogen gefühlt.
Ich wartete bis zum Abend, ehe ich sie anrief. Moose war am Telefon (er blieb kühl, sicher hatte Marco ihn über meine Zicken informiert) und reichte mich an Ellen weiter. Ich hörte eine Zurückhaltung in ihrer Stimme, die bei mir sofort eine ähnliche Zurückhaltung hervorrief, und unser Gespräch verlief gestelzt und unnatürlich, ganz anders als sonst. Wir konnten nichts dagegen tun. Wenn ich Ellen danach traf, kam sie mir vor wie einer der Jungen, mit denen ich es getan hatte; sie machte mich verlegen, machte mir klar, dass die Zeit verging und auf irgendeine Weise gefüllt werden musste. In den Pausen fragte ich mich: Ob sie wohl daran denkt? Möchte sie es wieder machen? Aber ich wollte nicht, weil Ellen für mich jetzt nicht anders war als ein Junge.
Es war ein schrecklicher Sommer. Ich hatte keine anderen Freundinnen. Ich sah Ellen nur einmal, im Kino. »Warte«, keuchte ich und riss Grace in die Schatten, als Moose und sein Hofstaat aus dem Kinosaal ins mit Teppichboden ausgelegte Foyer stürmten. Die Jungs rauften miteinander, und Moose bückte sich und legte sich Ellen um seine Schultern, ganz einfach, wie einen Mantel, und ihre Holzschuhe fielen zu Boden, aber Moose ließ sie nicht los, er rannte mit ihr durch die Glastüren auf den Parkplatz, wo ich sie vor Lachen kreischen hörte. Irgendwer hob die Holzschuhe auf und trug sie hinter ihr her. Ich sah ungläubig zu. Auf diese Weise verwöhnt zu werden, beschützt – was das wohl für ein Gefühl war? Im absoluten Mittelpunkt zu stehen, angebetet von dem Jungen, den alle liebten, ohne sich darum bemühen zu müssen. Was ließ sich damit schon vergleichen?
In diesem Herbst ging Ellen nach der Schule einmal vor mir her. Sie war allein, und nun, wo Moose nicht mehr da war, war sie wieder von Traurigkeit umhüllt. Ich zwang mich zum Laufen und holte sie ein. »Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich bei dir verhalten soll«, sagte ich.
»Geht mir auch so«, sagte sie.
»Wir müssen das vergessen. Wir müssen da weitermachen, wo wir vorher waren.«
»Das müssen wir«, stimmte sie zu.
Dann Schweigen. Ich wusste nicht, was ich sonst noch sagen sollte, und wir gingen angespannt weiter und ließen ab und zu Gemeinplätze fallen, während ich die Minuten bis zu meinem Haus zählte. Als es dann endlich zu sehen war, behauptete ich, meine Mutter warte auf mich, rannte los und überließ Ellen ihrem Schicksal.
Ich hatte erwartet, es werde schwer sein, neue Leute kennenzulernen, aber es stellte sich heraus, dass Ellen und ich durch unser Zerwürfnis so neutralisiert worden waren, wie uns unsere Zusammengehörigkeit stark gemacht hatte. Wir fanden schließlich Freunde und gingen auf Schulbälle und unterschrieben sogar unsere jeweiligen Jahrbücher – Alles Gute auch in Zukunft –, und abgesehen von ihrer wirklich abstrakten Bedeutung, vergaß ich jene Nacht.
Ich besuchte Ellens Haus noch ein letztes Mal. Und zwar mit Moose, der sein Studium beendet hatte und nach Rockford zurückgekehrt war, um bei seinem Vater zu arbeiten. Ich las ihn in meinem letzten Jahr bei einem Hockeyspiel auf, wo er zusah, wie kleine Jungs über das Eis jagten. Inzwischen hatte Mooses Nimbus an Glanz verloren, selbst die kleinen Geschwister seines alten Fanclubs hatten Rockford verlassen, und an der East High, wo er einst geherrscht hatte, wusste niemand mehr von seiner Existenz. Er lebte noch immer zu Hause, und ich folgte ihm die düstere, vertraute Treppe hoch, vorbei am Elternschlafzimmer, wo seine invalide Mutter ihr Leben verbrachte, vorbei an Ellens leerem Zimmer – sie war ein Jahr älter als ich und ging schon aufs College – und in seine Höhle von Mansarde: vergilbte Sportplakate lösten sich von der Wand, eingestaubte Pokale füllten die Regale. Moose strahlte einen Ernst aus, den ich an ihm noch nicht gesehen hatte. Als wir auf das Bett sanken, zeigte ich auf eine Konstruktion aus Seilen und Griffen, die an einer unter der Decke hängenden Kiste befestigt waren, und fragte, was das sei. »Nichts«, sagte er, »alter Kram, längst vergessen.«
Danach nickte er ein. Ich betrachtete ihn, die breiten Schultern, die leicht violette Färbung seiner Augenlider; wie viele Jahre war er Gegenstand von immer heftigerem Neid, Verehrung und Mythos, der jetzt auf dem Bauch dalag und leise in sein Kissen schnarchte.
Er öffnete die Augen: »Was?« fragte er mit schwacher Stimme.
»Du«, sagte ich.
Er sah verwirrt auf und stützte sich auf einen Ellbogen.
»Nur … Moose«, sagte ich kopfschüttelnd. »Moose. Moose Metcalf. Ich kann es nicht fassen.«
Er grinste verlegen. Er wusste genau, was ich meinte. Durch sein winziges Fenster drang Wind ins Schlafzimmer.
»Ich heiße übrigens Edmund«, sagte er.
Ich war keine Nostalgikerin. Ich sammelte keine Weihnachtskarten, machte nur selten Fotos, betrachtete die Schnappschüsse, die andere mir schickten, zumeist voller Gleichgültigkeit. Bis zu meinem Unfall hatte ich mein Gedächtnis immer für schlecht gehalten, aber in Wirklichkeit hatte ich die Vergangenheit fortgeworfen, eine Serie von Ereignissen, die mich nicht mehr betrafen – um unbehindert in die Zukunft weiterwandern zu können. Als ich jetzt zwischen den hohen Bäumen auf Ellen Metcalfs Haus zuhinkte, wollte ich mich nicht in tränenreichen Erinnerungen an meine alte Freundin verlieren, sondern das Haus in seinem jetzigen Zustand sehen. Erfahren, was daraus, und möglicherweise aus ihr, geworden war.
Das Haus der Metcalfs war ein geräumiges Haus in dem Fachwerkstil, der in den reichen Kreisen des Mittleren Westens immer schon beliebt gewesen war. Der Rasen beeindruckte mich noch immer, weit und weich, trotz des sengenden Sommers, der jetzt hinter uns lag. Auf dem Rasen lagen allerlei kindliche Besitztümer herum: ein Baseballschläger, ein Plastikgewehr, ein kleines leuchtend orangefarbenes Fahrrad. Ich hatte keine Ahnung, auf welches Kindesalter das hinwies. Ich berührte mein Gesicht, das von Mary Cunninghams dickem, nach Blumen duftendem Puder verklebt war. Noch immer war ich übel zerschunden, statt zu verschwinden, schienen die Blutergüsse nur ihre Farbe zu ändern, wie ein Feuerwerk, dessen Finale einfach nicht eintrifft. Ich kam mir ein wenig verdächtig vor, eine missliebige Besucherin, ein von Drogen verwüstetes Starlet, das incognito bleiben wollte.
Der Garten hinter dem Haus war neu gestaltet worden; Blumenbeete in Form von Limabohnen waren von weinroten Begonien umgeben. Ich stand auf dem mit Steinplatten belegten Hof und horchte auf das Schweigen. Dann ging ich zu der Fliegengittertür, die zur Küche führte – die Tür, die Ellen und ich immer benutzt hatten –, ich klopfte vorsichtig an und klingelte. Als feststand, dass niemand im Haus war, öffnete ich die Tür und ging hinein.
Der Unterschied war verblüffend; in meiner Erinnerung war die Küche ein dunkles Zimmer mit grünlichen Wänden und hohen Fenstern, bei denen ich das Gefühl hatte, vom Boden eines Brunnens her zum Himmel hochzustarren. Jetzt waren die Fenster breit und saßen tiefer, und das Zimmer hatte sich geöffnet, so weit, dass man Licht und Himmel und grünen Rasen mit zusammengeharkten Blättern sehen konnte. Sehr kalifornisch, dachte ich, stampfte mit den Absätzen auf die hellen pizzafarbenen Bodenfliesen, wobei ich eine beeindruckende Ansammlung von Gefäßen aus gehämmertem Kupfer über dem Herd zum Klirren brachte.
Und wenn jetzt jemand nach Hause kommt, fragte ich mich und ging die Vordertreppe hoch, nachdem ich einen Blick ins Wohnzimmer geworfen hatte, wo jetzt moderne Kunst die Wände beherrschte. Aber ich hatte keine Angst. Ich fühlte mich sicher – auf irgendeine Weise beschützt von meiner Sonnenbrille und meiner Make-up-Maske, von meinem seidenen Kopftuch, das ich oben in meinen Regenmantel gestopft hatte, um die Narben an meinem Hals zu verdecken. Das hier bin nicht ich, dachte ich, als ich oben um die Ecke bog, wo die hellen Wände und die leuchtenden Böden jegliche Spur der alten Tristesse getilgt hatten. Wie könnte ich ertappt werden, wenn ich wie niemand aussah? Als Model hatte ich mein Gesicht wie einen Schild getragen, hatte es einen Meter oder mehr vor mich gehalten – nicht aus Stolz oder Eitelkeit, das nun wirklich nicht; die waren mir schon längst ausgetrieben oder zumindest von meiner physischen Erscheinung getrennt worden. Nein, einfach aus praktischen Gründen: So, das bin ich. Visitenkarte, Händedruck, Steckbrief, nennt es, wie ihr wollt; das hatte ich der Welt anzubieten, in der ich mein Leben verbrachte.
Ich steuerte das Elternschlafzimmer an, ein Zimmer, das ich nur kurz gesehen hatte, wenn Ellen es verlassen oder betreten hatte, ein flüchtiger Blick, ein Hauch von Parfüm, die leise, klagende Stimme ihrer Mutter. Jetzt stand die Tür offen. Der Raum war riesig und kaum möbliert; Sonnenstrahlen drangen durch die hölzernen Rollos, die aussahen wie Maßarbeit. Es gab große Ficuspflanzen und ein modern aussehendes Bett mit eleganten Pfosten. Die Wände waren gelbweiß. In einem luxuriös eingerichteten Ankleidezimmer roch ich Chanel, doch meine beschädigte Nase konnte nicht entscheiden, welches. Hohe Spiegel und gerahmte Fotos bedeckten die Wände. Ich trat näher, um mir alles anzusehen – noch durfte ich meine Kontaktlinsen nicht tragen –, denn ich war neugierig auf die Familie, die jetzt in diesem Haus wohnte. Ellen erkannte ich sofort, um viele Jahre älter geworden, doch noch immer schön, ihr Gesicht noch stärker von ihren Wangenknochen betont. Sie stand neben einem Mann an einem Strand, vermutlich ihrem Mann, er sah zehn Jahre älter aus und hatte die gebräunte Haut und die weißen Zähne eines Deutschen.
Ellen Metcalf. Ich stand in Ellen Metcalfs Schlafzimmer.
In dem Versuch, meine tränenden Augen scharf blicken zu lassen, sah ich mir andere Bilder an: Ellen, die es sich mit ihrem Mann irgendwo im Ausland gemütlich macht; das zerknautschte Gesicht eines Neugeborenen; einige Jugendbilder von Ellens Eltern, aufgenommen wie Szenenfotos aus Hollywoodfilmen; eine Montage von zwei Kindern, das ältere ein Mädchen, das – armes Ding – keinerlei Ähnlichkeit mit der Mutter hatte. Ich überlegte, ob sie vielleicht adoptiert sein könnte. Ellen und diese Tochter in identischen Badeanzügen, neben dem Swimmingpool des Country Club. Als ich diese stürmische Zusammenfassung von Ellens Leben betrachtete, hatte ich zum ersten Mal Angst, sie könne nach Hause kommen und mich hier vorfinden. Dass ich hier eingebrochen war, war dabei nicht das Problem, wichtiger war, dass ich nicht so gesehen werden wollte.
Also beschloss ich zu gehen. Doch bevor ich dazu kam, hörte ich Schritte vor der Tür. Entsetzt schob ich meine Sonnenbrille über meine roten Ungeheuer-Augen, jagte zurück ins Schlafzimmer und hockte mich in einen Schrank, wobei ich vorsichtig die Tür zuzog. Dort saß ich dann und rang in einer Dunkelheit voller hauchdünner Kleider, die ebenfalls nach diesem undefinierbaren Chanel dufteten, um Atem, bis mir aufging, dass es noch viel demütigender sein würde, in einem Schrank gefunden zu werden, als aufrechtstehend in einem Schlafzimmer, und ich stieß die Schranktür in dem Moment auf, als ein Mädchen von vielleicht dreizehn mit Kopfhörern hereinkam.
Sie fuhr zusammen, dann starrte sie mich an, verwirrt und schuldbewusst, als sei sie diejenige, die auf frischer Tat ertappt worden war. Es war das Mädchen von den Fotos, ein traurig durchschnittlich aussehendes Wesen mit dünnen, strähnigen Haaren und einer Brille wie Insektenflügel. Sie streifte ihre Kopfhörer ab.
»Wer sind Sie?« fragte sie.
»Ich bin eine alte Freundin deiner Mutter«, erwiderte ich so gelassen, wie ich nur konnte. »Ich war gerade in der Stadt und wollte mal hereinschauen. Aber sie scheint ja nicht zu Hause zu sein.«