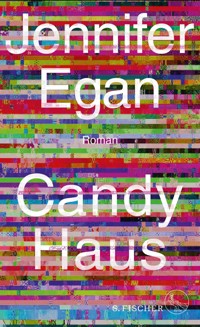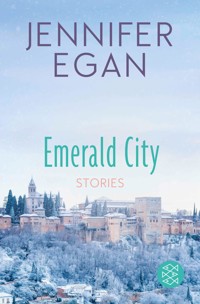9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der erste Roman der Pulitzer-Preisträgerin Jennifer Egan ist ein beklemmendes Buch über Trauer, Tod und Schuld. Nur ein paar Postkarten sind Phoebe von ihrer großen Schwester Faith geblieben, die 1970 in Italien ums Leben kam. Unfall? Mord? Selbstmord? Phoebe will die Wahrheit herausfinden und begibt sich von San Francisco aus auf eine Reise nach Europa: von Amsterdam über Paris und München bis ins italienische Corniglia in eine Zeit hinein, in der eine Generation, berauscht von Drogen und dem Ideal der freien Liebe, an eine bessere Zukunft glaubte und die Welt aus den Angeln heben wollte. »Wenn es Gerechtigkeit auf dieser Welt gäbe, so dürfte es niemandem erlaubt sein, ein Debüt von derartiger Schönheit und Vollendung zu schaffen.« The New York Times Book Review »›Die Farbe der Erinnerung‹ gleicht dem zart leuchtenden Grün eines Frühlingserwachens, hinter dem der Winter einer turbulenten, unbegriffenen Zeit liegt.« Ulrich Greiner, Die Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jennifer Egan
Die Farbe der Erinnerung
Roman
Über dieses Buch
Der erste Roman der Pulitzer-Preisträgerin Jennifer Egan über eine Generation, deren Traum von Freiheit in Terror umschlug.
Nur ein paar Postkarten sind Phoebe von ihrer großen Schwester Faith geblieben, die 1970 in Italien ums Leben kam. Unfall? Mord? Selbstmord? Phoebe will die Wahrheit herausfinden und begibt sich von San Francisco aus auf eine Reise quer durch Europa. Bis in eine Zeit hinein, in der eine Generation, berauscht von Drogen und dem Ideal der freien Liebe, an eine bessere Zukunft glaubte und die Welt aus den Angeln heben wollte.
»Wenn es Gerechtigkeit auf dieser Welt gäbe, so dürfte es niemandem erlaubt sein, ein Debüt von derartiger Schönheit und Vollendung zu schaffen.« The New York Times Book Review
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jennifer Egan wurde 1962 in Chicago geboren und wuchs in San Francisco auf. Sie lebt heute mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Brooklyn, New York. Neben ihren Romanen und Kurzgeschichten schreibt sie für den New Yorker sowie das New York Times Magazine und lehrt an der Columbia University Creative Writing. Für ihren Roman »Der größere Teil der Welt« erhielt sie den Pulitzer Prize, den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize. Ihr aktueller Roman »Manhattan Beach« erstürmte gleich bei Erscheinen die New York Times-Bestsellerliste und erhielt hymnische Presse.
Günter Ohnemus, 1946 in Passau geboren, war Buchhändler, Lektor, Mitarbeiter am Collins Dictionary und Verleger. Heute lebt er als freier Autor und Übersetzer in Freising bei München. 1998 wurde er mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielt er für seinen Roman ›Der Tiger auf deiner Schulter‹ den Tukan-Preis der Stadt München. Schreiben ist, nach Tennis, sein Lieblingssport, sagt er.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
›The Invisible Circus‹ bei Doubleday, New York
© 1995 Jennifer Egan
Eine deutschsprachige Ausgabe erschien erstmals 1999
bei Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung GmbH, Frankfurt am Main.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: Getty Images / Jonathan Blair / Corbis
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490667-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
TEIL EINS
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
TEIL ZWEI
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
TEIL DREI
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
TEIL VIER
ZWEIUNDZWANZIG
Dank
Für meine Mutter, Kay Kimpton, und meinen Bruder, Graham Kimpton
»… diese Zeit, welche das Bild der Sache, die Kopie dem Original, die Vorstellung der Wirklichkeit, den Schein dem Wesen vorzieht … denn heilig ist ihr nur die Illusion, profan aber die Wahrheit … so dass der höchste Grad der Illusion für sie auch der höchste Grad der Heiligkeit ist.«
Ludwig Feuerbach
»Exultation is the going
Of an inland soul to sea,
Past the houses – past the headlands –
Into deep Eternity –…«
Emily Dickinson
TEIL EINS
EINS
Sie war zu spät gekommen. Phoebe spürte es an der Stille. Sie ging durch den üppigen, nebligen Park und hörte nichts als das Tröpfeln des Taus, der von Farnen und Palmblättern lief. Als sie die große Wiese erreichte, war sie von der ungeheuren Leere, die sie sah, nicht mehr überrascht.
Das Gras war ein leuchtendes, schreiendes Grün. Überall lag Abfall herum, Überreste – Strohhalme, Zigarettenkippen, ein paar durchnässte Decken, die dem Matsch überlassen worden waren.
Phoebe steckte die Hände in die Taschen und ging über das Gras, stieg ab und zu mit großen Schritten über blanke, matschige Stellen. Ein Ring aus Bäumen zog sich um die Wiese herum, Küstenbäume, vom Wind gebeugt, aber trotzdem symmetrisch, wie Figuren, die mit großer Mühe schwere Tabletts balancieren.
Am Ende der Wiese bauten Leute in Uniformjacken eine Bühne ab. Sie trugen die Sachen durch die Bäume auf eine Straße hinaus, auf der Phoebe den dunklen Umriss eines Lasters ausmachen konnte.
Sie ging auf einen Mann und eine Frau zu, an deren Armen aufgerollte orangefarbene Kabel hingen. Phoebe wartete höflich, dass die beiden ihr Gespräch beendeten, aber sie schienen sie überhaupt nicht wahrzunehmen. Sie wandte sich schüchtern an einen Mann, der ein langes Holzbrett trug. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie. »Bin ich zu spät gekommen?«
»Ja«, sagte er. »Es war schon gestern. Von Mittag bis Mitternacht.« Er kniff die Augen zusammen, als wäre die Sonne herausgekommen. Er kam Phoebe irgendwie bekannt vor, und sie fragte sich, ob er vielleicht ihre Schwester gekannt hatte. Sie fragte sich das ja immer.
»Ich hab gedacht, es wäre heute«, sagte sie überflüssigerweise.
»Ja, auf ungefähr der Hälfte der Plakate ist das falsch gedruckt worden.« Er grinste, das Blau seiner Augen war hell, synthetisch.
Es war der 18. Juni, ein Samstag. Zehn Jahre davor, 1968, hatte angeblich auf genau dieser Wiese ein »Festival of Moons« stattgefunden. »Revival of Moons« versprachen die Plakate, und Phoebe hatte auf der Arbeit mit jemandem die Schicht getauscht und war ganz gespannt hierhergekommen, weil sie noch einmal erleben wollte, was sie ja gar nicht erlebt hatte.
»Und wie war’s?«, fragte sie.
»Unterbesucht.« Er lachte grimmig.
»Ich bin froh, dass ich nicht die Einzige war«, sagte sie.
Der Mann setzte das Brett ab und fuhr sich mit der Hand über die Augen. Stumpfes, blondes Haar fiel lang und glatt auf seine Schultern. »Mann«, sagte er. »Du siehst ziemlich so aus wie ein Mädchen, das ich früher mal kannte.«
Phoebe schaut ihn erschrocken an. Er kniff jetzt die Augen wieder zusammen. »Ja, genau wie sie.«
Sie schaute ihm ins Gesicht. »Catnip«, sagte sie und war überrascht, dass sie das sagte.
Er ging einen kleinen Schritt zurück.
»Du warst ein Freund von Faith O’Connor, oder?«, sagte Phoebe jetzt aufgeregt. »Ja, also, ich bin ihre Schwester.«
Catnip wandte den Blick ab und schaute dann Phoebe wieder an. Er schüttelte den Kopf. Sie erinnerte sich jetzt an ihn, obwohl er ihr damals viel größer vorgekommen war. Und schön – es war diese intensive, flüchtige Schönheit, die man manchmal an Jungs sah, aber nie an Männern. Die Mädchen konnten ihm nicht widerstehen, und deswegen hatte er auch diesen Namen: Catnip. Katzenminze.
Er schaute Phoebe mit großen Augen an. »Ich kann das nicht glauben«, sagte er.
Während Catnip zu den anderen hinüberging und ihnen sagte, dass er jetzt gehen würde, versuchte Phoebe, wieder Luft zu kriegen. Jahrelang hatte sie sich das vorgestellt, dass einer von Faiths Freunden sie jetzt, wo sie erwachsen war, erkennen würde, sehen würde, wie sehr sie ihrer Schwester ähnlich sah.
Sie ging zusammen mit Catnip über die Wiese. Sie war nervös. Auf seinem Gesicht glitzerten blonde Barthaare.
»Und du, gehst du jetzt auf die Highschool?«, fragte er.
»Ich bin grade fertig geworden«, sagte Phoebe. »Letzte Woche, genau gesagt.« Sie war nicht auf die Abschlussfeier gegangen.
»Also, ich bin Kyle. Mich hat seit Jahren keiner mehr Catnip genannt«, sagte er traurig.
»Wie alt bist du denn?«
»Sechsundzwanzig. Und du?«
»Achtzehn.«
»Achtzehn«, sagte er und lachte. »Scheiße, als ich achtzehn war, kam mir sechsundzwanzig richtig uralt vor.«
Kyle hatte gerade das zweite Jahr seines Jurastudiums abgeschlossen. »Am Montag fang ich mit meiner Ferienarbeit an«, sagte er und machte mit zwei Fingern eine Bewegung, als würden ihm die Haare abgeschnitten.
»Wirklich? Zwingen sie dich dazu, sie abzuschneiden?« Das klang nach Militär.
»Das müssen sie nicht«, sagte er. »Wenn du ankommst, hast du sie schon abgeschnitten.«
Die Verkehrsgeräusche wurden lauter, als sie sich dem Rand des Golden Gate Parks näherten. Phoebe kam sich vor wie damals als Kind, wenn sie mit einem von Faiths Freunden alleine war und fürchtete, sie könnten sie langweilig finden. »Denkst du manchmal noch an die Zeit damals?«, fragte sie. »Ich meine, die Zeit mit meiner Schwester?«
Kyle sagte erst gar nichts. »Na klar«, sagte er dann. »Klar denk ich daran.«
»Ich auch.«
»Faith kommt mir unglaublich wirklich vor.«
»Ich denk die ganze Zeit an sie«, sagte Phoebe.
Kyle nickte. »Sie war ja deine Schwester.«
Als sie an die Haight Street kamen, riss der Nebel gerade auf und gab den Blick auf kleine blaue Fitzelchen Himmel frei. Phoebe überlegte, ob sie erwähnen sollte, dass sie nur zwei Blocks entfernt arbeitete – dass sie ohne das Revival of the Moons sogar jetzt gerade bei der Arbeit wäre –, aber das kam ihr jetzt nicht wichtig vor.
»Ich wohne hier in der Gegend«, sagte Kyle. »Hast du Lust auf einen Kaffee?«
Seine Wohnung in der Cole Street war eine Enttäuschung. Phoebe hatte gehofft, sie würde hier in eine andere Zeit versetzt, aber das Wohnzimmer wurde von einer eleganten, anthrazitfarbenen Couch und einem langen, gläsernen Couchtisch beherrscht. An den Wänden hingen abstrakte Lithographien, die so wirkten, als würden sie in ihren Plexiglasrahmen schweben. Aber an einem Fenster hing ein Prisma, und auf dem Boden lagen überall Kissen mit Batikbezügen. Phoebe fiel auch der Geruch von Gewürznelken oder Pfeffer auf, etwas, das ihr von früher vertraut war.
Sie setzte sich in einigem Abstand von der anthrazitfarbenen Couch auf den Fußboden. Als Kyle seine Uniformjacke auszog, sah Phoebe durch sein T-Shirt, wie muskulös sein Körper war. Er nahm aus einer Zigarettendose aus Plexiglas, die auf dem Couchtisch stand, einen Joint, zündete ihn an und setzte sich dann selber auf den Fußboden.
»Weißt du«, sagte er mit gepresster Stimme, während er den Rauch zurückhielt und Phoebe den Joint gab, »ich hab mir oft überlegt, ob ich nicht mal bei dir und deiner Mutter vorbeischauen sollte. Einfach mal schauen sollte, wie es euch geht.«
»Das hättest du auch tun sollen«, sagte Phoebe. Sie betrachtete den Joint und überlegte krampfhaft, ob sie rauchen sollte oder nicht. High zu werden machte ihr immer große Angst, und sie hatte sich dabei schon mehr als einmal völlig gelähmt gefühlt, wie in einen Schraubstock gespannt, so als könnte sie gleich tot umfallen. Aber sie dachte an ihre Schwester und wie begierig Faith sich auf alles eingelassen hatte – und dass Kyle das auch von Phoebe erwarten würde. Sie inhalierte vorsichtig. Kyle beugte sich über seinen Plattenspieler und stapelte Platten auf dem Einsatz für den Plattenwechsler. Man hörte Surrealistic Pillow in der vollen, beklemmenden Stimme von Grace Slick.
»Hat deine Mutter wieder geheiratet?«, fragte er, während er sich wieder auf den Boden setzte.
»O nein«, sagte Phoebe mit einem leisen Lachen in der Stimme. »Nein.«
Kyle musterte sie durch den Rauch. Das machte sie unsicher. »Ich glaub, diese Phase in ihrem Leben ist irgendwie schon vorbei«, sagte sie als Erklärung.
Er schüttelte den Kopf. »Schade.«
»Nein, das macht ihr nichts aus«, sagte Phoebe und war sich gleichzeitig nicht sicher. »Sie hat die Zeit für Liebesgeschichten irgendwie schon hinter sich.«
Kyle runzelte die Stirn und zog an seinem Joint. »Wie alt ist sie denn jetzt?«
»Sie hat nächstes Wochenende Geburtstag. Sie wird siebenundvierzig.«
Kyle lachte laut, Rauch schoss aus seinem Mund, und dann hustete er wie verrückt. »Siebenundvierzig«, sagte er, als der Hustenanfall vorbei war. »Das ist nicht alt, Phoebe.«
Sie schaute ihn an, sein Lachen verblüffte sie. »Ich hab nicht gesagt, dass sie alt ist«, sagte sie. Der Joint brachte sie ganz durcheinander.
Kyle ließ den Blick auf Phoebe ruhen. Rauch hing in länglichen Schwaden in der Luft, löste sich langsam auf wie Sahne im Kaffee. »Und du?«, sagte Kyle. »Wie ist es bei dir gelaufen?«
»Gut, danke«, sagte sie zurückhaltend.
Als sie mit dem Joint fertig waren, hatte Phoebe das Gefühl, das Zimmer würde direkt gegen ihre Augäpfel drücken, in einem bestimmten Rhythmus pulsieren. Ihr Herzschlag antwortete darauf. Aus den Kissen stieg Zimtgeruch auf, als sie sich zurücklehnte.
Kyle streckte sich lang aus. Er hatte den Kopf auf die Hände gelegt und die Beine an den Knöcheln gekreuzt. »Ich will darüber reden«, sagte er mit geschlossenen Augen. »Aber ich weiß nicht, wie.«
»Ich auch nicht«, sagte Phoebe. »Ich krieg das nie fertig.«
Kyle öffnete ein Auge. »Nicht einmal mit deiner Mutter? Mit deinem Bruder?«
»Ich weiß nicht, warum«, sagte Phoebe. »Früher konnten wir darüber reden.«
Plastic Fantastic Lover kam jetzt aus den Lautsprechern, verschlungen und tranceverloren, und Phoebe sah Farben, Farbfetzen. Sie hörten schweigend zu.
»Habt ihr … habt ihr je erfahren, was passiert ist?«, sagte Kyle schließlich.
»Du meinst, wie sie gestorben ist?«
»Ja, was eigentlich genau passiert ist.«
Wie immer, wenn die Sprache auf Faith kam, spürte Phoebe, wie ein bestimmter Druck in ihr auf einmal nachließ. Sie atmete jetzt in langen, ruhigen Zügen. »Na ja, alle sagen, dass sie da runtergesprungen ist.«
Kyle stöhnte ganz leise. »In Italien, oder?«
Phoebe nickte. Nach einer kleinen Pause fragte sie: »Glaubst du das?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Kyle. »Ich meine, so wie ich die Geschichte gehört habe – du weißt das ja wahrscheinlich besser als ich –, also, so wie ich das gehört habe, muss es ziemlich schwer sein, dort zufällig runterzufallen.«
»Nur dass es eben niemand gesehen hat.«
Kyle stützte sich jetzt auf die Ellbogen und schaute Phoebe an. Sie war ganz high von dem Joint, erwiderte seinen Blick und versuchte dahinterzukommen, was genau sich an Kyle seit den alten Zeiten verändert hatte.
»Aber ich meine, warum?«, sagte er. »Verstehst du – warum?«
Er sah ganz ernst aus, so als wäre er der erste Mensch, der diese Frage jemals gestellt hatte. Phoebe musste darüber lachen. Sie lachte zuerst leise, und dann schüttelte sie sich vor Lachen, und Tränen liefen ihr aus den Augen. »Entschuldige«, sagte sie und wischte sich die Tränen mit dem Ärmel ab. Die Nase lief ihr. »Entschuldige.«
Kyle berührte ihren Arm. »Ich hab mich nur gefragt, wie das alles abgelaufen ist«, sagte er.
»Ja«, sagte Phoebe schniefend. »Ich auch.« Das Lachen hatte ihr geholfen, hatte sie erleichtert, so, wie auch Weinen erleichtern kann.
»Du glaubst, dass es ein Unfall war«, sagte Kyle.
»Ich bin mir nicht sicher.«
Er nickte. Das Thema war jetzt irgendwie abgeschlossen. Phoebe hatte das Gefühl, sie hätte eine Chance verspielt. Sie war wohl selber daran schuld, weil sie gelacht hatte.
Sie versanken jetzt wieder in Schweigen. An Phoebes Daumen und Mittelfinger klebte Harz. Kyle zündete den Stummel wieder an, und als er ihn ihr gab, rauchte sie, ohne zu zögern. Schließlich ließ Kyle den Rest des Joints auf den Boden fallen, setzte sich mit gekreuzten Beinen aufrecht hin und drückte die Fingerspitzen seiner Hände aneinander. »Du siehst aus wie sie«, sagte er. »Das hast du wahrscheinlich schon oft gehört.«
»Nein, das hör ich nie«, sagte Phoebe und war ganz verwirrt, weil sie nicht wusste, warum das so war. »Weil« – sie lachte, weil sie jetzt den Grund dafür gefunden hatte – »na ja, weil uns ja niemand zusammen sieht.«
Kyle schlug sich gegen die Stirn. Seine Bemerkung war ihm ganz offensichtlich peinlich.
»Aber es wäre schön, wenn uns die Leute zusammen sehen könnten«, sagte Phoebe. »Das wär wirklich schön.«
Kyle stand auf und ging zum Fenster hinüber. Phoebe reckte sich in ihrer Cargo-Hose und ihren Wildlederstiefeln zur Decke, so dass die Muskeln ihre Rippen hochzogen. Sie war ziemlich high, aber heute war das schon in Ordnung. Sie spürte sogar ein verrücktes Selbstvertrauen, als sie Kyle beobachtete, wie er durch sein Prisma schaute. Das Prisma hing an einem Nylonfaden am Fenster. Er drehte es, und Lichtflecken in allen Regenbogenfarben huschten durchs Zimmer. Aus den Lautsprechern kam King Crimsons Song Moonchild.
»Ich hab grade ein komisches Gefühl gehabt«, sagte Kyle.
»Was denn?«
»Ich hab gedacht, wenn du mir jetzt sagen würdest, du wärst Faith, dann würde ich das glatt glauben.«
Phoebe wandte sich ab, damit er die Freude auf ihrem Gesicht nicht sehen konnte. Sie zog manchmal immer noch Sachen von Faith an, ausgefranste Jeans, Spitzenblusen vom Flohmarkt, eine zerknitterte Samtjacke mit sternförmigen Knöpfen. Die Sachen passten alle nicht so ganz. Ihre Schwester war dünner gewesen oder größer und ihr schwarzes Haar länger – irgendetwas war anders. Auch wenn Phoebe sich noch so sehr Mühe gab, den Abstand zwischen sich und ihrer Schwester zu überbrücken, es bestand doch immer irgendwie ein Unterschied. Aber eines Tages würde dieser Unterschied verschwinden, das glaubte sie ganz fest. Das war Teil einer größeren Verwandlung, auf die Phoebe dauernd wartete. Sie hatte gedacht, diese Verwandlung würde sich mit dem Ende der Highschool einstellen.
»Ich geh bald nach Europa«, log sie, weil sie plötzlich das Bedürfnis spürte, Kyle zu beeindrucken und zu verblüffen. »Das wird ’ne lange Reise.«
»Oh«, sagte er drüben am Fenster. »Und wohin?«
»Ich bin mir noch nicht sicher. Ich hab gedacht, ich fahr einfach mal los, verstehst du? Einfach ganz spontan.« Das stimmte ja auch irgendwie; Phoebe hatte vor, eines Tages nach Europa zu gehen und den Spuren ihrer Schwester zu folgen. Das hatte sie immer vorgehabt. Aber sie hatte sich jetzt für das Herbstsemester in Berkeley eingeschrieben, hatte fünf Seminare belegt und sich sogar einen Platz im Studentenheim reservieren lassen.
»Ich finde spontane Sachen immer gut«, sagte Kyle. Es klang ein bisschen neidisch.
Ihr Vater hatte spontane Sachen auch gemocht. Er hatte in seinem Testament dafür vorgesorgt, hatte Faith, Phoebe und Barry jeweils fünftausend Dollar hinterlassen, damit sie die Welt entdecken könnten. »Das müsst ihr als Erstes machen«, hatte er gesagt. »Bevor ihr euch irgendwo festlegt. Macht Sachen, von denen ihr den Rest eures Lebens erzählen könnt.«
»Ich geh einfach rüber«, sagte Phoebe, die jetzt ganz in ihrer Erfindung aufging. »Ich zieh einfach los.«
Kyle ging zu ihr hinüber, seine nackten Fußsohlen blieben beim Gehen immer ganz leicht auf dem blanken Boden kleben. Sein Knie knackte, als er sich auf die Kissen neben ihr legte. Phoebe schloss die Augen.
»Du bist sehr schön«, sagte er und berührte ihr Gesicht. Phoebe öffnete die Augen und machte sie ganz schnell wieder zu. Ihr war schwindlig, so als würde sich das Zimmer – genau wie Kyles Prisma – an einem Nylonfaden drehen. Kyle beugte sich herunter und küsste ihren Mund. Phoebe erwiderte seinen Kuss, irgendetwas in ihr drängte blind zu ihm hin. Sie hatte noch nie mit jemandem geschlafen. Kyles Mund schmeckte süß, wie Apfelmus.
Er legte die Kissen zurecht und machte sich neben ihr lang. Als er durch Phoebes T-Shirt ihre Brüste berührte, spürte sie seine Selbstsicherheit, und das half ihr, sich zu entspannen. Kyle nahm ihren Kopf in seine Hände. Seine Handflächen lagen kühl an ihren Schläfen, und Phoebe hörte ein Rauschen in den Ohren wie von Meermuscheln. Kyle legte sich ganz behutsam auf sie. Sie klammerte sich an die Muskeln, die an seinem Rückgrat entlangliefen, und die Hitze, die von seinem Körper ausging, drang durch ihre Kleider auf ihre Haut. Seine kräftigen Bauchmuskeln bewegten sich beim Atmen ruhig und sanft; Phoebe spürte seine Erektion an ihrem Schenkel. Sie machte die Augen auf, um ihn anzuschauen. Aber Kyle hatte seine Augen fest zugedrückt, so als würde er sich etwas wünschen.
»Warte – warte«, sagte sie und wand sich unter ihm heraus.
Kyle versuchte zuerst, sie davon abzuhalten, sprang dann aber auf, als wäre jemand ins Zimmer gekommen. Phoebe hörte, wie flach sein Atem ging. Sie saß zusammengekauert und die Knie gegen das Kinn gepresst da, wie ein Ei. Kyle ließ sich auf die Couch fallen. »Scheiße«, sagte er.
Aber Phoebe nahm ihn schon gar nicht mehr wahr. Es gab etwas, an das sie sich jetzt erinnern musste. Sie machte die Augen zu, presste die Stirn gegen die Knie und sah Faith und ihre Freunde vor sich, wie sie kleine, quadratische Papierstückchen schluckten und wie sie dann später zu lachen anfingen, ein verrücktes, heulendes Lachen war das, und bei Faith wurde das Lachen bald zu einem hilflosen Schluchzen, sie lag schluchzend in den Armen ihres Freundes – »Wolf« hieß er wegen seiner braunen Haut und seiner weißen Zähne, und seine braunen Hände lagen jetzt auf dem Kopf ihrer Schwester – »Ruhig, ruhig«, sagte er und strich über ihr Haar, als wäre Faith eine Katze, »ruhig, ruhig.« Er trug unter seiner braunen Lederweste kein Hemd, und seine braunen Bauchmuskeln erinnerten Phoebe an die Muster auf einem Schildkrötenpanzer. Und dann küsste ihn Faith. Phoebe schaute verlegen zu.
»Komm jetzt«, sagte Faith und wollte aufstehen, schaffte es aber nicht; sie war krank, ihre Augen glänzten fiebrig. »Komm jetzt.« Sie küsste ihn immer wieder, aber Wolf sah Phoebe, die neben ihm kauerte, und ihre Blicke trafen sich und blieben aneinander hängen.
»Faith, warte«, sagte er. »Babe, warte noch.«
Aber schließlich half er ihr hoch, und Phoebe schlich hinter ihnen her in den Flur, auf dem sie bis ganz nach hinten torkelten, wo sich dann die weiße Tür zum Zimmer ihrer Schwester hinter ihnen schloss. Dann war es still. Phoebe wartete im Flur darauf, dass die Tür wieder aufgehen würde, und ihre Angst wuchs, während die Minuten vergingen – ihre Schwester war krank, konnte kaum gehen! Als ihr Vater krank geworden war, da war die Tür immer geschlossen geblieben, und im Flur hing ein süßlicher Geruch nach Medizin. Phoebe warf sich auf den Teppich im Flur und lag in einer Art Trance da, und die weiße Tür brannte ein Loch durch ihren Kopf, bis Phoebe schließlich – nach einem Zeitraum, der ihr wie Stunden vorkam – schluchzend an die Tür lief, den kühlen, glatten Lack an der Wange spürte, aber den Türknopf nicht umdrehte. Ihre Angst war zu groß.
Dann hörte sie Schritte. Phoebe fuhr zurück, als Faith die Tür aufmachte. Ihre Augen waren weit und schwarz. Wassertropfen hingen an ihren Wimpern. Sie nahm Phoebe ganz fest in den Arm. »Baby«, sagte sie und wiegte sie ganz ruhig hin und her, »Baby, Baby, was ist denn passiert?« Sie roch nach Seife – hatte sie vielleicht bloß geduscht? Und Wolf, der Held, schaute Phoebe an. Auf seinem Gesicht lag ein so starker Ausdruck von Schmerz, als hätte er ihr weh getan. Nein, wollte Phoebe sagen, nein, nein, aber wie sollte sie denn reden, wenn sie nichts verstand, wenn alle so geheimnisvoll taten?
Jetzt schaute Phoebe zu Kyle hinüber, der Meilen entfernt auf der Couch saß. So ging es ihr immer – etwas, an das sie sich erinnern musste, zog sie zurück wie eine Unterströmung. Eine weiße Tür trennte sie von allem, erinnerte Phoebe daran, dass ihr jetziges Leben unwirklich und ohne Bedeutung war. Das, worauf es ankam, war nicht zu sehen. Manchmal war sie zornig, dass sie sich erinnern musste, und wollte nichts lieber als losrennen und sich in etwas stürzen, das zu ihr gehörte. Wollte sich darin verlieren. Aber das war nicht möglich. Der einzige Weg nach vorne führte durch diese Tür.
»Fehlt sie dir?«, sagte Phoebe in die Stille hinein.
Kyle erhob sich ächzend von der Couch und sprühte Wasser auf die Blätter einiger mickriger Marihuanapflanzen, die ihre Köpfe alle in Richtung auf eine ultraviolette Lampe neigten. Sie waren mit dünnen Fäden an Stützen festgebunden. »Manchmal hab ich das Gefühl, als wäre sie immer noch da«, sagte er. »Ich meine, als würde sie immer noch in dieser Zeit damals leben.«
»Mir geht es auch so«, sagte Phoebe. »Obwohl ich ja gar nicht wirklich dabei war.«
»Klar warst du dabei.«
»Nein. Ich war doch noch ein Kind.«
Sie sagten beide lange Zeit nichts. »Ich war auch nicht dabei«, sagte Kyle. »Wenigstens nicht so ganz.«
»Wie meinst du das denn?«
»Ich war schon immer irgendwie dabei, die ganze Zeit, aber ich war nie wirklich mittendrin.«
Dieses Geständnis beunruhigte Phoebe. »Du warst dabei, Kyle«, sagte sie. »Du warst ganz sicher dabei.«
Er grinste, wirkte ermutigt. Er spritzte mit seinem Zerstäuber in die Luft, kleine Wassertröpfchen fingen sich im Licht, als sie nach unten sanken. Phoebe hörte die Kanone, die jeden Tag um fünf Uhr auf dem Militärstützpunkt Presidio abgefeuert wurde. »Ich geh jetzt lieber«, sagte sie und stand schwankend auf. Eines ihrer Beine war eingeschlafen. Es war 1978. Faiths Freund Wolf lebte jetzt in Europa. Phoebes Mutter hatte schon seit Jahren nichts mehr von ihm gehört.
Kyle stand wartend da. Er hatte die Hände in den Hosentaschen. »Ich ruf dich an.«
»Okay«, sagte Phoebe und wusste, dass er nicht anrufen würde.
Sie ging vorsichtig die Stufen zur Straße hinunter und hielt sich dabei am Geländer fest. Sonnenlicht blitzte in den Bäumen. Weiter weg hörte man plappernde Stimmen aus einem Cable Car, sonst war alles ganz ruhig.
»Hey«, kam es von oben. Kyle beugte sich aus seinem Fenster. »Ich hab ganz vergessen, dass ich dir was mitgeben wollte, falls du nach München kommst. Ich hab da drüben einen Cousin.«
Phoebe hielt sich die Hand über die Augen, damit sie besser sehen konnte. Sie hatte ihre Europageschichte schon vergessen und war überrascht, dass sie ihr jetzt sozusagen als Tatsache präsentiert wurde.
»Komm noch mal rauf«, sagte Kyle.
Phoebe ging wieder zurück. Kyle gab ihr einen Joint, der in rosafarbenes, fluoreszierendes Zigarettenpapier gedreht war. Der Joint fühlte sich in ihrer Hand trocken und leicht an.
»Sag ihm, es ist derselbe Stoff, den wir Weihnachten geraucht haben«, sagte er und schaute in einem Adressbuch die Adresse nach, die er auf die Rückseite irgendeiner Quittung schrieb. »Steven + Ingrid Lake«, las Phoebe, und dann die Adresse. Sie hatte das Gefühl, die Telefonnummer hätte nicht genug Ziffern. Sie rollte den Joint vorsichtig in den Zettel mit der Adresse ein und steckte das Ganze in ihr Portemonnaie.
»Sag Steve, er soll sich von den Ameisenhaufen fernhalten«, sagte Kyle, der in der Tür stand und lachte. »Er weiß schon, was gemeint ist.«
Phoebe ging jetzt die Stufen zum zweiten Mal hinunter und spürte eine seltsame Erregung. Kyle glaubte also, dass sie jetzt nach Europa ginge – nächste Woche, morgen –, und diese Vorstellung erstaunte Phoebe, gab ihr das aufregende Gefühl, dass jetzt alles möglich war.
Auf der Straße schaute sie noch einmal nach oben. Kyle schaute wieder von seinem Fenster zu ihr herunter und berührte geistesabwesend das Prisma. »Wann fährst du denn los?«, fragte er.
»Bald«, sagte sie und hätte fast gelacht. »Nächste Woche vielleicht.« Sie drehte sich um, weil sie gehen wollte.
»Schick mir ’ne Ansichtskarte«, rief er.
Phoebe merkte, dass sie die grobknochigen viktorianischen Häuser anlächelte. Europa, dachte sie. Vögel, weißer Stein, lange dunkle Brücken. An all die Orte gehen, an denen Faith gewesen war – an alle, einen nach dem anderen. Die Ansichtskarten ihrer Schwester lagen immer noch in einer Schuhschachtel unter dem Bett. Phoebe wusste genau, wie sie immer ganz aufgeregt auf die Karten gewartet hatte, vom ersten Tag an, als ihre Schwester und Wolf an einem Sommertag losgezogen waren, der nicht so sehr viel anders war als der heutige Tag. Sie waren in Wolfs Pick-up zum Flughafen gefahren. Sie hatten noch ein Mädchen dabei, das Wolf den Wagen abgekauft und ihm schon das Geld dafür bezahlt hatte. Als sie weggefahren waren, stand Phoebe noch lange auf dem Bürgersteig und fragte sich, was sie alles erleben würden. Sie fragte sich das seither immer noch.
Ihre Schwester starb am 21. November 1970, auf den Felsen unterhalb von Corniglia, einem winzigen Dorf an der Westküste Norditaliens. Sie war siebzehn; Phoebe war damals zehn. In der Leiche wurden Spuren von Drogen gefunden, Speed, Acid, aber nicht so viel, dass man hätte sagen können, sie sei high gewesen. Wenn sie sich nicht das Genick gebrochen hätte, dann hätte sie wohl überleben können.
Wenn Phoebe die Stunden hätte aneinanderreihen können, in denen sie sich mit diesem Ereignis beschäftigt hatte, dann würden sicher ganze Jahre zusammenkommen. Sie hatte sich in diesen Spekulationen verloren, ihr eigenes Leben war wie eine Hülse von ihr abgefallen, während sie in dem reichen, unendlich tiefen Brunnen versank, der die Abwesenheit ihrer Schwester für sie war. Und je länger Phoebe sich damit beschäftigte, desto sicherer war sie, dass da ein großes Missverständnis vorlag; wenn Faith sich das Leben genommen hätte, dann hätte sie es ohne auch nur die geringste Andeutung des Scheiterns oder der Hoffnungslosigkeit getan, die man immer mit dem Wort »Selbstmord« in Verbindung brachte. Wenn Phoebe an den Tod ihrer Schwester dachte, dann immer mit einer seltsamen Fröhlichkeit, als wäre Faith in eine großartigere Welt eingegangen, in Bezirke, die so weit entfernt waren, dass Faith sie nur erreichen konnte, wenn sie ihr Leben dafür hergab. Wie wenn man eine Leiter unter sich wegschubst. Was hatte das denn mit Scheitern zu tun?
Phoebes Mutter Gail war nach Italien geflogen und hatte Faiths Asche in einem Behälter mit nach Hause gebracht. Sie und Phoebe und Barry hatten die Asche von den Klippen in der Nähe der Golden Gate Bridge verstreut, an einer Stelle, an der sie immer Picknick gemacht hatten. Phoebe erinnerte sich noch daran, wie sie ungläubig die Asche angestarrt hatte, die unterschiedlich großen Stücke, die aussahen wie der Schutt, der im Kamin immer übrig blieb. Ihre Hände waren feucht vor Schweiß gewesen, und als sie die Asche in den Wind warf, blieb immer wieder ganz feiner Staub in den Falten ihrer Hand kleben. Wie sehr sie auch die Hand schüttelte, der Staub ging nicht weg. Hinterher sperrte sie die Tür ihres Zimmers ab und starrte lange ihre Hände an. Es war ruhig im Haus. Phoebe streckte die Zunge heraus und fuhr mit der Zungenspitze ganz leicht über ihre Handfläche. Es schmeckte sauer, salzig. Phoebe flüchtete entsetzt ins Badezimmer und scheuerte sich Hände und Mund im Waschbecken, starrte dann in die Toilettenschüssel und brachte sich so weit, dass sie sich übergeben musste. Später fragte sie sich, ob das, was sie geschmeckt hatte, nicht vielleicht ihr eigener Schweiß gewesen war.
Eine weiße Tür am Ende des Flurs. »Komm jetzt«, hatte Faith gesagt und die Hand nach Wolf ausgestreckt. Sie machten die Tür hinter sich zu.
Phoebe ging draußen hin und her, drückte die Zehen tief in den weichen Teppich. Sie hatte Angst – wovor? Dass ihre Schwester verschwunden blieb. Dass die Tür nie wieder aufgehen würde. Und dass sie, wenn die Tür schließlich doch aufging, sich allein in einem hellen, leeren Zimmer befinden würde.
ZWEI
Wenn Phoebe mit ihrem Bruder in seinem Porsche fuhr, lief jedes Mal zwischen ihnen wortlos eine Mutprobe ab: Barry beschleunigte den Wagen gleichmäßig, immer stärker, weil er wusste, dass Phoebe dann Angst bekam, und weil er wollte, dass sie ihn bitten würde, wieder langsamer zu fahren. Phoebe wäre aber lieber mit dem Auto verunglückt, als dass sie ihrem Bruder diese Genugtuung verschafft hätte. Wenn sie alleine zusammen im Wagen saßen, herrschte eisiges Schweigen zwischen ihnen, während die Tachometernadel sich hin und her bewegte und Phoebe zu Gott betete, dass bald eine rote Ampel käme. Wie lange kann das denn gutgehen, dachte sie dann immer, bevor uns etwas zustößt? Aber sie gab nicht nach.
»Junge, mach jetzt mal halblang«, sagte ihre Mutter, als Barry gleich drei Blocks von ihrem Haus entfernt den Motor hochjagte. »Ich möchte nicht, dass das heute mein letzter Geburtstag ist.«
Es war ein warmer, klarer Tag, wie es ihn in San Francisco im Juni selten gibt. Barry war in Hochstimmung. Er hatte für den Geburtstag ihrer Mutter schon seit Wochen Pläne gemacht, hatte zuerst ein verlängertes Wochenende auf Hawaii vorgeschlagen, dann einen Flug in einem Heißluftballon und schließlich einen Tagesausflug in einer gecharterten Segelyacht. »Ich bin deine Mutter und nicht die Generaldirektorin von Sony«, schimpfte sie und lachte dabei leise, damit Barry ihre Bemerkung nicht ernst nahm. »Machen wir doch ein Picknick.«
Phoebes Bruder war mit dreiundzwanzig schon Millionär. Der Keim seines Reichtums waren die fünftausend Dollar, die ihr Vater jedem von ihnen hinterlassen hatte und die sich durch umsichtige Investitionen ungeheuer vermehrt hatten, als Barry in Berkeley studierte. Nach seinem Studium gründete er mit dem Geld eine Softwarefirma, und als Phoebe ihn zuletzt danach gefragt hatte, wie viele Angestellte er habe, waren es siebenundfünfzig gewesen. Er hatte draußen in den Hügeln bei Los Gatos ein Haus mit vier Schlafzimmern, und in den Ferien überschüttete er Phoebe immer mit Geschenken, die sie vor Dankbarkeit ganz hilflos machten: ein Prince-Tennisschläger, eine Digitaluhr, eine Kette mit echten Perlen, die bei einer bestimmten Beleuchtung einen ganz leichten rosa Schimmer annahmen. Barry erwähnte oft die Namen wichtiger Leute, die er auf Partys kennengelernt hatte, und er betonte dabei immer, dass sie seine Bekanntschaft gesucht hatten und dass er sich ganz besonders gut mit ihnen verstanden hätte. Wenn man Barry glauben durfte, dann waren seine Angestellten praktisch alle absolute Genies und seine Produkte so überragend und phänomenal, dass seine Kunden an ihren Terminals fast ohnmächtig wurden. Obwohl sie es besser wusste, merkte Phoebe manchmal doch, dass sie ihm glaubte und seine Sicht der Dinge übernahm, nach der nicht New York, Paris oder Washington, D.C. der Mittelpunkt der Welt waren, sondern eine Softwarefirma in der Umgebung von Palo Alto.
»Wo fahren wir denn hin?«, fragte Phoebe auf dem Rücksitz, als der Porsche in den Golden Gate Park fuhr.
»Du wirst schon sehen«, sagte Barry. Er unterhielt sich mit ihrer Mutter. Chips, hörte Phoebe, Bytes; lauter solche Wörter. Sie klappte ihr Fenster auf und sog den feuchten Eukalyptusduft des Golden Gate Parks ein. Es war genau eine Woche her, dass sie Kyle hier getroffen hatte, und wie die meisten Erinnerungen an Zeiten, in denen man high ist, hatte auch die Begegnung mit Kyle etwas Bruchstückhaftes, als hätte man alles nur geträumt. Aber das Gefühl, das sie hatte, als sie zu Kyle sagte, sie würde nach Europa gehen, und als er ihr das glaubte – dieses Gefühl konnte Phoebe nicht vergessen.
Sie streckte die Hände nach vorne aus und berührte das blond getönte Haar ihrer Mutter. Obwohl Phoebe ihre Mutter ganz besonders schön fand, war es doch so, dass etwas Altmodisches, etwas irgendwie Überholtes, dazu führte, dass ihre Schönheit für die Außenwelt nicht sichtbar war, nicht wirken konnte. Phoebe war immer regelrecht entmutigt, wenn sie sich alte Fotos anschaute, auf denen ihre junge, bezaubernde Mutter schüchtern unter einem Hut hervorlächelte. Sie erinnerte sich an ihre Eltern, wie ihr Vater immer dalag und den Kopf auf den Schoß ihrer Mutter gelegt hatte, oder wie er ihr einen Klaps auf den Hintern gab. Sie erinnerte sich auch an die Zeit, als ihre Mutter schon Witwe war, erinnerte sich an Claude, den einzigen Liebhaber ihrer Mutter in einer Zeit voll bedeutungsloser Verabredungen – erinnerte sich an die benommene, taumelige Offenheit, die ihre Mutter in Claudes Gegenwart überkam, eine Spannung zwischen den beiden, die das Zimmer wie eine elektrische Ladung erfüllte. Aber Phoebe mochte ihre Mutter am liebsten so, wie sie jetzt war, schwermütig, ein bisschen aus dem Tritt gekommen und mit einem Lachen, das immer einen traurigen Unterton hatte, so als wäre alles nicht so lustig, wie es aussah. Phoebe betrachtete ihre Mutter als jemanden, der immer noch in Trauer war, und das gab ihr ein beruhigendes Gefühl von Sicherheit, so wie wenn man beim Einschlafen weiß, dass jemand anders immer noch aufbleiben wird, Wache hält.
Barry parkte an einer Lichtung mit lauter Obstbäumen, deren Blätter so frisch waren, dass sie feucht wirkten. Er holte die Sachen aus dem Wagen und winkte ab, als sie ihm dabei helfen wollten. Barry war groß und hatte dunkle Haare, seine Augen waren ganz schwarz, als hätte er sie in einem Augenblick des Schreckens weit aufgerissen und als wären sie dann nicht mehr zugegangen. Das war auf Fotos immer besonders eindrucksvoll – »Das ist dein Bruder? Der ist aber scharf«, hatten Phoebes Freundinnen immer gesagt, wenn sie ein Bild von ihm sahen –, aber im wirklichen Leben wurde diese Wirkung etwas beeinträchtigt. Er bewegte sich wie ein Kind, hatte den Hals nach vorne gestreckt, die Arme hingen nach unten, und er wirkte immer, als wollte er gleich den Kopf einziehen.
Barry richtete das Picknick her, eine entmutigend üppige Mischung aus Brie, roten Birnen, Roastbeef, Bagels und gefüllten Weinblättern. In einer Kühlbox hatte er eine Flasche Dom Pérignon und ein winziges Töpfchen Belugakaviar mitgebracht. Ihre Mutter schleuderte mit einer lässigen Beinbewegung ihre Leinenschuhe in die Gegend, nippte an ihrem Champagner, krümmte ihre weißen Zehen und machte sie wieder gerade. Die Haut ihrer Waden war so trocken, dass sie glänzte wie eine Glasur. »Das könnte ich ein paar Tage lang so aushalten«, sagte sie.
Als sie alle etwas von Phoebes Karottenkuchen gegessen hatten, ging Barry zum Wagen und kam mit einem Schwung Geschenke wieder zurück. Er baute sie vor seiner Mutter auf, ein Berg aus Goldfolie und grünen Bändern. »Meine Güte«, sagte sie.
Phoebe hatte ihr Geschenk in eine Tasche ihrer Cordhose gesteckt, ein Silberhalsband von Tiffany zum fünfundzwanzigsten Hochzeitstag ihrer Eltern. Der wäre am Dienstag gewesen. »Fang du an, Bär«, sagte sie, weil sie wusste, dass er das am liebsten täte.
Barry wählte eine Schachtel aus. Ihre Mutter machte sie langsam auf und achtete darauf, dass sie das Geschenkpapier nicht zerriss. Sie machte Geschenke immer so vorsichtig auf, aber danach packte sie einfach das ganze unversehrte Papier mit einer Bewegung zusammen und warf es achtlos weg. »Make-up«, sagte sie, während sie das goldene Geschenkpapier abmachte.
»Das sind die neuesten Farben«, sagte Barry. »Es ist ein ganzes Set.«
Ganze Reihen von farbigen Ovalen schimmerten in dem Set wie die Farben in dem Malkasten, den Phoebe als Kind gehabt hatte. »Ich hab in den letzten Jahren nicht viel Make-up getragen«, sagte ihre Mutter.
»Keine Angst!«, beruhigte Barry sie und hielt ihr ein zweites Geschenk hin. Es war lang und flach. Es enthielt eine Karte.
»›Ein Geschenkgutschein‹«, las sie laut vor. »Für eine komplette Gesichtsrenovierung?«
»Ja, sozusagen«, schaltete sich Barry ein. »Sie überlegen sich, was für dein Gesicht am besten ist, und dann zeigen sie dir, was du machen musst.«
»In meinem Fall würde eine Papiertüte reichen«, sagte ihre Mutter und legte den Arm um Barry. »Ehrlich, mein Kleiner, du hast dir wirklich Zeit dafür genommen.«
In der nächsten Schachtel lag noch ein Geschenkgutschein, diesmal für einen Friseur. Ihre Mutter fuhr mit der Hand in Barrys Haar und strubbelte es. »Entschuldige«, sagte sie. »Aber die Frisur, die du jetzt auf dem Kopf hast, war 65 der letzte Schrei.«
Aber Barry schien gar nicht zuzuhören. Er stand hoch aufgerichtet vor ihrer Mutter und gab ihr ein Geschenk nach dem anderen, so schnell sie die Sachen nur aufmachen konnte. Phoebe starrte die frischen neuen Blätter an den Zweigen über sich an. Sie war zornig. Wie unhöflich, dachte sie, wie grob, absolut beleidigend. Hatte Barry den Verstand verloren?
Noch ein Geschenkgutschein, diesmal für das Centurion, ein Bekleidungsgeschäft in der Union Street. »Das ist zu viel«, sagte ihre Mutter. »Jetzt übertreibst du es wirklich!«
»Und jetzt«, sagte Barry, »die Krönung des Ganzen, Geschenk Nummer fünf.«
Ihre Mutter machte die Verpackung der letzten Schachtel auf und runzelte die Stirn. »Modekoordinator«, sagte sie. »Das klingt ja wie eine Maschine.«
»Nein, nein, das ist ein Mann«, erklärte Barry. »Du gehst mit ihm in den Laden, und er hilft dir bei der Auswahl und sagt dir, was du kaufen sollst. Er weiß, was für ein Stil gerade ›in‹ ist.«
Für einen Augenblick war es ganz still. Ihre Mutter hob den Blick von dem Berg aus goldenem Geschenkpapier, und Phoebe entdeckte in Barrys Gesicht einen Anflug von Verzweiflung, so als würde das Gewicht dieser vielen Geschenke plötzlich ganz auf ihm lasten. »Ich hab es nicht böse gemeint …«, sagte er.
»Natürlich nicht«, sagte ihre Mutter und schaute Phoebe an. »Er hat recht, stimmt’s? Ich hab mich irgendwie zu einer Vogelscheuche entwickelt.«
»Du bist keine Vogelscheuche«, sagte Phoebe.
»Hoffentlich machst du auch Gebrauch von den ganzen Sachen«, sagte Barry. »Ich meine, dass du sie nicht im Schrank versteckst oder sonst wo.« Sein Blick wanderte zu Phoebe, als spürte er, wie gerne sie ihm jetzt eins ausgewischt hätte.
»Es ist wirklich komisch«, sagte ihre Mutter. »Ich überlege mir nämlich schon seit ein paar Monaten, ob ich nicht meine äußere Erscheinung ein bisschen … aufmöbeln sollte.«
»Im Ernst?«, sagte Phoebe betroffen.
»Ja, ehrlich. Aber ich hatte keine Ahnung, womit ich anfangen sollte. Das war wirklich ein regelrecht unheimliches Timing, Barry.«
Phoebe ließ sich das besorgt durch den Kopf gehen. Es dauerte ein paar Augenblicke, bevor sie sich an ihr eigenes Geschenk erinnerte und es umständlich aus der Tasche zog.
»Noch mehr Geschenke«, sagte ihre Mutter. »Was hab ich doch für verschwenderische Kinder.«
Barry schaute schweigend zu. Phoebe spürte schon seinen Ärger, die Angst, übertrumpft zu werden. Ihre Mutter machte das Seidenpapier vorsichtig ab, öffnete die Schachtel und sah das blaue Säckchen von Tiffany. »Das ist aber ein schönes Säckchen«, sagte sie. »Das kann ich bestimmt noch mal für irgendwas brauchen.« Sie machte langsam weiter, hielt dieses eine Geschenk von Phoebe gegen alle Geschenke Barrys und dehnte diesen Augenblick aus.
Sie löste die Kordel, mit der das Säckchen zugezogen war, und fand das Halsband: ein massiver Anhänger aus Silber, der an einer dünnen Kette hing. »Oh«, sagte sie. »Oh, Phoebe, das ist wunderschön. Hilf mir mal damit.« Sie hob ihr Haar hoch, und Phoebe machte den Verschluss zu, so dass der silberne Anhänger in der kleinen Mulde über dem Schlüsselbein lag.
»Nett«, sagte Barry und veränderte seine Sitzhaltung auf dem Gras. »Das ist hübsch, Pheeb.«
»Es ist sensationell«, sagte ihre Mutter und küsste Phoebe auf die Wange. Phoebe spürte den Geruch in ihrer Bluse, den herben Zitronengeruch ihres Parfüms. Ihre Mutter roch immer gleich.
Phoebe hielt den Blick auf ihre Mutter gerichtet, wartete auf ein Zeichen dafür, dass sie gemerkt hatte, was das Halsband bedeutete. Sie würde es wahrscheinlich schaffen, ohne dass Barry es mitbekam – nur mit einem Blick, der sie beide an die verschwundenen Jahre, an die verschwundene Zeit erinnerte.
Ihre Mutter schloss die Augen und hielt ihr Gesicht in die Sonne. Phoebe schaute sie an, bis sie die Augen wieder aufmachte. »Was ist denn?«, sagte ihre Mutter und richtete sich auf.
Phoebe schaute sie nur unverwandt an. Sie hörte das entfernte Pochen von Bongotrommeln.
»Kindchen, stimmt etwas nicht?« Phoebe hielt die Augen weit geöffnet. »Phoebe?«
»Kapierst du denn nicht?«, rief Phoebe verzweifelt.
»Was soll ich …«
»Silber.« Sie war verblüfft, dass sie das eigens sagen musste.
Ihre Mutter fasste das Halsband an. »Ja, ich – ich mag Silber.«
»Denk doch nach. Sil-ber«, sagte Phoebe und dehnte das Wort. »Ich kann es einfach nicht fassen, dass du das nicht verstehst!«
»Was gibt’s denn da zu verstehen?«, rief Barry. »Himmel noch mal, Phoebe, sie hat doch gesagt, dass es ihr gefällt.«
Ihre Mutter fuhr sich nervös mit den Händen an den Hals.
»Silber! Für euren fünfundzwanzigsten.«
Aber auch jetzt blieb das Gesicht ihrer Mutter leer. Phoebe spürte ein Pochen in ihrer Magengegend – Angst.
»Oh, ich verstehe«, rief ihre Mutter schließlich erleichtert. »Unser fünfundzwanzigster, natürlich. Aber das war letztes Jahr.«
Phoebe fuhr hoch. »Letztes Jahr? Wie soll das denn zugehen?«
»Was war letztes Jahr?«, sagte Barry.
»Wir haben 52 geheiratet.«
»52! Ich hab gedacht, das war 53.«
»Das macht doch nichts, Kind. Wirklich, das macht überhaupt nichts.« Ihre Mutter schien sich immer noch ein bisschen überrumpelt zu fühlen. »Meine Güte«, sagte sie, »hast du mir Angst gemacht.«
»Schluss. Schluss jetzt!«, sagte Barry. »Kann mir bitte mal jemand erklären, was dieses Halsband damit zu tun haben soll, dass du und Dad geheiratet habt?«
»Silber«, sagte ihre Mutter. »Man schenkt jemandem zum fünfundzwanzigsten Hochzeitstag etwas aus Silber.«
Barry lehnte sich zurück und starrte grimmig in die Bäume hinauf. »Ich hab’s kapiert«, sagte er.
»Das war ganz lieb von dir«, sagte ihre Mutter, aber nicht mit der Überzeugungskraft, die Phoebe sich so sehr gewünscht hatte.
Barry sagte gar nichts. Phoebe folgte seinem Blick hinauf zu einem langen, regenbogenfarbenen Drachen, der dicht über den Bäumen in kurzen Bewegungen hin und her flog. Ein Muskel zuckte in Barrys Gesicht. »Sei nicht böse, Bär«, sagte sie.
»Ach ja. Jetzt bin ich daran schuld.«
Ihre Mutter ließ die Schultern sinken. Phoebe spürte ihre Niederlage und machte sich Vorwürfe, dass sie das Jahr verwechselt hatte. Sie schaute zu den Bäumen hinüber. Ein alter Mann bräunte sein Gesicht und seine Brust mit einer dieser glitzernden Bräunungsfolien, die er sich umgehängt hatte. Hinter all diesen Dingen lag ein Gerüst aus vergangenen Ereignissen, eine Konstruktion, auf der die Gegenwart wie ein Fell gespannt war. Ein Fehler in diesem Rahmen, und die Welt kam einem sinnlos vor – Wolken, Hunde, Kinder mit fluoreszierenden Jo-Jos – wie passten sie da hinein? Was für einen Sinn hatten sie? »52«, sagte Phoebe und versuchte, wieder ruhiger zu werden. »Ich kann nicht glauben, dass es 52 war.«
Barry öffnete den Mund, um zu antworten, stieß aber nur die Luft aus. Ihre Mutter nahm Phoebes Hand. Die Hand ihrer Mutter war schmal und warm, voll starker Venen. Phoebe entspannte sich. Offensichtlich sah ihre Mutter das Gerüst, die Konstruktion; sie sah alles.
Ihre Mutter musste ins Büro. Sie arbeitete oft am Wochenende, ein Umstand, der bei Barry zu Wutausbrüchen führte, die sich auf Jack Lamont richteten, ihren Chef. Sie fuhren schweigend zu dem Gebäude in der Post Street, in dem sich ihr Büro befand. »Ich hab die wunderbarsten Kinder auf der Welt«, sagte ihre Mutter, als sie aus dem Wagen ausstieg. Phoebe blieb zusammengesunken auf dem Rücksitz und ließ Barry vorne alleine. Als er die Pine Street hinunterdonnerte und dabei schon über Ampeln fuhr, gerade bevor sie auf Grün sprangen, machte Phoebe die Augen zu und versuchte herauszufinden, wann genau sie und ihr Bruder sich zum ersten Mal gegeneinander gestellt hatten. Aber wie weit sie auch zurückdachte, es schien immer noch weiter zurückzuliegen.
In der Auffahrt zum Haus stellte Barry den Motor ab. »Ich will mit dir reden«, sagte er und ging vor ihr her zum Haus. Solange Phoebe auf der Welt war, hatten sie in diesem ausladenden viktorianischen Haus in der Clay Street gewohnt. In den letzten Jahren war es ein bisschen heruntergekommen, der Anstrich war stumpf geworden und abgeblättert, zu große wuchernde Bäume lehnten sich ans Fenster, als hätten sie das Gleichgewicht verloren. Der zweite Stock war schon vor Jahren abgetrennt und als separate Wohnung vermietet worden.
Barry folgte Phoebe in die Küche. »Setz dich«, sagte er. Sie gehorchte, und ihr Herz raste. »Das muss aufhören, Phoebe. Und du weißt das auch.«
»Was?«, sagte Phoebe. Aber er hatte recht. Sie wusste es.
»Das mit dir und Mom«, sagte er. »So wie ihr lebt.«
»Aber du bist doch kaum da.«
»Das stimmt schon«, antwortete Barry energisch. »Mir tut es richtig körperlich weh, wenn ich in dieses Haus komme! Herrgott, Phoebe, das ist Jahre her, und nichts hat sich verändert; es ist wie in Große Erwartungen von Dickens.«
Phoebe hörte voller Angst zu. Er hatte recht, dachte sie, er musste recht haben. Sie hatte Große Erwartungen gelesen, konnte sich aber nicht denken, an welche Stelle er dachte.
»Nein, um dich mach ich mir keine Sorgen«, fuhr Barry fort. »Du gehst ja jetzt dann aufs College. Aber um Mom mach ich mir Sorgen. Sie ist alleine in diesem Haus hier, und dieses Arschloch von Boss stiehlt ihr ihre ganze Zeit, und sie ist siebenundvierzig Jahre alt, Phoebe. Denk mal drüber nach. Siebenundvierzig.«
»Aber ich lass sie nicht im Stich«, rief Phoebe. »Sie wird nie alleine sein.«
Das war die falsche Antwort. Barry schoss regelrecht auf sie zu und schaute sie mit einem wilden, fast schon selbstvergessenen Blick an. »Phoebe, kapierst du das denn nicht?«, brüllte er. »Du musst hier weg, genau das meine ich doch! Sie braucht dich nicht mehr.«
»Deswegen hast du ihr also dieses ganze Zeug geschenkt«, sagte Phoebe, die jetzt voller Zorn war. »Damit sie sich noch einen Mann angelt, bevor es zu spät ist.«
»Ja, um es ganz krass auszudrücken.« Sie sagten beide nichts, und dann fuhr Barry mit leiserer Stimme fort. »Nach der Sache mit Faith ist Mom irgendwie erstarrt.«
»Du meinst, wegen diesem einen Mann?«
»Der einzige Mann seit Dad! Und Mom hat Claude geliebt –«
»Darüber will ich nicht reden.«
»Aber als Faith gestorben ist, da hat sie ihn einfach –«
»Hör auf, Bär.« Phoebe hielt sich die Ohren zu. Aber sie konnte ihn immer noch hören.
»– kaltgestellt. So als könnte sie das jetzt nicht mehr haben. Als eine Art Bestrafung.«
Er hatte so etwas noch nie gesagt. Phoebe war erstaunt. »Sie geht manchmal mit Männern aus«, sagte sie schließlich, den Blick auf ein Platzdeckchen aus Stroh gerichtet. »Mom unternimmt doch was, sie geht doch weg.«
»Ja, sie geht weg«, sagte Barry höhnisch. »Und dann kommt sie wieder zu dir zurück, in dieses Haus –«
»Wir wohnen hier! Was soll sie denn sonst tun?«
»Lasst los«, sagte Barry. Seine Stimme war jetzt ganz leise. »Lasst doch einfach los.«
»Was sollen wir loslassen?«, fragte Phoebe voller Angst. »Uns?«
»Alles. Dad, Faith, einfach alles. Ja« – seine Hände flogen in die Höhe, ein Blitzen weißer Haut – »lasst doch einfach los.«
Phoebe legte den Kopf auf die Tischplatte. Barry rückte zu ihr heran und berührte ihr Haar, und irgendetwas in Phoebe entkrampfte sich, vertraute ihm. »Du wirst staunen, wie leicht das ist«, sagte er.
»Und was ist, wenn wir nicht wollen?«
Diese Frage nahm ihm anscheinend den Wind aus den Segeln. Phoebe hob den Kopf, setzte sich dann aufrecht hin. »Ich meine, warum sollten wir das tun?«, sagte sie noch ganz verwirrt. »Für dich? Weil du es sagst?«
»Natürlich nicht für mich – für euch«, sagte Barry und rückte ein Stück von ihr weg. »Für dich und Mom.«
»Aber wir sind doch vollkommen glücklich. Nur du nimmst alles so tragisch, Bär. Ich meine – warte mal einen Augenblick«, sagte Phoebe, rückte vom Tisch zurück, um aufzustehen, während ihr etwas klarwurde, was sie bis jetzt noch nicht gewusst hatte. »Ich weiß, warum du das alles sagst, es ist wegen Faith.«
»Blödsinn«, sagte Barry unsicher.
»Du willst, dass sie verschwindet«, sagte Phoebe, und dieser Satz gab ihr das Gefühl, sie würde taumeln. »Du willst sie auslöschen!«
Barry machte den Mund auf, brachte aber keinen Ton heraus, und Phoebe wusste, dass sie eine empfindliche Stelle getroffen hatte. »Du willst, dass sie verschwindet, damit alle nur noch dich mögen.«
Die kurzen Bartstoppeln ihres Bruders hoben sich blau von seiner Gesichtshaut ab. »Ich weiß nicht, wovon du redest«, sagte er.
»Du hast Angst«, sagte Phoebe. »Ich seh das.«
Sie standen auf verschiedenen Seiten der Küche und schauten sich an. Phoebe spürte, wie ein Machtgefühl in ihr aufstieg, Macht über Barry, und ganz abrupt wieder verschwand. »Vergiss es, Bär«, sagte sie und ging auf ihn zu. Sie entspannten sich beide, als sie sich umarmten. Ein seltener Augenblick. Sogar ihre Umarmungen waren meistens verkrampft.
Dann schob Barry sie von sich weg. »Verdammt noch mal, Phoebe. Du hast nichts von dem gehört, was ich gesagt habe.«
»Doch«, sagte sie. »Ich hab es versucht.«
Er lachte sie aus. »Du willst es gar nicht versuchen«, sagte er. »Und das ist mir völlig schleierhaft, weil du ja nichts zu verlieren hast.« Er wartete. »Nichts! Verstehst du das denn nicht? Das hier ist nichts. Du sitzt hier auf nichts.« Er ging hinaus.
»Das ist nicht nichts!«, rief Phoebe hinter ihm her, aber Barry war schon durch die Haustür gegangen und schlug sie hinter sich zu, so dass der Boden zitterte. Phoebe hörte den Auspuff seines Motors noch ein paar Blocks weit. Sie stellte sich das Gefühl von Freiheit vor, das Barry spüren musste, wenn er über den Freeway nach Los Gatos raste und das Kassettendeck ganz laut aufgedreht hatte. Sie hätte gerne einen Führerschein gehabt.
Zwei oder drei Monate, nachdem ihr Vater gestorben war, hatte Barry an einem Samstag beschlossen, den Lagerraum im Keller auszuräumen, um Platz für eine Erfinderwerkstatt zu schaffen. Das kleine Zimmer war vollgestopft mit den Gemälden ihres Vaters: mit Hunderten von Bildern, von denen er viele in den letzten Monaten vor seinem Tod gemalt hatte. Auf fast allen Bildern war Faith zu sehen. Barry beschloss, sie wegzuwerfen.
Er packte den ersten Schwung Bilder in einen riesigen Karton und schleifte ihn auf die Straße hinaus. Faith war auch gerade vorm Haus und stutzte Efeu mit einer großen Heckenschere. Phoebe saß neben ihr auf dem mit Backsteinplatten ausgelegten Weg, drehte Efeustängel wie Propeller, ließ sie dann los und schaute zu, wie sie einen Augenblick lang flogen.
»Was hast du denn da drin?«, fragte Faith, als Barry mühsam den Karton die Einfahrt entlangschleifte.
»Ein paar alte Sachen von Dad.«
Faith ging zu ihm hinüber, sie hatte immer noch die Heckenschere in der Hand, und schaute in den Karton. Sie nahm eines der Bilder heraus, ein Porträt von ihr im Hinterhof. Sie lächelte auf dem Bild. »Bär, was machst du denn mit den Bildern?«
»Ich werf sie alle raus.«
Faith war offensichtlich irritiert. Sie hatte kaum etwas essen können, und die Heckenschere in ihrer Hand wirkte schwer und dunkel. »Bring sie wieder zurück«, sagte sie zu Barry.
»Da ist kein Platz.«
»Tu sie wieder dahin, wo sie waren, Bär. Bring sie in den Keller.«
»Ich werf sie raus!«
»Das sind Dads Bilder!«, rief Faith.
Barry drängte sich an ihr vorbei und zog den Karton hinter sich her über das Pflaster. Es gab ein kratzendes Geräusch.
»Hör auf«, rief Faith. »Gib sie – gib sie einfach mir.«
Aber irgendetwas war mit Barry passiert. »Ich will sie da raus haben«, brüllte er. »Diese Dinger geh’n mir auf den Geist!« Auf seinem Gesicht waren Tränen. Er nahm eines der Bilder aus dem Karton und warf es auf die Straße. Da lag Faith, mit dem Gesicht nach oben auf dem Beton. Sie schrie auf, als habe sie den Aufprall gespürt. Barry nahm ein zweites Bild und wollte es mit den Händen zerbrechen. Phoebe lief zu ihrem Bruder und hielt ihm die Arme fest, aber er schüttelte sie einfach ab, nahm drei Bilder aus dem Karton und schleuderte sie so weit weg, wie er nur konnte. Zwei der Bilder machten ein paar fröhliche Purzelbäume, bevor sie auf die Seite kippten. Barry war ein wilder, drahtiger Junge, und er konnte sich schnell bewegen. Schon bald waren Porträts von Faith über die ganze Straße verstreut: Pastellzeichnungen, Aquarelle und noch feucht wirkende Ölbilder.
Faith schluchzte. Sie hielt Barry die Heckenschere vors Gesicht. »Hör auf«, schrie sie. »Oder ich bring dich um!«
Barry unterbrach sein Werk. Er schaute die Schere an, dann lächelte er. Er zerbrach ein Bild über seinem Knie. Faith stieß sich die Schere in den Oberschenkel.
Dann blieb plötzlich alles stehen. Barrys Gesicht wurde so weiß, dass Phoebe zuerst glaubte, ihre Schwester habe sich und ihn umgebracht, alle beide. Es entstand eine lange, fast friedliche Pause, in der keiner von ihnen sich bewegte und der Tag wie ein Flirren um sie herum war.
Dann passierte alles gleichzeitig: Faith sank auf den Boden. Barry riss sich das T-Shirt vom Leib und band damit ihr Bein ab. Phoebe klopfte mit aller Kraft an die Tür ihrer Nachbarin, Mrs Rose, die sie in ihrem klapprigen Kombi zum Kinderkrankenhaus transportierte. Es gab Spritzen, es wurde genäht, und es gab eine Menge Fragen. Es war ein Spiel gewesen, das behaupteten sie alle drei ganz fest – ganz instinktiv, ohne dass sie das miteinander abgesprochen hätten –, ein Spiel, das zu weit gegangen war.
Immer, wenn sie daran dachte, war es Phoebe so vorgekommen, als hätte sich an diesem Tag etwas zwischen ihnen dreien unumstößlich verändert. Als Faith in der Notaufnahme lag, ganz bleich vom Blutverlust, sah Phoebe im Gesicht ihrer Schwester eine Art von Verwunderung über das, was sie getan hatte. Über die Macht, die sie hatte. Das war im Frühjahr 1966 gewesen. Im Herbst kam Faith dann in die Highschool, und innerhalb eines Jahres war sie tief eingetaucht in das, was man später, im Rückblick, die sechziger Jahre nannte. Aber als Faith und Barry ihren Streit miteinander hatten, war noch nichts von alledem passiert. Faith war dreizehn und trug grüne Baumwollhosen. Sie wusste nichts von Drogen. Sogar der erste von ihren vielen Freunden hatte die Schwelle ihres Hauses noch nicht übertreten.
Barry ging Faith nach dem Streit aus dem Weg. Er beobachtete sie immer nur aus der Entfernung, folgte ihren Bewegungen mit seinen dunklen Augen. Er hatte Angst vor ihr. Und Faith schien nach diesem Tag vor nichts mehr Angst zu haben.
Phoebe ging nach oben in das alte Zimmer ihrer Schwester und machte die Tür zu. Nach dem Tod von Faith hatte ihre Mutter das Zimmer ausräumen wollen, aber Phoebe hatte so heftig dagegen protestiert, dass ihre Mutter erst einmal damit wartete, und aus ein paar Monaten wurde ein Jahr, dann zwei; dann war es irgendwie zu spät.
In den letzten drei Jahren hatte Phoebe in diesem Zimmer geschlafen. Nur geschlafen. Ihre Kleider und ihre anderen Sachen blieben weiter in ihrem alten Zimmer am anderen Ende des Flurs. Phoebe wusste, dass ihrer Mutter diese Regelung nicht gefiel, weil sie nie in Faiths Zimmer kam und sich aufs Bett setzte und sich mit ihr unterhielt, so wie sie es früher gemacht hatte.
Faith hatte die Decke ihres Zimmers mit ganzen Bahnen von blauen Batiktüchern verhängt. Ihre Regale waren voll mit Glaspyramiden, Skarabäengemmen, seltenen Perlen und winzigen goldenen Räuchergefäßen. Draußen vor dem Fenster hing ein billiges Windspiel, trübe, pfirsichfarbene Scheiben, die einen an Hostien erinnerten. Phoebe glaubte, dass das Material aus dem Meer stammte. Das Windspiel klang wie das Auf und Ab von hellem Kinderlachen oder wie etwas Schönes, das in Stücke zersprang.
Phoebe, die immer noch ihre Wildlederstiefel trug, warf sich aufs Bett, hörte Faiths Windspiel zu und spürte, wie sich das Haus enger um sie schmiegte, so wie es das immer tat, wenn Fremde weggingen. Faiths Zimmer hing voller Bilder, Fotos von grinsenden, zahnlosen Gesichtern und von Weihnachtsbäumen, und Geburtstagskuchen, die hoch oben über den Gesichtern von Kindern schwebten, die bunte, spitze Zauberhüte trugen. Faith hatte Bilder gemocht – Fotos, die Zeichnungen ihres Vaters, das war ganz egal –, sie hatte eine große Sehnsucht nach allem, was ein Spiegelbild ihres eigenen Lebens zurückwarf.
Im Schrank ihrer Schwester stapelten sich alle möglichen Sachen, ein mexikanischer Strohhut, der mit Blumen bestickt war, ein rindsledernes Portemonnaie, fleischfarbenes Pfeilkraut von den regenschweren Wiesen in der Umgebung von St. Louis, und weiter und weiter, und immer und immer mehr Sachen, bis man ganz unten etwas fand – aber was? Phoebe wusste es nicht. Aber da musste etwas sein. Unter den vergessenen Augenblicken im Leben ihrer Schwester lag der Schlüssel zu einem Geheimnis vergraben, unter diesen Augenblicken, wenn sie zum Beispiel in einer Tür lehnte oder auf dem Bett lag und mit einem Wecker herumspielte. Wenn Phoebe alleine im Haus war, dann hörte sie oft ein leises Summen, spürte etwas unter sich, um sich herum. Und Faiths Zimmer war die Tür dazu.
Es war nicht leicht, das Zimmer in Ordnung zu halten. Bilder fielen von den Wänden, auf den Batiktüchern sammelte sich Staub. Phoebe schlug von unten mit einem Besen dagegen, so dass dichte Staubflocken herunterkamen, die sie dann vom Teppich aufsaugte. Sie hatte die Batiktücher schon zweimal abgenommen, hatte sie mit der Hand gewaschen, im Hof zum Trocknen aufgehängt und sie dann wieder genauso befestigt, wie sie vorher dagehangen hatten, oder fast genauso. Aber obwohl sie sich die größte Mühe gab, war das Zimmer doch einer Art Erosion ausgesetzt, einmal hing etwas durch, einmal wellte sich irgendwo etwas, oder irgendetwas bleichte aus. Sie konnte es nicht aufhalten.
Phoebe brachte selten Freunde mit nach Hause, weil sie wusste, dass die meisten sie für verrückt halten würden. Aber sie fand das seltsam – wieso sollte es denn verrückter sein, im Zimmer seiner Schwester zu schlafen, als sich, wie ihre Freundin Celeste, mit lebensgroßen Postern von Roger Daltrey zu umgeben, die ihn alle zeigten, wie er in ein Mikrophon brüllte, oder das Privatleben von Starsky und Hutch zu erforschen, oder die ganze Nacht auf dem Bürgersteig zu schlafen, nur damit man gute Plätze für ein Konzert von Paul McCartney bekam? Von völlig fremden Leuten fasziniert zu sein galt als völlig normal, aber bei den paar Gelegenheiten, als Leute von außerhalb der Familie in Faiths Zimmer kamen, sah Phoebe sich mit den Augen dieser Leute und war entsetzt. Deshalb ließ sie niemanden mehr herein.