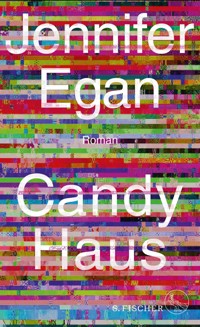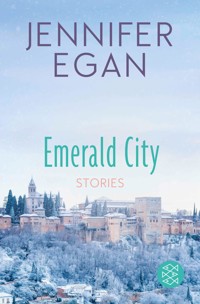
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Elf meisterhafte Stories. Das erste Buch von Pulitzer-Preisträgerin und Bestsellerautorin Jennifer Egan Es ist die Sehnsucht, die die Menschen in Jennifer Egans brillanten Geschichten umtreibt. Die Sehnsucht nach Veränderung, nach Befreiung, nach Glück. Erfolglose Models und enttäuschte Ehefrauen, Wall-Street-Banker und Betrüger, orientierungslose Schulkinder und Drogendealer – alle vereint auf der Suche nach etwas außerhalb ihrer eigenen Erfahrungswelt. An exotischen Orten wie China und Bora Bora, dem kosmopolitischen Manhattan oder der vertrauten Vorstadt. »Emerald City« kreist um die unbegrenzten Möglichkeiten der Phantasie und die Abenteuer der Seele.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jennifer Egan
Emerald City
Stories
Über dieses Buch
Es ist die Sehnsucht, die die Menschen in Jennifer Egans brillanten Geschichten umtreibt. Die Sehnsucht nach Veränderung, nach Befreiung, nach Glück. Erfolglose Models und enttäuschte Ehefrauen, Wall-Street-Banker und Betrüger, orientierungslose Schulkinder und Drogendealer – alle vereint auf der Suche nach etwas außerhalb ihrer eigenen Erfahrungswelt. An exotischen Orten wie China und Bora Bora, dem kosmopolitischen Manhattan oder der vertrauten Vorstadt. »Emerald City« kreist um die unbegrenzten Möglichkeiten der Phantasie und die Abenteuer der Seele.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jennifer Egan wurde 1962 in Chicago geboren und wuchs in San Francisco auf. Sie lebt heute mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Brooklyn, New York. Neben ihren Romanen und Kurzgeschichten schreibt sie für den New Yorker sowie das New York Times Magazine und lehrt an der Columbia University Creative Writing. Für ihren Roman »Der größere Teil der Welt« erhielt sie 2011 den Pulitzer Prize, den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize. Ihr aktueller Roman »Manhattan Beach« erstürmte gleich bei Erscheinen die New York Times-Bestsellerliste und erhielt hymnische Presse.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Frankfurt am Main, April 2020
© 1996 Jennifer Egan
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel ›Emerald City‹ bei Nan A. Talese / Doubleday, New York.
Die deutschsprachige Ausgabe erschien erstmals 2000 bei Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung GmbH, Frankfurt am Main.
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: Getty Images/David Skinner
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490776-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Warum China?
Sacred Heart
Emerald City
Die Stylistin
Ein richtiges Teil
Der Uhrentrick
Bedürftig sind wir alle
Puerto Vallarta
Spanischer Winter
Brief an Josephine
Mondschwestern
[Dank]
Für David Herskovits
Warum China?
Keine Frage. Es war der Typ. Ich erkannte ihn schon von weitem. Daran, wie er den Kopf hielt oder das Kinn. Noch bevor ich begriff, wen ich da sah, wurde mir flau im Magen. Durch die Akupunkteure, die Kräuterdoktoren, die senfgelbe Breiumschläge auf blutende Wunden klatschten, und die Verkäufer von Plateauschuhen und ausgestellten Polyesterhosen, die in Kunming mysteriöserweise alle Leute trugen, bahnte ich mir einen Weg zu ihm. Ich befürchtete, dass er mich erkannt hatte. Doch dann fiel mir ein, dass ich vor zwei Jahren, als er mich abgezockt hatte, noch bartlos gewesen war und nun – nach Aussage alter, bei meinem Anblick durchweg verblüffter Freunde – vollkommen anders aussah (besser, wollte ich immer noch hören).
Wir waren die beiden einzigen Nichtasiaten auf dem Straßenmarkt, der eine lange Fahrradfahrt von meinem Hotel entfernt und in einer Weise schäbig war, die ich nicht recht benennen konnte. »Tag«, sagte der Mann, als ich auf ihn zutrat.
»Hallo«, erwiderte ich. Er war es. Definitiv. Ich achte immer auf Augen, und seine waren komisch hell graugrün, mit langen Wimpern, wie kleine Kinder sie haben. Als ich ihn kennengelernt hatte, trug er einen Anzug und ein kurzes Pferdeschwänzchen – was damals an der Wall Street als hip galt. Ein Blick, und man wusste Bescheid: Wrangler-Jeep, brandneue Skier, eine vielversprechende Kunstsammlung, einschließlich eines Werks meiner Frau, wenn er den Mumm hatte, sich über Fischl, Schnabel und Basquiat hinauszuwagen. Vor New Yorkern wie ihm erstarrten wir in San Francisco immer ein wenig in Ehrfurcht. Nun hatte er das Haar ungleichmäßig kurz geschnitten und trug irgend so eine gewebte Jacke.
»Sind Sie schon lange hier?«, fragte ich.
»Hier, wo?«
»In China.«
»Acht Monate«, sagte er. »Ich arbeite für die China Times.«
Seltsam gehemmt, steckte ich die Hände in die Taschen, als sei ich derjenige, der etwas zu verbergen habe. »Und an was arbeiten Sie gerade?«
»An Drogen«, sagte er.
»Ich dachte, hier gäb’s keine.«
Müde lächelnd beugte er sich zu mir vor. »Sie befinden sich in der Heroinmetropole Chinas.«
»Ach du Scheiße«, sagte ich.
Er wippte auf den Füßen. Ich hätte höflich Auf Wiedersehen sagen und weitergehen müssen, doch ich rührte mich nicht vom Fleck.
»Sind Sie mit einer Gruppe hier?«, fragte er schließlich. »Nein, mit meiner Frau und meinen Kindern. Wir versuchen, einen Zug nach Chengdu zu kriegen, wir warten schon seit fünf Tagen auf die Fahrkarten.«
»Und woran hakt’s?«
»Mei you«, erwiderte ich, die chinesische Universalantwort »Gibt’s nicht« zitierend. Was oder welche Umstände aus dem »nicht« eventuell ein »doch« machen, weiß man nie. »Das sagen die Leute im Hotel jedenfalls immer.«
»Ach, die können Sie doch sonst wo lecken«, sagte er.
Schweigend blieben wir einen Moment stehen, dann schaute er auf die Uhr. »Hören Sie, wenn Sie ein paar Minuten hier warten, kann ich Ihnen die Fahrkarten wahrscheinlich besorgen«, sagte er.
Als er im Davongehen einem lahmen Albino-Chinesen, der neben einem Gebäude am Markt hockte, ein paar Worte zuwarf, dachte ich: Von wegen China Times, sieht mir mehr nach Heroindealer aus. Gleichzeitig war es unleugbar aufregend, mit diesem Typen zusammen zu sein. Er war ein Hochstapler – das wusste ich, aber er hatte keine Ahnung, dass ich es wusste. Ich genoss, dass ich ihm das voraus hatte; es machte beinahe die fünfundzwanzig Riesen wett, um die er mich betrogen hatte.
Auf unseren Fahrrädern fuhren wir zurück ins Stadtzentrum. Mit Caroline und den Mädchen nahm ich immer ein Taxi, was alles sein konnte, vom Auto bis zum Karren, der von einem mageren, schwitzenden Burschen auf einem Fahrrad gezogen wurde. Es nervte mich, dass wir zu viert nicht mit dem Fahrrad fahren konnten wie jede andere chinesische Familie auch. (»Seit wann sind wir eine chinesische Familie, Sam?«, fragte meine Frau.) Doch die Mädchen behaupteten, sie hätten furchtbare Angst, von den Rädern zu fallen und von den dichten, klappernden Scharen der – völlig unnütz mit ihren blechernen Klingeln lärmenden – Fahrradfahrer überrollt zu werden. Insgeheim glaubte ich allerdings, dass meine Töchter keine Lust auf die mickrigen, schwarzen Drahtesel der Chinesen hatten, die gegenüber den glänzenden Fünf- und Zehngangrädern, mit denen Melissa und Kylie groß geworden sind, viel zu poplig waren.
Bei unserer ersten Begegnung hieß er Cameron Pierce. Als wir nun daherradelten, stellte er sich als Stuart Peale vor; er schrie es durch das donnernde Getöse vorbeifahrender Lastwagen. Die Namen passten wie die Faust aufs Auge, damals wie heute; Cameron hatte ungeduldig und visionär geklungen, nach einem Mann, der überzeugt ist, dass er ein Schweinegeld machen kann; Stuart klang sanft, nach einem feinen Beobachter – was man von einem Reporter auch erwarten würde. Als ich ihm meinen Namen sagte – Sam Lafferty –, hoffte ich halbwegs, dass es bei ihm klickte, doch erst als ich die Firma nannte, für die ich arbeitete, merkte ich, wie er eine Sekunde lang stutzte.
»Ich habe Urlaub genommen, während eine Untersuchung gegen mich durchgeführt wird«, sagte ich zu meinem eigenen Erstaunen.
»Untersuchung? Weshalb?«
»Zahlen frisiert.« Und obwohl ich selbst erschrak vor dem, was ich da offenbarte, spürte ich einen idiotischen Drang weiterzureden. »Bisher ist es nur intern.«
»Oje«, sagte er und schaute mich merkwürdig an. »Viel Glück.«
Wir stiegen vor einer Betonhalle ab, vor der sich Menschenmassen in langen Schlangen in aller Freundlichkeit auf einen Fahrkartenschalter zuschoben und -drängelten, was ich einzigartig chinesisch fand. In hektischem, wenn auch (vermutete ich) gebrochenem Chinesisch sprach Stuart mit einem uniformierten Beamten und winkte mich zu sich. Schließlich führte uns der Beamte widerwillig durch eine Seitentür und einen trübe beleuchteten Flur entlang, in dem die stickige Anstaltsatmosphäre der staatlichen Schulen herrschte, die ich als Kind besucht und von denen ich meine Töchter ferngehalten hatte – und immer fernhalten würde.
»Wo wollen Sie hin? Nach Chengdu?«, rief er.
Wir betraten ein schäbiges Büro, in dem eine soldatisch aussehende Frau, offenbar gründlich verstimmt über Stuarts Eindringen, hinter einem Schreibtisch saß. »Ja, vier Personen«, erinnerte ich ihn.
Binnen Minuten händigte ich Stuart ein Bündel Geldscheine aus, gab er mir die Fahrkarten. Wir traten wieder in das mäßig warme, dumpfe Sonnenlicht. »Sie fahren morgen«, sagte er. »Acht Uhr dreißig. Sie haben mir nur erste Klasse verkauft – ich hoffe, das ist okay.«
»Ja, wunderbar.« Wir fuhren immer erster Klasse. Stuart bestimmt auch, dachte ich, damals, in seiner früheren Existenz. »Danke schön«, sagte ich. »Puh!«
Er winkte ab. »Sie wollen, dass es Amerikanern hier an nichts mangelt«, sagte er. »Falls es doch der Fall ist und man sie darauf hinweist, bringen sie es sofort in Ordnung.«
Er gab mir seine Karte: Adresse in Englisch und Chinesisch, das China Times-Logo adrett eingraviert. Immer noch der Profi, dachte ich.
»Sie wohnen in Xi’an«, bemerkte ich. »Da wollen wir vielleicht auch noch hin, die Tonarmee anschauen.«
»Dann kommen Sie bei mir vorbei«, sagte er und meinte es eindeutig nicht.
»Nochmals vielen Dank.«
»Schon gut«, sagte er, schwang sich aufs Fahrrad und fuhr davon.
»Ein Wildfremder?«, fragte meine Frau, als ich sie, zurück im Hotelzimmer, mit den Fahrkarten überraschte. »Einfach so, aus keinem ersichtlichen Grund?«
»Er war Amerikaner.« Ich hätte ihr liebend gern erzählt, dass es das Arschloch war, das mich abgezockt hatte, doch wie hätte ich ihr erklärt, dass ich mich mit dem Typen gemein gemacht und einen Gefallen von ihm angenommen hatte? Ich wusste, wie Caroline es betrachtet hätte: nur als weitere einer ganzen Palette abstruser Aktionen meinerseits, zu denen ich neigte, seit die Untersuchung eingeleitet worden war. Wozu übrigens auch zählte, meine Familie zu bitten, alles stehen- und liegenzulassen und mit mir nach China zu kommen. Ich war nicht eigentlich depressiv, litt aber unter einem merkwürdigen Druck, der mich ruhelos machte: Spät nachts wanderte ich im Haus herum, öffnete die besten Weinflaschen aus unserem Keller und trank sie allein, während ich mich durch die abartigsten Kanäle des Kabelfernsehens zappte.
»Wo sind die Mädchen?«, fragte ich. »Ich habe ein kleines Messer zum Birnenschälen gekauft, für jede eins.«
»Du hast Messer für sie gekauft?«
»Nur kleine«, sagte ich. »Ist dir aufgefallen, dass die alten Frauen hier dauernd Birnen schälen? Ich habe das Gefühl, in den Schalen ist was, das man nicht essen sollte.«
Caroline hatte ihre BH’s und Unterhosen gewaschen und hängte sie an die offenen Kommodenschubladen zum Trocknen. Ende der siebziger Jahre, vor unserer Heirat, waren wir mit dem Peace Corps ein Jahr in Kenia gewesen. Dort war Caroline ähnlich verfahren, hatte quer durchs Zimmer Leinen gespannt und die gewaschenen Klamotten daran aufgehängt. Durch das Gewirr von Leinen und Unterwäsche hatte ich sie beobachtet – ihr rötlich braunes Haar und die großen, sanften Augen, bei denen ich immer an Bernstein denken musste. Ich erinnerte mich gern an die Zeit und wusste, dass all das Geld und die Häuser und die Reisen, die wir uns seitdem leisten konnten, sie nicht weggewischt hatten. Wir sind immer noch die Leute, die den Masai geholfen haben, ihre Kuhdunghäuser zu reparieren, sagte ich mir.
Caroline öffnete ein Fenster, und sofort strömte der herbe, kreatürliche Geruch Chinas in den Raum. »Ein Wildfremder«, sagte sie nachdenklich und lächelte mich an. »Lag wohl an deinem lieben Gesicht.«
Meine Töchter verraten mich. Sie sind blonde, teuer aussehende Geschöpfe, deren zarte Haut und hochgereckte Näschen ich mir – fälschlich, ich weiß – immer als Verdienst anrechnete, weil ich sie ihnen ebenso wie ihr kieferorthopädisch perfektes Lächeln unter erheblichem Kostenaufwand verschafft hatte. Die Kinder in Kenia hatten trockene Lippen und Fliegen in den Augen. Seit einigen Monaten überfielen mich aus unerfindlichen Gründen immer wieder Erinnerungen an ihr elendes Dasein. Manchmal merkte ich, wie ich meine Töchter vorwurfsvoll musterte und erwartete, dass sie wenigstens begriffen, wie brutal der Unterschied zwischen dem Leben der Masaikinder und ihrem eigenen war. Doch ich fand in ihrer Schönheit nur eine Selbstgerechtigkeit, bei der mir die Galle hochstieg. Zur Verblüffung meiner Frau begann ich, sie die Racheengel zu nennen.
Dabei waren meine Töchter einander beileibe nicht gleich. Sie waren zehn und zwölf Jahre alt, und die jüngere, Kylie, hatte großen Respekt vor der älteren, Melissa, deren überragende Eiskunstlauffähigkeiten ihr in ihrem privaten Gymnasium schon eine gewisse Berühmtheit verschafft hatten. Alle Welt schien überdies einhellig der Meinung zu sein, dass sie einen Hauch hübscher sei. Entschlossen, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren, zog ich Kylie seit neuestem ständig vor, lobte und bestätigte sie. Was meine Frau natürlich missbilligte. Sie bat mich, davon abzulassen. »Lieblinge haben ist schrecklich, Sam«, sagte sie. »Melissa glaubt, dass du sie hasst.«
»Das Leben hat Lieblinge. Ich sorge nur für das richtige Gleichgewicht.«
Doch in dem plötzlichen Schwall von Zuneigung, mit dem ich Kylie überhäufte, steckte etwas Plumpes, dem sie allerdings durchaus gewachsen war. Bereitwillig und geduldig machte sie mit mir Ausflüge in den Zoo, das Exploratorium oder zum Strand, wo wir dann durch den feuchten, schweren Sand stapften und uns beide wünschten (jedenfalls ich), Melissa – die ich barsch ausgeschlossen hatte und bei deren Eislaufwettbewerben ich oft so tat, als döste ich – wäre bei uns.
Nun aber hatten sich Melissa und Kylie in ihrem Hass auf China, ihrem tiefen Groll, dass sie einen Großteil des Sommers in einem Land verbringen mussten, in dem sich die Leute ohne Papiertaschentücher die Nase schneuzten, in eiserner Opposition gegen mich zusammengeschlossen. »Daddy, warum?«, hieß es, kaum hatte die Reise begonnen, immer wieder: auf dem Schiff von Hongkong nach Kanton, während der Tage des Wartens auf das Flugzeug nach Kunming, das, als es endlich eintraf, so Vertrauen erweckend war, als hätten wir es selbst montiert. »Warum, Daddy?« Mit der Zeit wurden ihre Fragen differenzierter: Warum hier? Warum das alles? Sie fragten den falschen Mann.
Die Häuser in Chengdu waren neuer und darum weniger malerisch als die in Kunming. Ungeduldig streifte ich, Frau und lustlose Töchter im Schlepptau, durch die Straßen. Wir tranken grünen Tee in einem dunstig feuchten Verhau neben einem buddhistischen Tempel. Es roch nach Chemikalien. Ein einheimisches Mädchen mit seltsam blassblauen Augen starrte uns unverwandt an. »Meinst du, sie ist verrückt, Dad?«, fragte Melissa.
»Sie bewundert deine Frisur.«
In dem Glauben, ich hätte es ernst gemeint, warf mir Melissa einen kurzen Blick zu und begriff dann, dass ich wieder nur – wie neuerdings ständig – ätzend sarkastisch gewesen war.
»Ja, und wahrscheinlich warst du ihr Vater«, grummelte sie.
»So ein Glück hatte sie wahrscheinlich nicht.«
Meine Frau seufzte. »Sie ist blind«, sagte sie. Und sie hatte recht; das Mädchen war von unserer ihr fremden Sprache gefesselt, ihre Augen waren leer.
»Lasst uns doch nach Xi’an fliegen«, sagte ich. »Das soll faszinierend sein.«
Melissa schlug den Reiseführer auf, überflog die Seiten und las vor: »Die Qin-Terrakotta-Krieger sind einer der wenigen Gründe, aus denen man Xi’an, eine Stadtwüste mit uniformen Straßen und Mietshäusern im Sowjetstil, besuchen sollte. Doch sie sind ein Muss.«
»Das habe ich anders gehört«, sagte ich, das Bedürfnis unterdrückend, ihr das Buch aus der Hand zu schlagen.
»Die Kinderkottakrieger?«, fragte Kylie.
»Anders gehört? Von wem?«, fragte meine Frau.
»Von dem Typen, der uns die Zugfahrkarten besorgt hat.«
»Es sind Tausende von Soldaten aus Ton, so groß wie echte Männer«, erklärte Caroline Kylie. »Ein chinesischer Kaiser, der sich von allen Menschen bedroht fühlte, hat sie unter die Erde setzen lassen, damit sie ihn nach seinem Tode beschützen.«
»Cool«, sagte Kylie.
Caroline schaute mich an. »Schauen wir sie doch an.«
»Warum?«, fragte Melissa, aber niemand antwortete ihr.
Niedergeschmettert schlenderte sie als Erste aus der Teestube. Als wir ihr folgten, ich mich umdrehte und hinter mich schaute, starrte das blinde chinesische Mädchen mit den blassblauen Augen wahrhaftig immer noch hinter uns her.
Ich wusste – ebenso wie Caroline –, dass ich seit Einleitung der Untersuchung an Status eingebüßt – oder gewonnen – hatte, von dem ihres Ehemannes und ebenbürtigen Partners zu dem eines Menschen, den sie gewähren ließ. Dankbarkeit und Schuldgefühle spielten dabei eine Rolle. Ich hatte mir jahrelang den Arsch abgearbeitet, während sie in ihrem Bildhaueratelier herumgewerkelt hatte. Dann hatte sie vor drei Jahren das Riesenglück gehabt, eine von ihren Arbeiten in der Whitney Biennial zu platzieren. Was zur Teilnahme an weiteren Ausstellungen führte, Einzelausstellungen in mehreren Großstädten, einschließlich New Yorks, und Dutzenden von Atelierbesuchen von dünnen, schönen Frauen samt aalglatten jungen Gatten, die (wahrscheinlich wie ich) nach frischen Geldscheinen rochen, oder von klapperdürren, parfümierten alten Schachteln, bei deren tatterigen Begleitern man an Landhäuser und sabbernde Retriever denken musste. Alles, was meine Frau in den folgenden drei Jahren bildhauerte, war praktisch schon verkauft. Wir hatten davon geredet, dass ich kündigte, mich mit Anthropologie oder Sozialarbeit beschäftigte, was ich nach eigenem Bekunden ja immer gern wollte, oder, Herrgott noch mal, einfach nur faulenzte. Aber unsere Lebenshaltungskosten waren enorm hoch: das Haus in der Presidio Terrace, die Mädchen nun in Privatschulen und später an der Uni, Eislauf-, Reit- und Klavierstunden, Tennisferien im Sommer – ich wollte, dass sie das alles bekamen, das und vieles mehr, für den Rest ihres Lebens. Selbst Carolines beachtliche Einkünfte hätten es bei weitem nicht gedeckt. Dann machen wir es doch anders, sagte sie. Lass uns kürzertreten. Aber die Vorstellung erfüllte mich mit Angst; ich war kein Bildhauer, ich war kein Maler, ich war kein Mensch, der Dinge schuf. Hatte nur all die Jahre rangeklotzt, damit wir das Leben führen konnten, das wir führten. Wenn wir das freiwillig aufgaben, war dann nicht alles umsonst gewesen?
Daran kauten wir immer noch herum, als ich das mit der Untersuchung herausfand. Deren Drahtzieher – mit dem passenden Namen Jeffrey Fox – wollte mir schon seit Jahren ans Leder, weil seine Frau Sheila ein Drachen und meine hübsch und hinreißend war. Er schnürte immer durch ihr Atelier und hatte im Vorjahr drei ihrer Arbeiten erworben. »Der kleine Scheißer!«, kreischte Caroline, als ich ihr von der Untersuchung erzählte und wir Nacht für Nacht, lange nachdem die Mädchen zu Bett gegangen waren, dasaßen und flüsternd beratschlagten, wie ich reagieren sollte: Dem Aufsichtsrat einen Brief schreiben und meine Unschuld beteuern? Eine Gegenoffensive gegen Fox starten? Nein, beschlossen wir. Das Beste, was ich im Augenblick tun konnte, war: Nichts. Sollte die Untersuchung ihren Verlauf nehmen, und wenn nichts dabei herauskam, würde ich ihre Rechtmäßigkeit, das heißt, ob sie überhaupt hätte eingeleitet werden dürfen, anfechten. In der Zwischenzeit wollte ich Urlaub nehmen, wieder einen klaren Kopf kriegen, ausschlafen. Ha, ha, ha.
So unwahrscheinlich das Ergebnis für uns war: Caroline stand in meiner Schuld. Ich wusste es, sie wusste es, und ich kann nicht verhehlen – unlieb war es mir nicht.
Als wir mit dem Taxi vom Flughafen Xi’an zum Golden Flower Hotel rasten, vorbei an endlosen, eintönigen Mietsblöcken und Bürgersteigen mit schlaffen staubigen Bäumen, schauten meine Frau und meine Töchter verdrossen aus dem Fenster. Beim Anblick des feudalen Hotels heiterten sich die Mienen auf; nichts ist besser geeignet, einem den Glauben an die unerschöpfliche Fülle des Universums wiederzugeben als ein uniformierter Türsteher, Marmorböden und gutbetuchte Midwesterner, die ihre Brieftaschen tätscheln. Zu meinem heimlichen Entzücken wollte mich nicht einmal Caroline in das »alte« Xi’an begleiten, wo ich nach Auskunft der Chinesin hinter dem Empfangstresen (die ein Stirnband mit dem Logo einer US-amerikanischen Universität trug und garantiert Unterricht in westlichem Aussehen und Bewegen genossen hatte) Stuarts Wohnung finden würde. Als ich ging, lag Caroline ausgestreckt auf dem Bett und las alles Verfügbare über Qin Shi Huang Di, den irren Kaiser, der die Terrakottakrieger hatte anfertigen lassen. Was so manchen Arbeiter das Leben gekostet habe, berichtete sie; das fertige Meisterwerk enthalte nicht nur das Blut und den Schweiß seiner Schöpfer, sondern gelegentlich auch deren Leib.
In den Straßen des »alten« Xi’an wimmelte es von Teeverkäuferinnen – Frauen, nach deren Vorstellung ein Glas gespült war, wenn man es mit Wasser benetzt hatte. Meine Töchter hätte ich meilenweit von ihnen ferngehalten, weil ich überzeugt war, dass ungewaschene Gläser alle möglichen todbringenden Seuchen beherbergten, die nur auf die Gelegenheit warteten, in die zarten Eingeweide meiner Mädchen einzudringen. Ich aber erstand ein Glas Tee und trank es; kaufte mir ein weißes, weiches, mit einem verdächtigen Gemüsemansch gefülltes Brötchen und schlang es herunter. Dann ein zweites. Ich fühlte mich großartig.
Danach wanderte ich durch einen buddhistischen Tempel, hörte, wie die Menschen zu dem zarten Gebimmel der Glöckchen sangen, und in meinem Magen flatterte es wie zuletzt in meiner Kindheit, wenn wir in einem Laden etwas gestohlen hatten oder heimlich in Nachbarskeller geschlichen waren. Dieses Gefühl noch auskostend, verließ ich den Tempel und war auf dem Weg zu Stuarts Straße, als ich ihn plötzlich, einen halben Block entfernt, sah. Er stand auf dem Bürgersteig und unterhielt sich mit drei alten Chinesinnen. Mir hüpfte das Herz – anders kann ich es nicht bezeichnen. Das Blut stieg mir ins Gesicht wie früher, wenn ich einem Mädchen begegnete, das ich anmachen wollte, und ich blieb stocksteif stehen. Was, zum Teufel, war in mich gefahren? Schließlich war das hier ein Mann, ein Mann, der mich über den Tisch gezogen und abgrundtief blamiert hatte. Verlor ich den Verstand? Aber ich lief schon wieder los, geradewegs auf ihn zu.
»Stuart«, sagte ich. Er schaute mich verständnislos an, was mich seltsam niederschmetterte. »Kunming, erinnern Sie sich?«, sagte ich. »Sie haben uns die Fahrkarten besorgt.«
»Ach ja, richtig.« Zerstreut lächelte er mich an. Die Chinesinnen gingen weg.
»Wir haben’s geschafft«, sagte ich blöde.
Ein verlegenes Schweigen entstand. »Sie schreiben also immer noch über Drogen?«, fragte ich.
»Diese Woche über Schmuggel.«
»Was für Schmuggel?«
»Antiquitäten. Über Leute, die Vasen und so was außer Landes bringen.«
»Da sind Sie also auf Verbrechergeschichten spezialisiert?«, fragte ich, und mein Puls knatterte los wie ein Maschinengewehr.
»Auf dem Gebiet kenne ich mich ziemlich gut aus.«
»Aus Erfahrung.« Ich konnte mich nicht beherrschen. Stuart neigte den Kopf. »Haben Sie auch journalistische Ambitionen?«
»Entweder die oder kriminelle«, sagte ich und brach in Lachen aus.
Stuart sagte nichts. Er schaute mich lange an, und zum ersten Mal sah ich in seinem Gesicht Zeichen von Neugierde.
»Gibt’s außer den Tonkriegern hier sonst noch was zu sehen?«, fragte ich.
»In Xi’an nicht viel«, sagte er. »Morgen fahre ich zu ein paar buddhistischen Höhlen außerhalb der Stadt. Die sind schon was Besonderes.«
»Ach ja?«
»Kommen Sie mit, wenn Sie sich davonstehlen können«, sagte er. »Aber Sie müssten über Nacht dort bleiben.«
»Ist vielleicht machbar.«
Er nannte mir einen Ort am Bahnhof und sagte, er werde dort um zehn am nächsten Morgen warten. »Wenn Sie es schaffen, toll«, sagte er, drehte sich um und ging.
»Ich bin da«, sagte ich.
Brady Bonds, neue aufstrebende Märkte: darüber ließ sich Cameron Pierce des langen und breiten aus, als ich ihn bei Harry Meyers Herrenabend vor der Hochzeit kennenlernte. Olivgrüner Anzug, Pferdeschwanz, ein Gebaren, als sei er erheblich rustikaler als wir übrigen. Woher kannte Harry ihn? Harry saß etliche Tische entfernt, ein nasses Hemd auf dem Kopf, sturzbetrunken. Bald darauf kamen die Stripperinnen, alle drei mit verschieden gefärbten Haaren. Und während sie Harry in die Mache nahmen, erzählte mir Cameron von den Kommanditgesellschaften und Beteiligungen, die er anbot, um in afrikanischen Ländern zu investieren: Nigeria, Elfenbeinküste, Botswana, Zimbabwe.
»Sind Sie oft dort?«, fragte ich.
Er nahm sich einen roten Apfel aus einer Schüssel in der Mitte des Tischs und aß ihn mit solch gieriger Lust, dass ich auch Appetit bekam. »So oft und lange wie möglich«, grinste er.
»Verstehe«, sagte ich und erzählte ihm spontan von meinem Arbeitsjahr mit dem Peace Corps dort – was ich selten gegenüber Leuten aus der Branche erwähnte.
Cameron legte seinen Apfelgriebs hin und beugte sich zu mir vor, damit ich ihn durch das Gejohle und Gepfeife unserer Kollegen hören konnte. »Allein deshalb lohnt sich doch der ganze Mist«, sagte er. »Weil man rauskommt. Die Wirklichkeit sieht.« Da verstanden wir uns; wir waren getrennt von den anderen – und besser als sie.
In der folgenden Woche kam Cameron Pierce’ Lakai in unser Büro und erzählte uns alles Erforderliche. Burt Phelps, einer unserer Juniorbroker, war genauso interessiert an dem Deal wie ich, wollte Pierce aber noch besser auschecken beziehungsweise wenigstens warten, bis Harry Meyer aus seinen Flitterwochen von Bora Bora zurückkam, damit wir es mit ihm besprechen konnten. »Tu, was du nicht lassen kannst«, sagte ich. »Ich steig ein.« Ich handelte rein aus dem Bauch heraus, spontan und impulsiv, wie wir Broker das so an uns haben. Und wahrscheinlich nur, weil er nicht als Idiot dastehen wollte, machte auch Burt mit. Wir steckten beide das Minimum rein – fünfundzwanzigtausend. Der Lakai holte unsere Schecks ab.
Danach telefonierten Cameron und ich ein paarmal. Er wollte in den Fernen Osten. »Da müssen Sie hin«, sagte er. »Wenn Sie von der Bildfläche verschwinden wollen, dann dort.« Wir verabredeten uns zum Lunch nach seiner Rückkehr. Meine monatlichen Abrechnungen trudelten ein; zwanzig Prozent Zinsen, ich konnte mich nicht beschweren. Burt war im siebten Himmel. Dann vergaßen wir es. Ich hatte alles in allem vier Auszüge bekommen, aber dass sie nicht mehr eintrafen, bemerkte ich frühestens nach acht Wochen, und auch erst dann, als Burt davon sprach. »Sam, hast du in letzter Zeit was von Africo gehört?«, fragte er.
Der Rest war wie in einem schlechten Film: Anrufe bei Africo ergaben keinen Anschluss unter dieser Nummer; bei einem Ausflug zu der Adresse in der Kerney Street, die auf Cameron Pierce’ Geschäftskarte stand, stellte sich heraus, dass Africo Ltd. nie dort gewesen war. Die Firma war auch weder bei der Börsenaufsicht noch sonst wo registriert; genauso wenig wie Cameron Pierce und sein Lakai, an dessen Namen ich mich nicht erinnern konnte. Harry Meyer, den zu konsultieren wir gar nicht mehr auf die Idee gekommen waren, hatte nie von Cameron Pierce gehört. »Cameron wer? Auf meiner Party?«, sagte er verblüfft. »Den muss jemand mitgebracht haben.« Mit anderen Worten: Sie waren Betrüger. Man hatte uns reingelegt. Nicht so ungewöhnlich in einer Branche wie der unsrigen, wo die Kerle mit den Scheinen nur so um sich werfen. Normalerweise passiert es den Jüngeren, Unerfahrenen. Leuten wie Burt. Doch er hatte die Bedenken gehabt, nicht ich.
In der Welt mieser Spekulationsgeschäfte sind fünfundzwanzig Riesen kein großer Verlust. Aber ich konnte es nicht verwinden. Der Typ hatte dagesessen und mich von seinem faulen Deal überzeugt, und während ich dachte, wie sympathisch er mir war, wie gut alles klang, dachte er: Spitze, er beißt an. Peace Corps – Wow, jetzt hab ich ihn! Die Jungs bei der Arbeit flachsten, was für ein feines Beispiel ich abgegeben hätte; Caroline rang wegen der Höhe der Summe ein wenig die Hände; dann vergaßen es alle mehr oder weniger. Nur ich nicht. Immer wieder dachte ich an Cameron Pierce. Wie viele »Partner« hatte er wohl schon vorher aufgetan, wie viele »Deals« gedreht? Irgendwo war er – lag am Strand, rauchte Zigarren, gab unser Geld aus. Nachts, wenn Caroline schlief, merkte ich, wie ich immer wieder darüber nachgrübelte, wie er war, wirklich war, im Grunde seines Herzens. War er überhaupt jemand?
Eins stand fest: Hätte ich dem Typen zugehört, hätte ich gemerkt, was da abging. Er hatte es mir doch praktisch selbst gesagt! Ich bin aus einer anderen Welt, hatte er gesagt, einem Ort, wo das hier nichts bedeutet. Ich hatte ihm versichert, dass ich das auch sei. Aber das stimmte nicht. Ich hatte die Regeln befolgt. Und er hatte gewonnen.
»Was soll denn der Quatsch?«, fragte Caroline, als ich ihr meinen, wie ich fand, vollkommen vernünftigen Plan darlegte: Während sie und die Kinder am nächsten Tag die Terrakotta-Krieger besichtigten, wollte ich mit einem Wildfremden einen zweitägigen Trip in einen anderen Teil Chinas machen.
»Mit dem Typen, der uns die Karten besorgt hat?«, fragte sie. »Er wohnt in Xi’an? Warum hast du mir das vorher nicht erzählt?
»Ich wusste nicht, wie du reagierst.«
»Warum sollte mich das sonderlich interessieren?«
»Jetzt scheint es dich aber zu interessieren.«
»Klar, jetzt, wo ich weiß, dass du es geheim gehalten hast. Jetzt, wo du beschlossen hast, mit ihm zu verschwinden, Sam, jetzt interessiert es mich.«
Wütend starrten wir einander an. »Ist es was Sexuelles?«, fragte sie ungläubig.
»Lieber Himmel, nein!«, brüllte ich.
Meine Frau schaute mich prüfend an. Nach einer ganzen Weile sagte sie: »So läuft das nicht, Sam.«
»Was läuft nicht?«
»Was du da vorgeschlagen hast. Ganz egal, was du vorhast.«
»Ich fahre mit ihm.«
»Gut«, sagte sie. »Dann fahren wir mit.«
Mit trübsinnigen Mienen standen wir in der langen gewundenen Schlange chinesischer Bauern, die auch darauf warteten, in den Zug einzusteigen. Melissa und Kylie taten ihr Bestes zu schmollen, aber ihre tiefe Verwunderung angesichts unserer jäh geänderten Pläne und des Auftauchens eines Fremden in unserer Mitte schmälerte ihr Missvergnügen nachhaltig. Ich ging mit Stuart die Fahrkarten kaufen – auch seine; da wenigstens konnte ich mich erkenntlich zeigen, nachdem er so anständig war, meine gesamte Familie mit zu den buddhistischen Höhlen zu nehmen. Vor Abfahrt des Zuges wollte er noch eine Besorgung machen.
»Fährt der Zug zu den Kriegern, Daddy?«, fragte Kylie.
»Die sind was für Touristen«, sagte ich.
»Aber sind wir nicht genau deshalb hierhergefahren?«, fragte Melissa. »Wegen der Terrakottakrieger?«
»Du kannst ja hierbleiben und sie anschauen gehen«, erwiderte ich. »Das Letzte, worauf ich allerdings jetzt Lust habe, sind die Zwangsvorstellungen eines durchgeknallten Kaisers.«
»Warum warten wir nicht im Erster-Klasse-Wartesaal, damit sich die Mädchen setzen können?«, schlug meine Frau vor.
»Wir fahren in der harten Klasse«, sagte ich. »Es sind nur acht Stunden.«
Die Mädchen waren entsetzt. Ich beobachtete, wie sie ihrer Mutter klägliche Blicke zuwarfen, und sah in ihren seidigen, glatten Gesichtern die dicke Schutzschicht, die sich während eines jahrelangen privilegierten Lebens bildet. Plötzlich war ich wütend, wütend auf sie beide, weil sie keine Ahnung hatten, was diese Privilegien gekostet hatten.
»Ihr könnt hier in der Schlange warten wie alle anderen auch«, sagte ich. »Davon sterbt ihr schon nicht.«
Sie schauten mich bestürzt an – ihren Vater, der sie kaum einmal mit dem Bus fahren ließ, weil ihm davor grauste, welchen Unmengen an Bakterien und skrofulösen Gestalten sie begegnen mochten.
»Dein Vater befürchtet, dass sein Freund von uns enttäuscht ist, wenn wir erster Klasse fahren«, höhnte Caroline.
»Er ist nicht mein Freund«, sagte ich.
»Wessen Freund ist er denn dann?«, fragte sie.
Für jeden Quadratzentimeter harter Bank gab es zwei Dutzend Menschen, die sich darauf setzen wollten, so dass ich unwillkürlich an den Spruch denken musste: »Mieser Fraß und dann noch nicht mal genug.« Die Mehrheit der Fahrgäste waren barfüßige Bauernjungen, deren aufgerollte Hosen dunkle, runde Narben enthüllten, die sie offenbar alle vom Knie abwärts hatten. Sie hatten in Xi’an eingekauft und waren nun mit identischen billigen, blau-weiß-rot karierten Plastiktaschen beladen, die von der Ausbeute des Tages schier barsten. Für meine Töchter gab es keine Sitze, und ich sah, wie sie immer banger dreinschauten, als sie sich im Gedränge der schwitzenden, brodelnden Menschheit wiederfanden, die zu meiden ich sie gelehrt hatte. Zu meiner Erleichterung sprangen mehrere Bauernjungen auf, um den Mädchen Platz zu machen, die dann einander gegenüber am Fenster saßen. Immer noch ärgerlich, meinem Blick ausweichend, setzte sich Caroline neben sie. Stuart stand ein Stück entfernt und sah aus, als sei er unserer schon überdrüssig.
Die Stunden verstrichen. Ich behielt meine Töchter im Auge und sah, wie ihr Missmut einer Gefasstheit wich, als begriffen sie, dass sie sich dieser Situation nur beugen konnten. Jedes Mal wenn der Zug langsam auf einen Halt an einem Bahnsteig zufuhr, schwärmten vor den Fenstern Verkäufer auf und ab, die winzige Karren schoben. Nach zwei Stunden machten Kylie und Melissa es wie alle anderen auch; begeistert wedelten sie mit Packen labbriger Geldscheine und erstanden selbst gemachte Lutscher an Zahnstochern, Plastiktüten voll winziger grüner Äpfel und viereckige, locker gebackene Kuchenstücke. Von allem, was sie kauften, boten sie ihren Nachbarn an. Es brach mir das Herz.