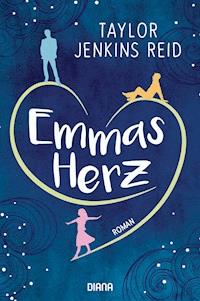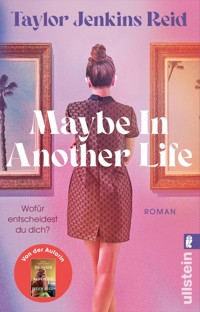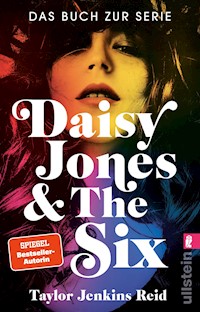10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem riesigen TikTok-Erfolg von Die sieben Männer der Evelyn Hugo kommt der nächste Hit von Taylor Jenkins Reid. Jedes Spiel hat seinen Preis. Und Carrie Soto ist bereit, alles zu geben Carrie Sotos eiserner Wille und unbarmherziger Ehrgeiz haben sie zur größten Tennisspielerin aller Zeiten gemacht. Sie hält unzählige Weltrekorde und hat zwanzig Grand Slam Titel geholt. Doch nach sechs Jahren im Ruhestand muss sie ohnmächtig dabei zusehen, wie ihre Rekorde von einer jungen Britin gebrochen werden. Mit 37 entscheidet sie sich, auf den Platz zurückzukehren. Sie will nichts mehr als ewigen Ruhm und beschließt: Ein finales Jahr als Tennisspielerin soll sie für immer unbesiegbar machen. Denn wer ist sie, wenn sie nicht die Beste ist? Um ihr Ziel zu erreichen, ist sie sogar bereit, ihren Stolz beiseitezuschieben und mit Bowe Huntley zu trainieren, dem Tennisstar, der ihr einst das Herz gebrochen hat … Wer Evelyn Hugo mochte, wird Carrie Soto lieben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Carrie Soto is Back
Die Autorin
TAYLOR JENKINS REID wurde in Massachusetts geboren, studierte am Emerson College in Boston und lebt heute mit ihrem Mann in Los Angeles. Bevor sie ihr erstes Buch Neun Tage und ein Jahr schrieb, arbeitete sie für verschiedene Zeitungen. Ihre Romane Daisy Jones & The Six und Die sieben Männer der Evelyn Hugo verhalfen ihr zu internationalem Durchbruch, werden verfilmt und in über zwanzig Sprachen übersetzt.
Von Taylor Jenkins Reid sind in unserem Hause bereits erschienen:Daisy Jones & The SixDie sieben Männer der Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid
Carrie Soto is Back
Roman
Aus dem Amerikanischen vonBabette Schröder
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage September 2022© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022© 2022 by Rabbit ReidsDie amerikanische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Carrie Soto is back bei Ballantine Books, New York.Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © Jerome Tisne / Getty Images (Frau); © dwph/Shutterstock (Goldpapier) Originalcover: © Sarah HorganFoto der Autorin: © Scott WitterE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-8437-2780-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Chan vs. Cortéz
DAS ERSTE MAL
1955–1965
1966
1968
1971–1975
1975–1976
US Open 1976
23. Januar 1979
1979–1982
1983
1984–1989
DAS COMEBACK
Oktober 1994
0
Anfang November
Mitte November
Dezember 1994
Januar 1995Melbourne
Mitte Januar
DIE AUSTRALIAN OPEN1995
1
Soto vs. Dvořáková
2
3
Soto vs. Perez
Soto gegen Cortéz
4
5
Februar 1995
März 1995
April 1995
Ende April
Mitte Mai
FRENCH OPEN1995
6
Soto vs. Zetov
Soto vs. Moretti
7
Soto vs. Antonovich
8
Juni 1995
WIMBLEDON 1995
9
Soto vs. Dryer
10
Soto vs. Antonovich
Soto gegen Cortéz
11
August 1995
12
DIE US OPEN1995
13
Soto vs. Dvořáková
Huntley vs. Matsuda
Soto vs. Cortéz
Soto vs. Chan
Ein Jahr später
Chan vs. Cortéz
Anhang
DANK
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Chan vs. Cortéz
Für Brad Mendelsohn,der für mich wie ein Coach war
Chan vs. Cortéz
US OpenSeptember 1994
Mein gesamtes Lebenswerk hängt vom Ausgang dieses Matches ab.
Mein Vater Javier und ich sitzen in Flushing Meadows in der Mitte der ersten Reihe, die Seitenlinie ist zum Greifen nah. Die Linienrichter stehen mit hinter dem Rücken verschränkten Armen auf beiden Seiten des Spielfelds. Direkt vor uns wacht der Schiedsrichter auf seinem Stuhl hoch über der Menge. Die Ballmädchen kauern in der Hocke, bereit, jeden Moment loszusprinten.
Dies ist der dritte Satz. Nicki Chan hat den ersten gewonnen, Ingrid Cortéz knapp den zweiten. Dieser letzte Satz entscheidet über den Sieg.
Mein Vater und ich sehen zu – zusammen mit den zwanzigtausend anderen im Stadion –, als Nicki Chan sich der Grundlinie nähert. Sie beugt die Knie und stabilisiert sich. Dann geht sie auf die Zehenspitzen, wirft den Ball in die Luft und schickt mit einer schnellen Bewegung aus dem Handgelenk mit zweihundert Stundenkilometern einen rasanten Aufschlag auf die Rückhand von Ingrid Cortéz.
Cortéz schlägt ihn erstaunlich kraftvoll zurück, und der Ball landet gerade noch auf der Linie. Nicki kann ihn nicht erreichen. Punkt für Cortéz.
Ich schließe die Augen und atme aus.
»Cuidado. Die Kameras beobachten unsere Reaktionen«, sagt mein Vater durch zusammengebissene Zähne. Er trägt einen seiner vielen Panamahüte, das silbergelockte Haar lugt im Nacken hervor.
»Dad, alle beobachten unsere Reaktionen.«
Nicki Chan hat in diesem Jahr bereits zwei Grand-Slam-Titel gewonnen – die Australian Open und die French Open. Wenn sie dieses Match gewinnt, wird sie meinen bestehenden Rekord von zwanzig Grand-Slam-Titeln im Einzel egalisieren. Den habe ich 1987 aufgestellt, als ich zum neunten Mal Wimbledon gewann und mich als größte Tennisspielerin aller Zeiten etablierte.
Mit Nickis besonderer Spielweise – forsch und laut, fast ausschließlich von der Grundlinie gespielt, mit unglaublich brutalen Auf- und Grundschlägen – ist es ihr in den letzten fünf Jahren gelungen, das Damentennis zu dominieren. Doch als sie in den späten 80er-Jahren auf der WTA-Tour anfing, hielt ich sie für eine unscheinbare Gegnerin. Auf Sand mochte sie gut sein, aber auf ihrem Rasenplatz in London konnte ich sie mühelos schlagen.
Nachdem ich mich 1989 zurückgezogen hatte, änderte sich die Lage. Nicki gewann in alarmierendem Tempo Grand-Slam-Turniere. Jetzt ist sie mir auf den Fersen.
Ich beobachte sie mit zusammengebissenen Zähnen.
Mein Vater sieht mich an, die Miene gelassen. »Ich meine, dass die Fotografen versuchen, ein Bild von dir zu bekommen, auf dem du wütend aussiehst oder gegen sie hetzt.«
Ich trage eine schwarze, ärmellose Bluse und Jeans. Eine Oliver-Peoples-Sonnenbrille in Schildpatt. Mein Haar ist offen. Ich finde, mit fast siebenunddreißig sehe ich so gut aus wie nie zuvor. Sollen sie doch so viele Fotos machen, wie sie wollen.
»Was habe ich dir bei den Juniors immer gesagt?«
»Lass es dir nicht ansehen.«
»Exacto, hija.«
Ingrid Cortéz ist eine siebzehnjährige spanische Spielerin, die mit ihrem schnellen Aufstieg in der Weltrangliste fast jeden überrascht hat. Ihr Stil ähnelt ein bisschen dem von Nicki – kraftvoll, laut –, aber sie nutzt häufiger ihre Winkel. Auf dem Platz ist sie erstaunlich emotional. Als sie ein knallhartes Ass an Nicki vorbeischlägt, brüllt sie vor Freude.
»Weißt du, vielleicht hält Cortéz sie auf«, sage ich.
Mein Vater schüttelt den Kopf. »Lo dudo.« Er bewegt kaum die Lippen beim Sprechen, und sein Blick meidet bewusst die Kamera. Zweifellos wird er morgen früh die Zeitung aufschlagen und die Sportseiten nach seinem Foto absuchen. Und wenn er feststellt, dass er wirklich gut aussieht, wird er in sich hineinlächeln. Obwohl er Anfang des Jahres durch die Chemotherapie Gewicht verloren hat, ist er jetzt krebsfrei. Sein Körper hat sich wieder erholt, und auch sein Gesicht hat wieder Farbe.
Da die Sonne brennt, reiche ich ihm eine Tube Sonnencreme. Er kneift die Augen zusammen und schüttelt den Kopf, als wäre das eine Beleidigung für uns beide.
»Cortéz hat einen guten Treffer gelandet«, sagt mein Vater. »Aber Nicki spart ihre Kraft für den dritten Satz.«
Mein Puls beschleunigt sich.
Nicki landet drei Punkte hintereinander und holt sich das Spiel. Jetzt steht es 3:3 im dritten Satz.
Mein Vater sieht mich an und nimmt die Brille ab, sodass ich seine Augen sehen kann. »Entonces, was hast du vor?«, fragt er.
Ich wende den Blick ab. »Ich weiß es nicht.«
Er setzt die Brille wieder auf, blickt auf den Platz und nickt mir kurz zu.
»Nun, wenn du nichts tust, dann tust du genau das. Nichts.«
»Sí, papá, verstanden.«
Nicki schlägt weit auf. Cortéz rennt und kämpft, um den Ball zu bekommen, aber er geht ins Netz.
Ich sehe meinen Vater an. Er wirkt leicht besorgt.
Auf der Spielertribüne beugt sich der Trainer von Cortéz auf seinem Platz nach vorn und schlägt die Hände vors Gesicht.
Nicki hat keinen Trainer. Den letzten hat sie vor fast drei Jahren verlassen und seitdem sechs Slams gewonnen, ohne dass jemand sie angeleitet hätte.
Mein Vater macht sich oft über Spieler lustig, die keinen Trainer haben, aber bei Nicki scheint er sich mit Urteilen zurückzuhalten.
Cortéz beugt sich vor, eine Hand in die Hüfte gestützt, und versucht, zu Atem zu kommen. Nicki lässt nicht locker. Sie feuert einen weiteren Aufschlag über den Platz. Cortéz rennt los, verfehlt ihn jedoch.
Nicki lächelt.
Ich kenne dieses Lächeln. Ich war selbst schon in dieser Situation.
Beim nächsten Punkt übernimmt Nicki das Spiel.
»Verdammt«, sage ich beim Seitenwechsel.
Mein Vater zieht die Augenbrauen hoch. »Cortéz bricht zusammen, sobald sie das Spielfeld nicht mehr kontrolliert. Und Nicki weiß das.«
»Nicki ist stark«, sage ich. »Aber sie ist auch eine sehr anpassungsfähige Gegnerin, die ihr Spiel auf deine spezifische Schwäche abstimmt.«
Mein Vater nickt.
»Jeder Spieler hat eine Schwachstelle«, sage ich. »Und Nicki ist gut darin, sie zu finden.«
»Genau.«
»Und was ist ihre?«
Jetzt unterdrückt mein Vater ein Lächeln. Er hebt sein Glas und trinkt einen Schluck.
»Was ist?«, frage ich.
»Nichts«, sagt mein Vater.
»Ich bin mir noch nicht sicher.«
»Alles klar.«
Beide Spielerinnen gehen zurück auf den Platz.
»Nicki ist nur etwas langsam«, sage ich und beobachte, wie sie zur Grundlinie geht. »Sie hat viel Kraft, aber sie ist nicht schnell – weder ihre Beinarbeit noch ihre Schläge. Sie ist nicht so schnell wie Cortéz, selbst heute nicht. Aber vor allem nicht so schnell wie Moretti, Antonovich oder sogar Perez.«
»Oder du«, sagt mein Vater. »Es gibt im Moment niemanden, der so schnell ist, wie du es warst. Nicht nur mit den Füßen, sondern im Kopf, también.«
Ich nicke.
Er fährt fort. »Ich spreche davon, sich in Position zu bringen, den Ball früh aus der Luft zu nehmen und ihn abzubremsen, damit Nicki ihn nicht mit dieser Kraft zurückschlagen kann. Niemand im Turnier macht das. Nicht so wie du früher.«
»Ich müsste allerdings so stark sein wie sie«, erwidere ich. »Und trotzdem irgendwie die Geschwindigkeit halten.«
»Was nicht einfach ist.«
»Nicht in meinem Alter und nicht mit meinem Knie«, sage ich. »Ich habe nicht mehr die Sprungkraft von früher.«
»Es verdad«, bestätigt mein Vater. »Es wird dich alles kosten, was du hast.«
»Falls ich es täte«, sage ich.
Mein Vater rollt mit den Augen, setzt dann aber schnell wieder ein falsches Lächeln auf.
Ich lache. »Ganz ehrlich, wen kümmert es schon, wenn sie ein Bild von dir mit gerunzelter Stirn bekommen?«
»Ich lasse dich in Ruhe«, sagt mein Vater. »Und du mich. ¿Lo entendés, hija?«
Wieder lache ich. »Sí, lo entiendo, papá.«
Nicki gewinnt auch das nächste Spiel. Noch eins, und es ist vorbei. Sie wird meinen Rekord einstellen.
Als ich mir vorstelle, wie das abläuft, fangen meine Schläfen an zu pochen. Cortéz wird Nicki Chan nicht aufhalten können, nicht heute. Und ich sitze hier auf der Tribüne fest und muss zusehen, wie Nicki mir alles wegnimmt, wofür ich je gearbeitet habe.
»Wer wird mich trainieren?«, frage ich. »Du?«
Mein Vater sieht mich nicht an, aber ich merke, wie er die Schultern anspannt. Er atmet tief durch und wählt seine Worte mit Bedacht.
»Sag du es mir«, antwortet er schließlich. »Das ist nicht meine Entscheidung.«
»Also, was? Soll ich Lars anrufen?«
»Du tust, was immer du tun willst, pichona«, sagt mein Vater. »So ist das mit dem Erwachsensein.«
Er wird mich betteln lassen. Und das verdiene ich auch.
Cortéz gibt alles, um die Schläge zu kriegen. Aber sie ist müde. Man sieht, wie ihre Beine zittern, wenn sie stillsteht. Sie schlägt einen Return ins Netz. Es steht jetzt 30:0.
Verdammt.
Ich schaue mich in der Menge um. Die Leute lehnen sich nach vorne, einige trommeln ungeduldig mit den Fingern. Alle scheinen ein wenig schneller zu atmen. Ich kann mir denken, was die Sportmoderatoren sagen.
Die Zuschauer ringsum beobachten meinen Vater und mich aus den Augenwinkeln und warten auf meine Reaktion. Allmählich fühle ich mich in die Enge gedrängt.
»Sollte ich es tun …«, sage ich leise, »möchte ich, dass du mich trainierst. Das sage ich, Dad.«
Als Cortéz einen Punkt gegen Nicki erzielt, sieht er mich an. Die Menge hält gespannt den Atem an, alle wollen miterleben, wie Geschichte geschrieben wird. Das würde ich vielleicht auch, wenn nicht meine Geschichte auf dem Spiel stünde.
»Bist du sicher, hija? Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einmal war. Ich habe nicht mehr das … dasselbe Durchhaltevermögen wie früher.«
»Dann sind wir schon zu zweit«, erwidere ich. »Du wirst eine ehemalige Spielerin trainieren.« Jetzt steht es 40:15. Nicki ist auf Meisterschaftskurs.
»Ich würde die größte Tennisspielerin aller Zeiten trainieren«, sagt mein Vater. Er dreht sich zu mir um und ergreift meine Hand. Ich gehe auf die vierzig zu, trotzdem verschwindet meine Hand noch in seiner. Und genau wie in meiner Kindheit fühlt sie sich warm, rau und stark an. Wenn er meine Hand drückt, komme ich mir so klein vor – als wäre ich für immer ein Kind und er ein Riese, zu dem ich aufblicken muss, um ihm in die Augen zu sehen.
Aufschlag Nicki. Ich atme scharf ein.
»Dann machst du es also?«, frage ich.
Cortéz schlägt den Ball zurück.
»Wir könnten … fürchterlich scheitern«, sage ich. »Allen beweisen, dass die Kampfmaschine es nicht mehr bringt. Das würde ihnen gefallen. Ich würde nicht nur meinen Rekord, sondern auch mein Vermächtnis beschmutzen. Es könnte … alles kaputt machen.«
Nicki schlägt einen Grundschlag.
Mein Vater schüttelt den Kopf. »Wir können nicht alles kaputt machen, denn Tennis ist nicht alles, pichona.«
Da bin ich mir nicht so sicher.
Cortéz pariert den Schlag.
»Trotzdem«, sage ich. »Wir beide müssten uns mehr anstrengen als je zuvor. Bist du dazu bereit?«
»Es wäre die größte Ehre meines Lebens«, sagt mein Vater. Ich sehe, wie ihm Tränen in die Augen steigen, und zwinge mich, den Blick nicht abzuwenden. Er verstärkt den Griff um meine Hand. »Ich würde mein Leben dafür geben, dich noch einmal zu trainieren, querida.«
Ich versuche, den zarten Schmerz in meiner Brust zu verdrängen. »Dann ist es wohl entschieden«, sage ich.
Auf dem Gesicht meines Vaters erscheint ein Lächeln.
Nicki schlägt einen Lob, der Ball beschreibt einen Bogen. Das Stadion sieht zu, wie er hochfliegt und wieder sinkt.
»Das war’s dann wohl mit meinem Ruhestand«, sage ich.
Es sieht so aus, als würde der Ball ins Aus gehen. Dann kann Cortéz die Niederlage vorerst hinauszögern.
Mein Vater legt einen Arm um mich und drückt mich fest an sich. Ich kann kaum noch atmen. Er flüstert mir ins Ohr: »Nunca estuve más orgulloso, cielo.« Dann lässt er mich los.
Der Ball kommt auf und landet knapp vor der Grundlinie. Die Menge ist still, als er hoch und schnell aufspringt. Cortéz hatte sich bereits zurückgezogen, weil sie dachte, der Ball würde ins Aus gehen, und jetzt ist es zu spät. Es ist unmöglich, den Ball zurückzuschlagen. Sie stürzt nach vorne, verfehlt ihn jedoch.
Für den Bruchteil einer Sekunde ist kein Laut zu hören, dann bricht der Tumult los. Nicki Chan hat gerade die US Open gewonnen.
Cortéz lässt sich auf den Boden sinken. Nicki stößt die Fäuste in die Luft.
Mein Vater und ich lächeln. Bereit.
DAS ERSTE MAL
1955–1965
Mein Vater zog mit siebenundzwanzig Jahren von Buenos Aires in die Vereinigten Staaten. In Argentinien war er ein hervorragender Tennisspieler gewesen, der in seiner elfjährigen Karriere dreizehn Meisterschaften gewonnen hatte. Man nannte ihn »Javier el Jaguar«. Er war anmutig, aber tödlich.
Aber wie er sagt, mutete er seinen Knien zu viel zu. Seine Sprünge waren zu hoch, und er landete nicht immer richtig. Als er auf die dreißig zuging, wusste er, dass sie nicht mehr lange durchhalten würden. 1953 zog er sich zurück – worüber er nie mit mir sprach, ohne sich zu verspannen und schließlich den Raum zu verlassen. Bald darauf plante er seinen Umzug in die USA.
In Miami fand er einen Job als Sparringspartner in einem schicken Tennisclub. Dort stand er den ganzen Tag Mitgliedern zur Verfügung, die ein Spiel machen wollten. Ein Job, der normalerweise Collegestudenten vorbehalten ist, die den Sommer zu Hause verbringen – aber er spielte genauso konzentriert wie früher bei den Turnieren. Wie er vielen Mitgliedern jenes ersten Clubs erklärte: »Ich weiß nicht, wie man Tennis spielt, ohne mit ganzem Herzen dabei zu sein.«
Es dauerte nicht lange, bis die Leute ihn um private Trainerstunden baten. Er war bekannt dafür, Wert auf die korrekte Haltung zu legen und hohe Erwartungen zu haben – wer auf el Jaguar hörte, würde wahrscheinlich die nächsten Spiele gewinnen.
1956 erhielt er Angebote aus dem ganzen Land, als Tennislehrer zu arbeiten. So landete er im Palm Tennis Club in Los Angeles, wo er meine Mutter Alicia kennenlernte. Sie war Tänzerin und brachte den Clubmitgliedern Walzer und Foxtrott bei.
Meine Mutter war groß, hielt sich sehr gerade und trug stets zehn Zentimeter hohe Absätze. Sie ging langsam und entschlossen und sah den Leuten immer in die Augen. Es war nicht leicht, sie zum Lachen zu bringen, doch wenn es jemandem gelang, lachte sie so laut, dass die Wände wackelten.
Bei ihrer ersten Verabredung sagte sie meinem Vater, er sei ihrer Meinung nach zu sehr auf Tennis fixiert. »Es wird Zeit, dir das abzugewöhnen, Javier. Sonst wirst du nie ein glücklicher Mensch.«
Mein Vater erwiderte, sie sei verrückt. Tennis mache ihn erst glücklich.
Worauf sie sagte: »Ach, stur bist du also auch noch.«
Trotzdem erschien er am nächsten Tag am Ende einer ihrer Unterrichtsstunden mit einem Dutzend roter Rosen. Sie nahm sie an und bedankte sich, aber ihm fiel auf, dass sie nicht an ihnen roch, bevor sie sie ablegte. Mein Vater spürte, dass er in seinem Leben nur wenigen Frauen Blumen geschenkt, meine Mutter aber bereits von Dutzenden Männern Sträuße erhalten hatte, die sich bei ihr Hoffnungen machten.
»Bringst du mir das Tangotanzen bei?«, fragte er.
Sie warf ihm einen Seitenblick zu und glaubte keine Minute, dass dieser Argentinier nicht zumindest flüchtige Tangokenntnisse besaß. Doch dann legte sie ihm eine Hand auf die Schulter, hielt die andere in die Luft und sagte: »Na, dann komm.« Er ergriff ihre Hand, und sie zeigte ihm, wie er sie über die Tanzfläche führen sollte.
Mein Vater sagt, er habe den Blick nicht von ihr abwenden können und sich gewundert, wie leicht es war, mit ihr durch den Raum zu gleiten.
Am Ende beugte mein Vater sie nach hinten, und sie lächelte ihn an und sagte etwas ungeduldig: »Javier, jetzt küsst du mich.« Innerhalb weniger Monate überzeugte er sie davon, mit ihm durchzubrennen. Er sagte ihr, er habe große Träume für sie beide. Und meine Mutter erwiderte, seine Träume könne er für sich behalten. Sie brauche nicht viel mehr als ihn.
An dem Abend, an dem meine Mutter ihm sagte, dass sie schwanger sei, saß sie in ihrer Wohnung in Santa Monica auf seinem Schoß und fragte ihn, ob er spüre, dass er das Gewicht von zwei Menschen trage. Mit Tränen in den Augen lächelte er zu ihr hoch. Und dann sagte er, dass er deutlich spüre, dass ich ein Junge sei und ein doppelt so guter Tennisspieler werden würde, wie er es je gewesen sei.
Als Baby setzte mein Vater mich in einem mitgebrachten Hochstuhl auf den Platz, damit ich ihm beim Spielen zusehen konnte. Er sagt, ich hätte den Kopf hin und her gedreht und den Ball verfolgt. Wenn meine Mutter mich aus dem Hochstuhl nahm, um mit mir im Schatten zu sitzen oder mir eine Kleinigkeit zu essen zu geben, weinte ich angeblich so lange, bis sie mich zurück auf den Platz brachte.
Mein Vater erzählte für sein Leben gern die Geschichte, wie er mir als Kleinkind zum ersten Mal einen Schläger in die Hand gedrückt und sanft den Ball zugeworfen habe. Er schwört, dass ich an diesem schicksalhaften Tag Schwung geholt und den Ball getroffen hätte.
Er lief mit mir auf den Schultern zurück ins Haus, um es meiner Mutter zu erzählen, doch sie lächelte nur und kümmerte sich weiter um das Abendessen.
»Verstehst du, was ich sage?«, fragte er.
Meine Mutter lachte. »Dass unsere Tochter Tennis mag? Natürlich mag sie Tennis, sie kennt doch nichts anderes.«
»Das ist so, als würde man sagen, Achilles war ein großer Krieger, nur weil er im Krieg gelebt hat. Achilles war ein großer Krieger, weil es seine Bestimmung war, einer zu sein.«
»Ich verstehe. Carolina ist also Achilles?«, fragte meine Mutter lächelnd. »Und was bist du dann? Ein Gott?«
Mein Vater winkte ab. »Sie ist dazu bestimmt«, sagte er. »Das ist sonnenklar. Mit deiner Anmut und meiner Stärke kann sie die größte Tennisspielerin aller Zeiten werden. Eines Tages wird man sich Geschichten über sie erzählen.«
Meine Mutter verdrehte die Augen und begann, das Abendessen auf den Tisch zu stellen. »Mir wäre es lieber, sie wäre nett und glücklich.«
»Alicia«, sagte mein Vater, trat hinter meine Mutter und legte die Arme um sie. »Darüber erzählt niemand jemals Geschichten.«
Ich kann mich nicht daran erinnern, wie man mir mitgeteilt hat, dass meine Mutter gestorben sei. Ich erinnere mich auch nicht an ihre Beerdigung, obwohl mein Vater sagt, ich sei dabei gewesen. Er erzählt, meine Mutter habe Suppe gekocht und gemerkt, dass wir kein Tomatenmark mehr hatten, also zog sie sich Schuhe an und ließ mich bei ihm in der Garage, wo er gerade einen Ölwechsel machte.
Als sie nicht nach Hause kam, klopfte er bei unseren Nachbarn und bat sie, auf mich aufzupassen, während er die Straßen durchsuchte.
Als er ein paar Blocks entfernt den Rettungswagen sah, ahnte er Schreckliches. Meine Mutter war von einem Auto angefahren worden, als sie auf dem Heimweg die Straße überquerte.
Nachdem meine Mutter beerdigt worden war, weigerte sich mein Vater, ihr Schlafzimmer zu betreten. Er schlief im Wohnzimmer; seine Kleidung bewahrte er in einem Wäschekorb neben dem Fernseher auf. Das ging monatelang so. Wann immer ich schlecht träumte, stand ich auf und ging zum Sofa. Dort schlief er beim statischen Rauschen des laufenden Fernsehers.
Und dann, eines Tages, fiel Licht in den Flur. Die Schlafzimmertür stand offen, der Staub, der sich lange auf der Klinke gesammelt hatte, war verschwunden, und alle Sachen meiner Mutter waren in Kartons verpackt. Ihre Kleider, ihre hohen Schuhe, ihre Halsketten, ihre Ringe. Sogar ihre Haarnadeln. Jemand kam ins Haus und holte alles ab. Und das war’s.
Es blieb nicht viel von ihr. Kaum ein Beweis, dass sie je gelebt hatte. Nur ein paar Fotos, die ich in der obersten Kommodenschublade meines Vaters fand. Mein Lieblingsbild versteckte ich unter meinem Kopfkissen. Ich hatte Angst, dass es sonst auch bald weg sein würde.
Danach erzählte mir mein Vater eine Zeit lang Geschichten über meine Mutter. Wie sehr sie sich gewünscht hatte, dass ich glücklich bin. Dass sie gut und gerecht gewesen war. Aber er weinte, wenn er von ihr sprach, und bald hörte er ganz auf, von ihr zu erzählen.
Bis heute ist die einzige nennenswerte Erinnerung, die ich an meine Mutter habe, verschwommen. Ich weiß nicht, was davon real ist und was ich womöglich im Laufe der Jahre hinzuerfunden habe.
Im Geiste sehe ich sie in der Küche am Herd stehen. Sie trägt ein kastanienbraunes Kleid mit Punkten oder einem Blümchenmuster. Ihr Haar ist voll und gelockt. Von der anderen Seite des Hauses ruft mein Vater »Guerrerita«. So nannte er mich damals. Woraufhin meine Mutter den Kopf schüttelt und sagt: »Lass dich von ihm nicht als Kriegerin bezeichnen – du bist eine Königin.«
Meist bin ich mir vollkommen sicher, dass das tatsächlich so passiert ist. Aber manchmal kommt es mir ganz einleuchtend vor, dass es ein Traum gewesen sein muss.
Woran ich mich am deutlichsten erinnere, ist die Leere, die sie hinterlassen hat. Im Haus war zu spüren, dass früher noch jemand anders da gewesen war.
Aber jetzt gab es nur noch meinen Vater und mich.
In meinen ersten konkreten Erinnerungen bin ich noch jung, aber schon wütend. Ich ärgere mich über die Fragen der anderen Mädchen: »Wo ist deine Mutter?« »Warum ist dein Haar nie gebürstet?« Darüber, dass die Lehrerin verlangt, dass ich Englisch ohne den Akzent meines Vaters spreche. Ich ärgere mich, dass man mir sagt, ich solle in den Pausen nettere Sachen spielen, wenn ich doch nur mit den anderen Kindern über das Feld rennen oder sehen wollte, wer am höchsten schaukeln konnte.
Ich vermutete, dass das Problem darin lag, dass ich immer gewann. Aber ich konnte beim besten Willen nicht verstehen, warum die Leute deshalb nicht mehr mit mir spielen wollten, anstatt sich mehr anzustrengen.
Diese frühen Erinnerungen an den Versuch, Freundschaften zu schließen, sind alle von demselben verwirrenden Gefühl begleitet: Ich mache etwas falsch, und ich weiß nicht, was.
Nach Schulschluss beobachtete ich, wie die anderen Schüler von ihren Müttern abgeholt wurden. Meine Klassenkameraden berichteten ihnen von ihrem Tag, sträubten sich, wenn ihre Mütter sie am Auto an sich drückten, und wischten sich die Küsse von den Wangen.
Ich hätte ihnen stundenlang zusehen können. Was machten sie nach der Schule noch mit ihren Müttern? Gingen sie Eis essen? Oder zusammen einkaufen, um diese hübschen Federmäppchen zu holen, die einige von ihnen hatten? Woher hatten sie alle diese Haarschleifen?
Wenn sie wegfuhren, ging ich pflichtbewusst zwei Blocks weiter zu den öffentlichen Tennisplätzen, wo ich meinen Vater traf.
Ich bin auf dem Tennisplatz aufgewachsen. Nach der Schule auf den öffentlichen Plätzen, im Sommer und an den Wochenenden auf denen des Country-Clubs. In meiner Kindheit und Jugend trug ich Tennisröcke und Pferdeschwanz. Ich saß im Schatten an der Seitenlinie und wartete darauf, dass mein Vater eine Stunde beendete.
Er schwebte über dem Netz. Seine Aufschläge waren immer geschmeidig, seine Grundschläge elegant. Sein Gegner oder der jeweilige Schüler wirkte im Vergleich dazu stets orientierungslos. Mein Vater hatte den Platz unter Kontrolle.
Rückblickend verstehe ich, wie angespannt und einsam er den Großteil meiner Kindheit und Jugend über gewesen sein muss. Er lebte verwitwet und alleinerziehend in einem fremden Land, ohne dass ihn irgendjemand unterstützte. Heute scheint mir offensichtlich, dass mein Vater so gestresst war, dass er fast zerbrochen wäre.
Doch wenn seine Tage schwer und seine Nächte unruhig waren, verstand er es sehr gut, dies vor mir zu verbergen. Die Zeit, die ich mit ihm verbringen durfte, erschien mir wie ein Geschenk, das andere Kinder nicht bekamen. Im Gegensatz zu ihnen hatte meine Zeit ein Ziel, mein Vater und ich arbeiteten auf etwas Bedeutsames hin. Ich würde die Beste sein.
Jeden Tag nach der Schule, wenn mein Vater endlich mit dem bezahlten Unterricht fertig war, drehte er sich um und sah mich an. »Venga«, sagte er dann. »Los fundamentos.« Dann nahm ich meinen Schläger und ging zu ihm an die Grundlinie.
»Spiel, Satz, Sieg: Warum sagen wir das?«, fragte mich mein Vater.
»Weil jedes Spiel ein Spiel ist. Man muss die meisten Spiele gewinnen, um den Satz zu gewinnen. Und dann muss man die meisten Sätze gewinnen, um das Match zu gewinnen«, sagte ich.
»In einem Spiel ist der erste Punkt …«
»15. Dann 30. Dann 40. Dann gewinnt man. Aber man muss mit zwei Punkten Vorsprung gewinnen.«
»Wie nennen wir das, wenn es 40 beide steht?«
»Einstand. Und wenn man bei Einstand ist und einen Punkt gewinnt, hat man entweder den Aufschlag auf seiner Seite, oder der Gegner darf aufschlagen.«
»Und wie gewinnt man?«
»Wenn man den Aufschlag hat, muss man den nächsten Punkt machen, um das Spiel zu gewinnen. Man muss sechs Spiele gewinnen, um den Satz zu gewinnen, aber auch hier muss man zwei Punkte Vorsprung haben. Man kann einen Satz nicht einfach 6:5 gewinnen.«
»Und ein Match?«
»Frauen müssen zwei von drei Sätzen gewinnen, Männer drei von fünf Sätzen.«
»Und null? Was bedeutet das?«
»Es bedeutet nichts.«
»Nun, es bedeutet null«.
»Richtig, man hat keine Punkte. Null bedeutet nichts.«
Wenn ich alles richtig beantwortet hatte, klopfte er mir auf die Schulter. Und dann trainierten wir.
Es gibt viele Trainer, die auf Innovation setzen, aber das war nicht der Stil meines Vaters. Er glaubte an die Schönheit und Einfachheit. Für ihn hieß das, etwas so zu tun, wie es schon immer getan worden war, aber besser, als es je ein anderer getan hatte. »Wenn ich so sehr auf die richtige Haltung geachtet hätte wie du, hija«, sagte er oft, »wäre ich immer noch ein Tennisprofi.« Das war eines der wenigen Dinge, von denen ich ahnte, dass sie nicht stimmten. Ich wusste schon damals, dass nicht viele Menschen nach ihrem dreißigsten Lebensjahr noch professionell Tennis spielen.
»Bueno, papá«, sagte ich, als wir mit dem Training begannen.
Meine gesamte Kindheit bestand aus Training, Training und nochmals Training. Aufschläge, Grundschläge, Beinarbeit, Volleys. Aufschläge, Grundschläge, Beinarbeit, Volleys. Immer wieder. Den ganzen Sommer über, nach der Schule, jedes Wochenende. Mein Vater und ich. Immer zusammen. Unser kleines Zweierteam. Stolzer Trainer und Meisterschülerin.
Es gefiel mir sehr, dass man jedes Element des Spiels auf eine falsche und eine richtige Weise ausführen konnte. Es gab immer etwas Konkretes, nach dem man streben konnte.
»De nuevo«, sagte mein Vater, als ich zum fünfzigsten Mal an dem Tag versuchte, meinen flachen Aufschlag zu perfektionieren. »Ich will, dass beide Arme gleichzeitig und gleich schnell nach oben kommen.«
»De nuevo«, sagte er – ein Vierzigjähriger, der sich tief herunterbeugte, um mir in die Augen zu sehen, weil ich ihm nur bis zur Hüfte ging. »Für eine präzise Haltung musst du den hinteren Fuß anziehen, bevor du den Ball triffst.«
»De nuevo«, sagte er lächelnd, »Spar dir den Spin für einen zweiten Aufschlag, hijita. Entendido?«
Und jedes Mal, im Alter von fünf, sechs, sieben, acht Jahren, erhielt er die gleiche Antwort. Sí, papá. Sí, papá. Sí, papá. Sí, papá.
Mit der Zeit begann mein Vater, sein »De nuevo« mit »Excelente« zu würzen. Ich sehnte mich jeden Tag nach diesen »excelentes«. Ich träumte von ihnen. Nachts lag ich in meiner Linus-und-Lucy-Bettwäsche, starrte auf das gerahmte Pressefoto von Rod Laver, um das ich meinen Vater angefleht hatte, und ging im Kopf meine Haltung durch.
Bald schon waren meine Grundschläge stark, meine Volleys scharf und meine Aufschläge tödlich. Als Achtjährige konnte ich von der Grundlinie aufschlagen und hundertmal hintereinander eine kleine Milchtüte treffen.
Die Leute, die an den Plätzen vorbeigingen, hielten sich für clever, wenn sie mich »Little Billie Jean King« nannten, als ob ich das nicht zehnmal am Tag gehört hätte.
Bald machte mich mein Vater mit dem strategischen Spiel vertraut.
»Viele Spieler können die Spiele gewinnen, in denen sie aufschlagen«, sagte mein Vater immer. »Decime por qué.«
»Weil ein Spieler nur beim Aufschlag den Ball kontrollieren kann.«
»¿Y qué más?«
»Wenn man richtig aufschlägt, kontrolliert man den Aufschlag und den Return. Und sogar den Ballwechsel.«
»Exacto. Dein Spiel zu bestimmen, wenn du Aufschlag hast, ist die Grundlage deiner Strategie.«
»Bueno, entiendo.«
»Aber die meisten Leute richten ihre ganze Energie auf den Aufschlag. Sie perfektionieren ihren Aufschlag so sehr, dass sie den wichtigsten Teil vergessen.«
»Den Return.«
»Exacto. Dein Aufschlag ist deine Verteidigung, Spiele gewinnen kannst du mit einem guten Return. Wenn du alle Spiele gewinnst, in denen du aufschlägst, und dein Gegner alle, in denen er aufschlägt, wer gewinnt dann den Satz?«
»Der Erste, der dem anderen den Aufschlag abnimmt.«
»Exacto. Das nennen wir auch Break. Wenn du ihm nur einen von seinen Aufschlägen abnimmst – nur einen Break schaffst – und deine eigenen Aufschläge behältst, gewinnst du den Satz.«
»Ich muss also ein guter Aufschläger und ein guter Rückschläger sein.«
»Du musst das sein, was wir einen ›Allroundspieler‹ nennen«, sagte er. »Du musst den Aufschlag, den Volley, die Grundschläge und den Return beherrschen. Okay, spielen wir.«
Er gewann jedes Mal, Tag für Tag. Aber ich versuchte es immer wieder. Spiel um Spiel, jeden Abend nach der Schule, manchmal zweimal am Wochenende.
Bis zu einem wolkenverhangenen Januarnachmittag, an dem die Luft etwas zu frisch war. Den ganzen Tag über drohte das zu passieren, was der südkalifornische Himmel eigentlich fast nie zu tun versprach.
Im ersten Satz stand es unentschieden, als ich zwei Aufschläge hintereinander mit einem Cross zurückspielte, der jeweils so schnell war, dass mein Vater ihn nicht erreichte.
Und zum ersten Mal in meinem jungen Leben nahm ich ihm seinen Aufschlag ab.
»¡Excelente!«, sagte er, lief mit erhobenen Armen auf meine Seite des Spielfelds und wirbelte mich durch die Luft.
»Ich habe es geschafft!«, sagte ich. »Ich habe dir deinen Aufschlag abgenommen!«
»Ja, genau«, bestätigte er. »Ja, das hast du.«
Etwa zwei Minuten nachdem ich den Satz gewonnen hatte, riss der Himmel auf, und es fing an zu regnen. Mein Vater zog mir seine Jacke über den Kopf, und wir liefen zum Auto.
Nachdem wir eingestiegen waren und die Türen geschlossen hatten, sah ich zu ihm hinüber. Er strahlte, auch wenn er vor Kälte zitterte. »Excelente, pichoncita«, sagte er, ergriff meine Hand und drückte sie. »Muy, pero muy bien.« Er lächelte noch immer, als er den Schlüssel im Zündschloss drehte und rückwärts aus der Parklücke setzte.
Von diesem Moment an konnte ich ihn zwar immer noch nicht in einem Match besiegen, aber ich nahm mir vor, mindestens einmal am Tag einen Break zu schaffen. Und das gelang mir.
Am Ende jedes Trainings fuhren mein Vater und ich nach Hause, mit zwei Tüten voller Essen aus dem Club-Restaurant, die in meinem Schoß warm blieben. Auf dem Rückweg zu unserer Wohnung sah ich die großen Häuser an uns vorbeiziehen.
Mein Vater parkte, und bevor wir ausstiegen, fragte er: »Wir waren gut heute. Aber was machen wir morgen besser?«
Ich zählte die Liste auf, an der ich den ganzen Heimweg über gearbeitet hatte.
»Schneller die Füße heben«, sagte ich. »Und mein Handgelenk unten halten.« Oder: »Dafür sorgen, dass ich nicht zu weit aushole, bevor ich den Volleystop schlage.«
Jeden Abend ergänzte er noch etwas, an das ich nicht gedacht hatte.
»Und behalte den Ball im Auge, nicht den Schläger.« »Schwing die Vorhand durch.«
Jeden Abend nickte ich. Klar. Wie konnte ich das vergessen?
Dann gingen wir hinein und aßen gemeinsam vor dem Fernseher zu Abend. Meistens sahen wir nur die Nachrichten, aber ich liebte die wenigen Abende, an denen er uns die Lucy Show sehen ließ. Er in seinem Fernsehsessel, ich auf der Couch, jeder mit einem Tablett. Er lachte so sehr, dass ich auch lachen musste.
Später, nachdem ich mir die Zähne geputzt und meinen Schlafanzug angezogen hatte, gab mir mein Vater einen Kuss auf die Stirn und sagte: »Gute Nacht, meine Achilles, die größte Kriegerin, die das Tennis je gesehen hat.«
Wenn das Licht aus war, schob ich die Hand unter mein Kopfkissen und tastete nach einer Aufnahme meiner Mutter, die ich aus der Kommode meines Vaters genommen hatte.
Es zeigt meine Mutter, wie sie mit mir im Arm in einer Hängematte in unserem Garten liegt und in die Kamera lächelt. Über uns ein Orangenbaum. Ich schlafe in ihren Armen, ihr Kinn ruht auf meinem Kopf, ihre Hand auf meinem Rücken. Ihr Haar ist lang, und ihre Locken sind weich. Ich strich mit dem Finger über das Foto, über ihr Kleid, von den Schultern bis zu den Füßen.
Ich drückte das Bild an meine Brust, steckte es dann wieder unter mein Kopfkissen und schlief ein.
Eines Abends, als ich etwa acht Jahre alt war, suchte ich das Foto, und es war weg.
Ich warf mein Kopfkissen auf den Boden. Ich sprang aus dem Bett und kippte die Matratze auf die Seite. Wie konnte ich es verloren haben, etwas so Wichtiges? Ich fing an zu schreien, Tränen liefen mir über die Wangen.
Mein Vater kam herein und sah mich mit rotem Gesicht und tränennassen Augen in einem chaotischen Zimmer sitzen. Ruhig legte er meine Matratze zurück in den Rahmen und nahm mich in die Arme.
»Pichoncita«, sagte er. »No te preocupés. Mit dem Foto ist alles in Ordnung. Ich habe es zurück in meine Kommode gelegt. Es wird Zeit, dass du es dir nicht mehr jeden Abend ansiehst.«
»Pero, ich möchte es mir jeden Abend ansehen.«
Er schüttelte den Kopf und hielt mich fest. »Cariño, schlag dir das aus dem Kopf. Das ist eine zu große Belastung für dich.«
1966
An meinem neunten Geburtstag hatte ich alle anderen Kinder meines Alters im Club geschlagen. Darum warb mein Vater den Sohn eines Erwachsenen an, den er unterrichtete, damit er gegen mich antrat – einen dreizehnjährigen Jungen namens Chris.
»Ich verstehe nicht, warum du hier spielen darfst«, sagte Chris zu mir. »Du bist doch gar kein Mitglied.« Wir standen am Netz und warteten auf den Start. Unsere Väter unterhielten sich und lachten.
»Du doch auch nicht«, erwiderte ich.
»Mein Vater aber schon. Dein Vater arbeitet hier. Dein Vater arbeitet für uns.«
Unsere Väter kamen auf uns zu, und Chris stöhnte. »Können wir das einfach hinter uns bringen? Ich habe keine Lust, gegen eine Siebenjährige zu spielen.«
Ich starrte ihn einen Moment lang an und spürte, wie sich meine Schultern anspannten. »Ich bin neun, du Idiot.«
Chris sah mich mit großen Augen an, sagte aber nichts weiter. Ich habe früh gelernt, dass die meisten Arschlöcher nicht schlagfertig sind.
»Also gut, Kinder, auf zwei Gewinnsätze«, sagte mein Vater.
Chris schlug zuerst auf, und ich ging in die Hocke und machte mich bereit. Er warf den Ball hoch und schlug ihn in einer langsamen Kurve auf. Ich reagierte mit einem langen Cross. Mein Punkt. 0:15.
Wieder schlug Chris auf. Ich reagierte mit einem Passierschlag. 0:30.
Beim nächsten Mal täuschte ich ein Gähnen vor. 0:40.
»Spiel für Carrie«, sagte mein Vater.
Chris stieg eine leichte Röte ins Gesicht. Ich wusste nicht, ob er wütend war oder sich schämte. Ich lächelte ihn an.
Der Rest des Matchs ging schnell vorüber.
Beim letzten Aufschlag tippte ich den Ball hinüber, weil ich keine Lust auf einen Topspin oder schnellen Schlag hatte. Aber er beförderte ihn trotzdem ins Aus.
»Du bist ein schlechter Tennisspieler«, sagte ich zu ihm, als ich ihm die Hand gab.
»Carolina!«, rief mein Vater.
»Tut mir leid, aber es stimmt doch«, sagte ich. Ich sah Chris an. »Das bist du.«
Ich beobachtete, wie Chris zu seinem Vater blickte, der am Spielfeldrand saß. Sein Vater schüttelte den Kopf, drückte die Zigarette aus, die er geraucht hatte, und verdrehte die Augen.
Ich weiß noch, wie ich dachte: Deshalb solltest du üben, Chris.
Als wir vom Platz gingen, legte mir mein Vater die Hand auf die Schulter und sagte: »Das war ja was.«
»Ich musste mich noch nicht einmal anstrengen«, sagte ich, während wir zu den Umkleideräumen gingen.
»Na, das hast du deutlich gemacht. Und du warst gemein.«
»Warum sollte ich nett zu ihm sein? Er hat mich eine Siebenjährige genannt.«
»Die Leute werden dich in deinem Leben noch als so manches bezeichnen«, sagte er. »Die Leute bezeichnen Leute wie uns immer als alles Mögliche«.
»Weil wir hier keine Mitglieder sind?«, fragte ich, als ich meine Sachen abstellte.
Mein Vater blieb auf der Stelle stehen. »Weil wir Gewinner sind. Lass dich davon nicht beeinflussen, Carolina«, sagte er. »Lass nicht zu, dass etwas, was jemand über dich sagt, dein Selbstwertgefühl beeinflusst.«
Ich sah ihn an.
»Wenn ich sage, dein Haar ist lila, heißt das, dass es lila ist?«, fragte er.
»Nein, es ist braun.«
»Heißt das, dass du mir beweisen musst, dass es braun ist?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, du kannst sehen, dass es braun ist.«
»Eines Tages wirst du eine der besten Tennisspielerinnen der Welt sein, cariño. Das ist genauso wahr wie dein braunes Haar. Du musst es ihnen nicht beweisen. Du musst es einfach nur sein.«
»Bueno«, sagte ich.
»Wenn du das nächste Mal gegen einen Jungen wie Chris spielst, erwarte ich, dass du trotzdem ein schönes Tennisspiel machst«, sagte er. »Verstanden?«
Ich nickte. »Está bien.«
»Und wir weinen nicht, wenn wir verlieren, aber wir sind auch nicht hämisch, wenn wir gewinnen.«
»Bueno, entiendo.«
»Du spielst nicht gegen deinen Gegner, das ist dir doch klar, oder?«
Ich sah ihn unsicher an. Aber er sollte glauben, dass ich alles verstanden hatte – es kam mir wie ein unerträglicher Verrat an unserer Mission vor, dass mich irgendetwas daran verwirrte.
»Jedes Mal, wenn du auf den Platz gehst, musst du besser spielen als das letzte Mal. Hast du heute dein bestes Tennis gespielt?«
»Nein«, sagte ich.
»Das nächste Mal möchte ich, dass du dich selbst schlägst. Jeden Tag musst du den Tag davor schlagen.«
Ich setzte mich auf eine Bank und dachte nach. Was mein Vater vorschlug, war ein viel, viel schwierigeres Unterfangen. Aber nachdem der Gedanke einmal in meinem Kopf war, wurde ich ihn nicht mehr los. Ich konnte ihn nicht verdrängen.
»Entiendo«, sagte ich.
»Hol jetzt deine Sachen. Wir fahren zum Strand.«
»Nein, Dad«, sagte ich. »Bitte nicht. Können wir nicht einfach nach Hause fahren? Oder wie wäre es, wenn wir ein Eis essen gehen? Ein Mädchen aus meiner Klasse hat mir von einem Laden erzählt, in dem es tolles Sandwicheis gibt. Ich dachte, wir könnten da hingehen.«
Er lachte. »Wir bringen deine Beine nicht in Form, wenn wir herumsitzen und Sandwicheis essen. Das können wir nur, indem wir …«
Ich runzelte die Stirn. »Im Sand laufen.«
»Sí, im Sand laufen, entonces vámonos.«
1968
Nach circa zwei weiteren Jahren, in denen ich jedes Kind in der Stadt geschlagen hatte, erhielten wir einen Anruf von Lars Van de Berg, einem der bedeutendsten Juniorentennistrainer des Landes.
Er trainierte eine Vierzehnjährige namens Mary-Louise Bryant unten in Laguna Beach. Mary-Louise hatte bereits Juniorenmeisterschaften gewonnen. In jenem Jahr hatte sie es bis ins Halbfinale von Junior-Wimbledon geschafft.
»Lars hat angerufen, weil alle in L. A. von dir reden«, sagte mein Vater, während wir auf dem Freeway Richtung Laguna Beach fuhren. Ich trug einen weißen Tennisrock und ein Polohemd, darüber eine cremefarbene Strickjacke. An den Füßen hatte ich neue Socken und ebensolche, strahlend weiße Tennisschuhe.
Mein Vater hatte das Outfit eine Woche zuvor gekauft, alles gewaschen und an diesem Morgen für mich bereitgelegt. Als ich die Rüschen auf der Rückseite der Tennisunterhose für den Rock sah, blickte ich ihn einen Moment lang an und hoffte, dass es ein Scherz war. Aber sein Gesichtsausdruck verriet, dass er es ganz und gar ernst meinte. Also zog ich sie an.
»Er tut so, als wäre es nur ein Freundschaftsspiel«, fuhr mein Vater fort. »Aber er will sehen, ob du Mary-Louise gefährlich werden kannst.«
Es wurde bereits über meine Zukunft getuschelt. Ich wusste, dass ich bald Turniere bestreiten würde, so wie manche Kinder wissen, dass sie aufs College gehen werden. Und genau wie beim College hatte ich den Eindruck, dass mein Vater im Stillen darüber nachdachte, wie er es finanzieren konnte.
Ich wand mich in meinem Sitz und versuchte zu verhindern, dass die Strickjacke an meinem Hals scheuerte. »Kann ich Marie-Louise gefährlich werden?«, fragte ich.
»Ja«, sagte mein Vater.
Ich kurbelte mein Fenster herunter und sah den Pazifik vorbeifliegen.
»Ich möchte, dass du dir für das Spiel einen Plan machst«, sagte mein Vater. »Mary-Louise ist drei Jahre älter, also musst du davon ausgehen, dass sie größer, stärker und vielleicht selbstbewusster ist. Wie wirkt sich das auf deine Strategie aus? Du hast fünf Minuten.«
»Okay«, sagte ich.
Mein Vater drehte das Radio auf und konzentrierte sich auf die Straße. Schon bald stockte der Verkehr bedenklich, und wir kamen zum Stehen. Ich sah aus dem Fenster und beobachtete Kinder, die am Strand im Sand spielten. Zwei Mädchen in meinem Alter bauten eine Sandburg.
Zwischen solchen Mädchen und mir – Mädchen, mit denen ich zur Schule ging – hatte schon immer eine große Kluft gelegen, aber jetzt schien sie unüberwindlich.
Eine halbe Sekunde später setzten wir uns wieder in Bewegung, und ich fragte mich, warum jemand etwas aus Sand bauen wollte, wenn es morgen schon wieder weg war und man nichts mehr vorweisen konnte.
»Bueno, contame«, sagte mein Vater. »Was ist dein Plan?«
»Wenn sie stärker ist als ich, muss ich sie so weit wie möglich ans Netz bringen und meine Winkel nutzen. Und sie ist wahrscheinlich ziemlich selbstbewusst, also muss ich sie gleich zu Beginn verunsichern. Wenn sie Angst hat, dass eine Elfjährige sie schlagen könnte, dann wird eine Elfjährige sie schlagen.«
»Muy bien«, sagte er und hob die Hand, um mit mir abzuklatschen. »Meine Achilles. Die Größte der Griechen.«
Ich unterdrückte ein Lächeln, während wir über den Freeway rasten.
Mary-Louise gewann das Losen und bekam den ersten Aufschlag.
Ich stand an der Grundlinie und ließ die gespannten Saiten meines Schlägers von meiner Handfläche abprallen, dann drehte ich den Griff in der Hand.
Als ich auf meine nagelneuen Schuhe hinuntersah, bemerkte ich an der Schuhspitze eine dreckige Stelle. Also bückte ich mich und rieb sie ab.
Mein Vater saß mit Lars auf der Bank, der über eins achtzig groß war, sandfarbenes Haar hatte und ein Lächeln, das nie seine Augen erreichte. Ich war leicht gereizt wegen des Tons, in dem er Marie-Louise meinem Vater als »Jaguar« vorgestellt hatte.
Mary-Louise stand auf der anderen Seite des Platzes, in weißem Tennisrock und Pullover mit passendem Stirnband. Ich sah, wie groß und schlaksig sie war, das Gesicht schmal und zart. Vielleicht lag es an den perfekten Falten in ihrem Rock oder an der lässigen Art, wie sie ihren hölzernen Dunlop-Maxply-Fort-Schläger hielt, aber mir war klar, dass sie und ich zwar beide auf dem Platz zu Hause sein mochten, aber ansonsten in verschiedenen Welten lebten.
Sie lächelte mich an, und ich fragte mich, ob sie vielleicht das hübscheste Mädchen war, das ich je in meinem Leben gesehen hatte.