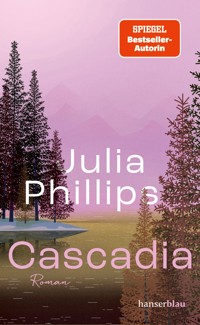
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem Bestseller „Das Verschwinden der Erde“ der neue Roman von Julia Phillips – über zwei Schwestern, deren Welt aus den Fugen gerät Auf einer Insel im Nordwesten der USA lebt Sam mit ihrer Schwester Elena und der schwerkranken Mutter in ärmlichen Verhältnissen. Sam arbeitet auf der Fähre, die die wohlhabenden Urlauber zu ihren Feriendomizilen bringt, während Elena im Golfclub kellnert. Sie beide träumen von einem besseren Leben, davon, woanders neu anzufangen. Dann, eines Nachts, erblickt Sam einen Bären, der durch die dunklen Gewässer vor der Küste schwimmt. Noch kann sie nicht ahnen, dass das wilde Tier die Welt der beiden Schwestern aus den Angeln heben und ihren lang gehegten Traum in Gefahr bringen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Auf einer Insel im Nordwesten der USA lebt Sam mit ihrer Schwester Elena und der schwerkranken Mutter in ärmlichen Verhältnissen. Sam arbeitet auf der Fähre, die die wohlhabenden Urlauber zu ihren Feriendomizilen bringt, während Elena im Golfclub kellnert. Sie beide träumen von einem besseren Leben, davon, woanders neu anzufangen.Dann, eines Nachts, erblickt Sam einen Bären, der durch die dunklen Gewässer vor der Küste schwimmt. Noch kann sie nicht ahnen, dass das wilde Tier die Welt der beiden Schwestern aus den Angeln heben und ihren lang gehegten Traum in Gefahr bringen wird.
Julia Phillips
Cascadia
Roman
Aus dem Englischen von Pociao und Roberto de Hollanda
hanserblau
Für Alex und unsere beiden geliebten Bärenkinder
»Du armer Bär«, sprach die Mutter, »leg dich ans Feuer und gib nur acht, dass dir dein Pelz nicht brennt.« Dann rief sie: »Schneeweißchen, Rosenrot, kommt hervor, der Bär tut euch nichts, er meint’s ehrlich.« Da kamen sie beide heran, und nach und nach näherten sich auch das Lämmchen und Täubchen und hatten keine Furcht vor ihm. Der Bär sprach: »Ihr Kinder, klopft mir den Schnee ein wenig aus dem Pelzwerk«, und sie holten den Besen und kehrten dem Bär das Fell rein; er aber streckte sich ans Feuer und brummte ganz vergnügt und behaglich. Nicht lange, so wurden sie ganz vertraut und trieben Mutwillen mit dem unbeholfenen Gast. Sie zausten ihm das Fell mit den Händen, setzten ihre Füßchen auf seinen Rücken und walgerten ihn hin und her, oder sie nahmen eine Haselrute und schlugen auf ihn los, und wenn er brummte, so lachten sie.
Brüder Grimm
Vierzehn Mal täglich — fünfzehn Mal an Wochenenden — fuhr die Fähre von Friday Harbor die um den San Juan Channel verstreuten Inseln an. Jede Rundfahrt dauerte fünfundsechzig Minuten. Zu lang. Eine Touristensaison nach der anderen verbrachte Sam die gesamte Zeit, viele Stunden am Tag, im Bistro und machte Kaffee für Menschen, die sie wie ein Dienstmädchen behandelten.
Wie Aschenputtel, die Linsen aus der Asche lesen musste, verrichtete Sam eine unbedeutende Arbeit, doch kein Prinz würde sie je davon erlösen. Sie war ein Nobody. Sam sah sie jeden Tag auf dem Schiff, diese Königskinder: typische wohlhabende Snobs mit graumeliertem Haar und kieferorthopädisch begradigtem Lächeln. Unterdessen tankten Promis und Tech-Millionäre aus Seattle ihre Wagen auf, nachdem sie mit Privatjets auf die Insel eingeflogen waren. Sie sahen Sam nicht. Sie würden sie niemals sehen. Sam war noch jung, aber lange genug dabei, um zu wissen, auf wen sie sich verlassen konnte und auf wen nicht, wem sie trauen konnte und mit wem sie sich herumschlagen müsste, damit die Rechnungen beglichen wurden. Den ganzen Tag standen breitschultrige Männer bei ihr an; sie blieb unbeeindruckt. Elena war die Einzige, die sie vor diesem Ort retten würde. Sie würden sich gegenseitig retten müssen.
Sams Arbeitsplatz war ein kleiner Kasten innerhalb eines großen Kastens: ein von hohen Wänden umgebenes Bistro, mitten in einem großen Raum mit Leuchtstoffröhren und Fenstern aus bruchsicherem Glas. Draußen kräuselten sich die Wellen, Wolken zogen vorbei. Manchmal tauchte ein Kai auf. Passagiere schoben sich auf die Fähre oder wieder herunter. Der Kai entfernte sich. Im Schein der Lichter riefen Eltern nach ihren ungezogenen Kindern und prahlten mit ihren Urlaubsplänen: Kajakfahren? Strandgut sammeln? Die Lavendelfarmen besuchen? Sie starrten durch Sam hindurch auf die Auslage hinter ihr und fragten, ob die abgepackten Zimtschnecken schmeckten. Sie bejahte. Es war gelogen. Egal, ob sie ihnen das Gebäck oder eine Brezel empfahl oder sie bei starkem Wellengang vor schweren Suppen warnte — die Touristen nahmen die Trinkgeldbox, auf der ein Pappschild sie aufforderte, freundlich und großzügig zu sein, kaum zur Kenntnis.
Ein winziger Teil von ihr konnte es ihnen nicht verübeln. Nach so langer Zeit in der Gastronomie hatte auch Sam ihre Großzügigkeit verloren. Alles war bloße Routine. Kaffee aufbrühen. Müll entsorgen. Zuckertütchen auffüllen. Die Schicht hinter sich bringen.
Sam verdiente vierundzwanzig Dollar pro Stunde damit, über das graue Wasser zu fahren und in Plastik verpackte Kekse und Chipstüten zu verkaufen. Zehn Dollar über dem Mindestlohn — einen Dollar für jedes Jahr ihres Lebens, das sie der Willkür des Verkehrsministeriums von Washington ausgesetzt gewesen war. Gutes Geld, wenn sie verlässliche Schichten bekäme; doch bisher hatte es nie gereicht, um damit über die Runden zu kommen.
Zehn Jahre zuvor hatte Sam mit dem Highschool-Abschluss in der Tasche auf ein Gehalt gehofft, auf das sie zählen konnten. Mit dem sie vorankommen konnten. Elena hatte Sams Ausbildung in der Handelsmarine finanziert, damit sie auf den Fähren Arbeit fand — es gab gute Jobs im Staatsdienst, mit Sozialleistungen, einer Pension und einer Krankenversicherung, die alle Familienmitglieder einschloss. Doch der Staat hatte Sam nicht eingestellt. Er lud sie nicht einmal zu einem Vorstellungsgespräch ein. Nichts war so gekommen, wie sie es sich vorgestellt hatte. Elena musste sich ein Bein ausreißen, um Sam eine Stelle im Golfclub zu besorgen, wo sie selbst arbeitete. Das Management kam mit Sam nicht klar, Sam kam mit dem Management nicht klar, und die Clubmitglieder erzählten endlose, langweilige Geschichten über ihre Abenteuer auf dem Rasen und beschwerten sich über die Drinks, die sie ihnen vorsetzte. Als dann die ersten Bistros auf den Fähren eröffneten, erschien es wie ein kleines Wunder: Sam war ausgebildet, qualifiziert und erfahren. Elena war erleichtert. Der Lebensmittellieferant stellte Sam ein. Sie wurde eingearbeitet, verdiente Geld. Und dann kam die Pandemie, der Fährbetrieb wurde eingestellt, die Bistros schlossen, und sie wurde für zwei Jahre entlassen.
Zwei Jahre zu Hause. Zwei Jahre Nichtstun. Der Golfclub wollte Sam nicht wiedereinstellen; sie könnten es sich kaum leisten, Elena weiterzubeschäftigen. Es kamen weniger Touristen. Auf der Insel selbst gab es nur kleine Coffee-Shops mit zunehmend eingeschränkten Öffnungszeiten, Ferienhäuser, die seltener geputzt werden mussten, und schicke Restaurants, die Sam nie eingestellt hätten, weil sie nicht gut im Smalltalk war und schlechte Zähne hatte. Als das Arbeitslosengeld auslief, begann sie, an bezahlten Online-Umfragen teilzunehmen, aber viel Geld war damit nicht zu machen, höchstens ein paar Dollar pro registrierter Stunde. Sie fuhr ihre Mutter zu Arztterminen, saß auf Parkplätzen herum, beantwortete Marktforschungsumfragen auf dem Handy und strich die miese Bezahlung ein.
In den letzten beiden Jahren hatten sie Elenas Kreditkarte enorm überziehen müssen. Um sechstausendfünfhundert Dollar, die, soweit Sam wusste, mittlerweile inklusive Zinsen auf fast elftausend angewachsen waren. Dann gab ihr Auto im Winter den Geist auf. Die Kosten für die Medikamente ihrer Mutter schnellten in die Höhe. Als im April der Staat ankündigte, die Gastronomie auf den Fähren wieder zuzulassen, legte Elena den Kopf auf den Küchentisch, und Sam sagte: »Weinst du?«
Elena sah sie mit trockenen Augen müde an. »Nein«, sagte sie. Und dann: »Aber Gott sei Dank.«
Sam hatte keinen Grund, dankbar zu sein. Mittlerweile stand sie seit mehr als einem Monat wieder hinter dem Tresen auf der Fähre, und sie waren genauso pleite wie zuvor. Sie nahm noch immer an Online-Umfragen teil, aber manchmal endete selbst das mit Frust, wenn gerade die Fähre aus dem Hafen auslief und der Empfang unterbrochen wurde, bevor sie die Fragen zu Ende beantwortet hatte. Touristen lenkten sie mit dämlichen Fragen über die Lummi Nation ab, als hätte Sam Zeit, an Kanu-Landungs-Zeremonien teilzunehmen oder zu einer Expertin für die Geschichte der San Juan Islands zu werden. Unterdessen versuchte Elena, ihre vom Grill des Golfclubs nach Hamburger-Fett stinkenden Trinkgelder beiseitezulegen, für den Notfall, doch die Notfälle nahmen kein Ende. Ihr ganzer Verdienst wurde von Steuern, Rechnungen und den Arztkosten ihrer Mutter aufgezehrt.
Aufreibend. Knochenarbeit. Endlos. Egal, welchen Job oder Lohn sie auch hätten, solange sie auf der Insel waren, würden sich die Dinge nicht ändern. Sie müssten wegziehen, erklärte Sam Elena immer wieder, wenn sie ein lebenswertes Leben haben wollten. Und Elena widersprach ihr nicht. Sie mussten nicht einmal darüber diskutieren, über die Notwendigkeit, wegzuziehen. Beide waren seit langem dazu entschlossen.
Elena mäkelte nur an den Details herum. Als ältere Schwester war es vielleicht ihre Aufgabe, pragmatischer zu sein. Sie bräuchten Ersparnisse, um wegzuziehen, sagte Elena, und sie hätten keine; sie müssten dieses und jenes bezahlen und hier und dort und …
Friday Harbor lag nun hinter Sam. Und vor ihr. Und hinter ihr. Über den Wellen, den San Juan Channel entlang, umkreiste die Fähre das Zentrum von Sams winzigem Universum. Schwarze Seevögel schossen über das Wasser. Die Inseln des Archipels bildeten eine nicht endende Reihe von grünen samtartigen Erhebungen. Auf den geschichteten Hügeln über der Küste erhoben sich strahlend weiße Gebäude. Vor Jahren, als Elena noch nicht damit beschäftigt war, sich den Kopf über eine Million kleiner logistischer Fragen zu zerbrechen, hatte sie zu Sam gesagt, dass es eine einzige Chance gäbe, von hier wegzukommen: das Haus. Wenn sie das Haus verkauften, würde ihre bessere Zukunft endlich anbrechen.
Das Haus war ein viel zu kleiner in Vinyl verpackter Albtraum aus dem Jahr 1979, das ihre Großmutter nach dem Tod ihres Mannes von der Witwenrente gekauft hatte. Damals musste sie geglaubt haben, das Haus sei ein Sprungbrett, das die Familie in die Mittelschicht katapultieren würde. Weit gefehlt. Es entpuppte sich als schwerer Klotz am Bein. Ihre Großmutter war in diesem Haus gestorben, und ihre Mutter hatte Elena und Sam hier zur Welt gebracht. Das Gebäude war mit ihnen gealtert. Die Verkleidung unter den Treppenstufen hatte sich verzogen. Die pfirsichgelbe Farbe an den Wänden blätterte ab. Die Kacheln im Bad hatten Sprünge. Das Wasser sickerte ins Gemäuer, das allmählich verfaulte und die kleine Erbschaft ihrer Großmutter immer mehr zerstörte.
Doch trotz des erbärmlichen Zustands war es noch immer eine Immobilie auf der malerischen Insel San Juan. Es lag auf einem zweieinhalb Hektar großen bewaldeten Grundstück fünf Meilen außerhalb der Stadt. Das Land war Gold wert. Im Moment war es nutzlos für die Familie, eine Last, doch irgendwann würde es irgendwem irgendetwas bedeuten.
Die Schwestern hatten sich ein Zimmer geteilt, bis zum Sommer vor Sams letztem Schuljahr, als Elena, die gerade ihren Abschluss gemacht hatte, ins Wohnzimmer zog. Mit achtzehn war sie rastlos gewesen, viel wilder als heute. Eher bereit, mit Sam über die Verwirklichung ihrer Träume zu sprechen. Eines Abends saßen sie auf der Couch, Kopfkissen und Decke neben sich zusammengeknüllt, und Elena erläuterte ihr den ganzen Plan.
Damals hatte ihre Mutter die Arbeitszeiten im Nagelstudio bereits reduziert. Sie hatte Probleme mit dem Atmen. Sie hatte Druck auf der Brust. Elena sah, wie müde sie war, wie sie schwächer wurde, und verstand — ihre Mutter brauchte sie. Deshalb würden sie bleiben, sagte Elena zu Sam. Sie würden ihre Mutter pflegen, so wie sie ihre Großmutter gepflegt hatte, bis sie keine Pflege mehr brauchte. Irgendwann würden sie das Haus erben, es verkaufen und sich woanders niederlassen. An einem Ort, wo sie tun und lassen konnten, was sie wollten. Weniger schuften, mehr leben. Wo sie die Menschen werden konnten, die sie bisher nie hatten sein können.
An jenem Abend schätzte Elena, dass ihnen nur noch wenige Jahre mit ihrer Mutter blieben. Höchstens fünf. Diese kostbare Zeit mussten sie mit ihr verbringen.
Es war erschütternd, wenn Sam die Jahre zählte, die seitdem vergangen waren. Ein Weckruf. Sie war jetzt achtundzwanzig und Elena fast dreißig. Ihre Mutter lebte immer noch. Und brauchte sie mehr als je zuvor.
Manchmal dachte Sam, dass damals, als sie noch Teenager waren und auf der Wohnzimmercouch saßen hinter dem Vorhang, den Elena an der Decke befestigt hatte, um ein bisschen Privatsphäre zu haben, tatsächlich der beste Moment gewesen war, zu gehen. Dieser Gedanke kam ihr, wenn Passagiere kein Trinkgeld gaben, die See aufgewühlt war oder die Fähre Verspätung hatte. Doch dann änderte sie ihre Meinung. Die Zeit hatte Elena recht gegeben. Ohne ihre Mutter hätten sie nicht weggekonnt — wer hätte sie gepflegt, was hätte sie gemacht? —, und ihre Mutter wollte nicht woanders hin, vor allem nicht, seit es ihr zunehmend schlechter ging. Von den Arztterminen abgesehen verbrachte sie jetzt den ganzen Tag im Bett, so bequem wie möglich in dem Haus, in dem sie ihre Kinder großgezogen hatte. Hätten sie versuchen sollen, sie von hier wegzulotsen? Sie überreden sollen, das Haus zu verkaufen und anderswo neu anzufangen? Das war keine Möglichkeit. Wäre nie eine gewesen.
Also waren Sams Überlegungen falsch. Elena hatte sich deutlich ausgedrückt. Ihre einzige Hoffnung war die Erbschaft. Auf fünfhunderttausend Dollar hatte Elena an jenem Abend im Wohnzimmer den Wert des Grundstücks geschätzt. Land im Wert einer halben Million Dollar, das ihnen gehörte. Eines Tages würde es auf den Namen der Schwestern übertragen werden, und dann würde endlich der Aufstieg beginnen, den ihre Großmutter für die Familie vorgesehen hatte — das Ende der Dienstleistungsarbeit, der wechselnden Schichten, der Quälerei. Sie würden ein allerletztes Mal den San Juan Channel überqueren.
Bis dahin arbeitete Sam weiter auf der Fähre, kochte Kaffee für Fremde und beteiligte sich an Umfragen über ihr Alter, ihre ethnische Zugehörigkeit und ihre Fernsehgewohnheiten. Noch mehr verschwendete Zeit, noch mehr ausgeworfene Anker. Noch mehr Gehaltsschecks, die verdient, eingelöst und verbraucht wurden.
Sam wartete darauf, dass sich ihr Leben änderte. Sie wartete schon sehr lange.
Das Bistro machte um halb neun zu. Nachdem Sam abgeschlossen hatte, ging sie aufs Passagierdeck, um den Rest der Fahrt nach Friday Harbor in der frischen Luft zu verbringen. Die Inseln, die vorbeizogen, waren sanft und von dunkler Vegetation bedeckt. Die Sonne würde erst in einer halben Stunde untergehen, aber am Himmel dämmerte es bereits. Es waren nicht viele Passagiere an Bord. Eine Handvoll Touristen, erschöpft von dem langen Tag in den Gezeitenbecken.
Ein Stück weiter weg glühte das orangefarbene Ende einer Zigarette auf. Sam hätte einschreiten müssen (das Rauchen auf Fähren war in Washington State verboten), doch sie blieb stehen und sog den Rauch ein. Passiver Genuss. Ein dünner köstlicher Hauch, Aromen, die von einem Fremden ausgeatmet wurden. Sam hatte geraucht, aber aufgehört, als der Staat die Tabaksteuer immer weiter erhöhte — zehn Dollar für eine Packung konnte sie sich nicht leisten. Eine Zeitlang schnorrte sie Zigaretten von Passagieren, bis sich jemand bei der Aufsicht beschwerte. Sam blieb nichts anderes übrig, als mit dem Rücken an die feuchte weiße Wand der Fähre gelehnt tief einzuatmen und das Wasser zu beobachten.
Eine Gestalt zerriss dessen glatte Oberfläche. Eine Kreatur, die sich bewegte. Jemand in ihrer Nähe schrie auf.
Du glaubst nicht, was wir heute von der Fähre aus gesehen haben«, sagte sie zu Elena, die am Spülbecken stand und das Geschirr abwusch. Es war spät, Elena hatte ihre Schicht schon vor Stunden beendet, aber sie wartete immer auf Sam. Sie hatte Reste von Chili con Carne aus dem Golfclub mitgebracht, und Sam stocherte im geriebenen Cheddar und den Frühlingszwiebeln herum. Ihre Mutter schlief im Zimmer nebenan. »Rat mal!«
Der Wald um das Haus stand still und schwarz. Dicht mit Douglasfichten und Weißdorn bewachsen, der dunkle Früchte trug. Der gelbe Schimmer am unteren Rand des Küchenfensters kam vom Grundstück ihrer nächsten Nachbarn, der Larsens, die ihren Garten stilbewusst beleuchteten und die Schwestern etwas zu höflich grüßten, wenn sie ihnen in der Stadt über den Weg liefen. Danny Larsen, der jüngste Sohn, hatte Elena damals zu seinem Abschlussball eingeladen. Doch seine Mutter hatte sofort dazwischengefunkt.
»Eine Leiche«, sagte Elena.
»Ach Quatsch«, erwiderte Sam und legte die Gabel auf den Tisch. »Hör ich mich so an, als hätten wir eine Leiche gesehen?«
»Keine Ahnung. Du kannst dich ja über die seltsamsten Dinge aufregen.« Elena strich sich mit dem feuchten Handgelenk das Haar aus dem Gesicht. »Einen Wal.«
»Wale sehen wir ständig. Rate weiter.«
»Einen Seelöwen.«
Sam verdrehte die Augen. Und obwohl Elena mit dem Rücken zu ihr stand und sie nicht sehen konnte, schien sie es zu bemerken. Sie musste die Bewegung gespürt haben. Daher versuchte Elena es erneut. »Einen Meerjungmann.«
»Du kommst eh nie drauf. Einen Bär!«
»Nein.«
»Einen riesigen Bär! Der im Channel geschwommen ist!«
Sam hatte ihn mit eigenen Augen gesehen: den nassen behaarten Buckel des Tieres, der Übergang zum Nacken, die spitze Nase und die runden kleinen Ohren. Das Wasser war silbrig und der Himmel dunkelblau. Vor diesen Farben war das Tier ein dunkler Fleck, dessen Umrisse sich vor dem letzten Licht des Tages abzeichneten; es hob sie klar, schockierend und fremd hervor. Die Touristen wechselten entzückte Ausrufe in Englisch, Spanisch und Chinesisch. Jemand warf dem Bären etwas zu, woraufhin ein anderer Passagier ihn zurechtwies. Die Fähre tuckerte weiter, und für ein paar lange, seltsame Minuten bewegten sich das Boot und der Bär Seite an Seite vom Festland in die Nacht. Der Kapitän machte sogar eine Durchsage über die Sprechanlage, damit alle, die drinnen saßen, an Deck kommen konnten, um den Bären zu sehen. Seinen erhobenen Kopf. Die nassen Schultern. Die auseinanderdriftenden Wellen, die er hinterließ. Ohne in ihre Richtung zu sehen, paddelte das Tier unbeirrt weiter.
Elena trocknete die Teller ab und stapelte sie in den Schrank. »Wo genau im Channel? Du glaubst doch nicht, dass er hierherkommen könnte, oder?«
»Zwischen Shaw und Lopez.« Die Frage amüsierte Sam. »Warum? Hast du Angst?«
»Vor Bären?«
»Vor furchteinflößenden Bären?«
»Du nicht?«
»Kein bisschen.« Wovor fürchtete sich Sam? Dass sie hier eingehen würde. Dass sie von Chancen träumte, die sie nie würde ergreifen können, dass sie durch die Zurückweisungen verkümmern und noch ärmer würde und dadurch unter immer stärkeren Druck geriete und sich noch weiter vom Rest der Welt entfernte. Verglichen mit diesen Ängsten schien es geradezu ein Vergnügen, sich von einem Bären zerfleischen zu lassen.
Elena wandte sich wieder der Spüle zu. »Unser tapferes Mädchen.«
»Wie war dein Tag?«
»Gut. Keine wilden Tiere. Außer du zählst Bert Greenwood dazu, der ist mittags betrunken aufgetaucht.«
»Nichts Ungewöhnliches also.«
»Eher Wal als Bär«, sagte Elena.
Sie hielt die Hände unter den Wasserhahn und senkte den Kopf, sodass sich ihr Hals streckte und die Knochen im Nacken hervortraten. »Soll ich die Töpfe machen?«, fragte Sam.
Elena schüttelte den Kopf. »Schon gut. Erzähl einfach weiter.«
Sam hatte nichts mehr zu erzählen. Die wenigen Minuten des Tages, in denen sie den seltsamen Schwimmer in der Wasserstraße gesehen hatte, waren die einzig bemerkenswerten gewesen. Alles andere war Routine: respektlose Passagiere, schwacher Kaffee, Stapel von schwankenden Pappbechern und das fortwährende Tuckern der Fähre. Obwohl — »Ben hat gefragt, ob ich mit ihm zelten will.«
Elena sah sie über die Schulter hinweg an. Trotz der dünnen dunklen Ringe unter den Augen schien sie in diesem Augenblick zu strahlen. Sie wirkte erfreut. Als hätte sie einen Witz gehört. »Zelten?«
Es war so peinlich. »Am Donnerstag, auf Orcas.«
»Wo genau? Im Moran Nationalpark?«
»In … weiß ich nicht, ich hab nicht gefragt.«
Elena grinste, nur ganz kurz, ehe sie sich wieder dem Spülen zuwandte. »Das solltest du tun.«
»Igitt, nein!«
»Was ist daran igitt?«
»Ich verbring doch nicht die Nacht mit ihm in einem Zelt und guck in die Sterne.«
»Warum nicht?« Elena stand mit dem Rücken zu ihr, aber sie konnte das Lächeln in ihrer Stimme hören, das unterdrückte Lachen. »Er mag dich. Ist doch süß. Er will sich mit dir in einen Schlafsack kuscheln und ›s’mores‹ machen.«
»Willst du mich veräppeln?«
Elena drehte sich um. Ihr Gesicht war jetzt ernst. »Nein.« Ein Hauch von Violett unterstrich ihre großen Augen. Sam sagte nichts, verzieh Elena aber augenblicklich, ohne Groll, und ihre Schwester wusste es. »Das würde ich nie tun«, sagte Elena und wandte sich wieder ihrem Geschirr zu.
»Ich hab ihm eh abgesagt«, sagte Sam. »Es ist eine blöde Idee. Bestimmt muss einer von uns am Freitag arbeiten.«
»Und wenn schon, könntest du nicht auch von Orcas an Bord gehen?«
Sam hatte keine Ahnung, ob Ben und sie ihre Schichten von einem anderen Hafen aus antreten konnten. Trotzdem sagte sie: »Nein, das geht nicht. Außerdem brauchst du mich hier über Nacht.«
»Ach was.« Elena schrubbte den Boden eines Topfes, eine Schulter vor Anstrengung erhoben. »Du stehst doch sowieso nicht mit ihr auf.«
»Doch, tu ich«, sagte Sam.
Spülwasser schwappte ins Becken. Schweigen. Elena drehte den Wasserhahn wieder auf, spülte den Topf aus und stellte ihn auf die Arbeitsplatte.
Das war Liebe: sie beide am Ende des Tages in der Küche. Die einzige Verbindung, die ein Leben lang halten würde. Dialoge in Kurzform, Gereiztheit, und trotzdem verstanden sie sich so gut, dass sie die Worte in einem Streit nicht einmal laut aussprechen mussten.
Sam schüttelte hinter ihrer Schwester den Kopf. »Ich kann nicht glauben, dass du zelten auf einmal so gut findest. Was für eine Zeitverschwendung!«
Elena spülte das leere Becken aus. »Ach richtig, deine kostbare Zeit.«
»Ich will nichts von Ben. Kapiert? Beziehungen sind nichts für uns.« Sam wiederholte nur, was Elena selbst einmal unmissverständlich geäußert hatte, als sie mit der Highschool anfingen und das Leben sich mit dem neuen Freund ihrer Mutter zum Schlechten entwickelte. Der Kerl hatte sich aufgespielt wie ein Pascha. Die ganze Familie terrorisiert. Es war die schlimmste Zeit, die sie jemals durchgemacht hatten — egal wie belastend sich die unerbittliche Routine von heute anfühlen mochte, sie war nichts im Vergleich zu den Strafen, die er sich ausgedacht hatte, seinem Geschrei und seinen Händen. Nachdem sie diese Tyrannei überlebt hatten, war ihnen eins bewusst geworden: Sie konnten sich nur aufeinander verlassen.
Elena drehte den Wasserhahn zu. »Ich meine ja nur. Ein bisschen Sterne gucken hört sich doch ganz lustig an.«
Aus dem hinteren Zimmer drang ein Husten. Geräusche hatten es zu leicht, durch das Haus zu wandern. Dünne Wände, nur dürftig isoliert. Elena griff nach einem Küchentuch.
»Ich mach schon«, sagte Sam. Sie stellte den Rest des Chili con Carne in den Kühlschrank und nahm ein sauberes Glas aus dem Wandschrank. Um es an der Spüle aufzufüllen, musste sie sich dicht neben ihre Schwester stellen. Sie legte Elena die Hand auf den Rücken. Die Berührung und das Glas Wasser waren eine Entschuldigung. Elena hatte recht: Sam übernahm keinen fairen Anteil an den Nachtschichten. Sie konnte sich mehr anstrengen. So wie jetzt, wie sie dastand, was sie tat. Unter ihren Fingerspitzen fühlte sich Elenas Schulterblatt an wie ein flacher Teller. Als das Glas überlief, drehte Elena den Hahn zu.
Die Schwestern waren mit einem Abstand von dreizehn Monaten zur Welt gekommen. Sie waren in der laxen Obhut ihrer Mutter aufgewachsen, in diesem Haus, in dem es nach Schimmel roch und in dem die Schränke nie ganz leer waren, die Nebenkostenrechnungen allerdings nicht immer beglichen wurden. Die Männer, die sie gezeugt hatten, waren verschwunden, lange bevor Sam sich an sie hätte erinnern können. Auch Elena sagte, sie könne sich nicht erinnern. Ihre Mutter erinnerte sich sicherlich, hatte aber beschlossen, darüber nicht zu sprechen. Als sie noch klein waren, hatten die Mädchen sie dazu befragt, aber ihre Mutter war immer ausgewichen. Wenn sie ihnen die Nägel lackierte, hatten sie den ruhigen Augenblick, in dem ihr Kopf andächtig über ihre Hand geneigt war, genutzt: Wer waren ihre Väter? Wie hatte sie sie kennengelernt? Wohin waren sie gegangen? Und sie antwortete, indem sie die Hände der Schwestern in die Luft hielt und sagte: »Was für schöne Farben ihr euch ausgesucht habt.« Eisblau mit weißen Glitzerpartikeln für Elenas Nägel. Leuchtendes Dunkelrot für die von Sam.
Als Kinder malten sich Sam und Elena Väter aus, die es verdient hatten, geheim gehalten zu werden. Helden. Prinzen. Spione, die untergetaucht waren. Doch am Ende wurde ihnen klar (der Einzug des Freundes ihrer Mutter war der Beweis), dass Menschen sich nicht weigerten, über außergewöhnliche Liebesgeschichten zu sprechen, wohl aber über stinknormale Arschlöcher. Als die Schwestern vierzehn und fünfzehn waren, trichterte ihre Mutter ihnen ein, sich nicht über die Situation zu Hause zu beklagen. Er sei gestresst, erklärte sie, deshalb schlage er um sich. Sie müssten alle mehr Verständnis haben. Als Elena ihrer Biologielehrerin erzählte, was zu Hause los war, und sich das Jugendamt einschaltete, reagierte ihre Mutter schockiert und stumm. Sprachlos angesichts Elenas Entscheidung, die familiären Umstände offenzulegen. Die Sozialarbeiter kamen, schrieben Berichte und verschwanden wieder. Elenas Lehrerin tat nichts weiter, als die Mädchen auf dem Schulflur mit gerunzelten Augenbrauen anzustarren. Als der Mann endlich auszog, wollte niemand je wieder seinen Namen in den Mund nehmen. Sam und Elena verstanden damals, dass sie nicht weiter nachhaken sollten, wer ihre Väter waren.
Seitdem hatte ihre Mutter keine ernsthafte Beziehung mehr gehabt. Als die Schwestern klein waren, glaubten sie, dass sie eines Tages heiraten — vielleicht zwei Brüder, sagten sie sich — und ausziehen würden, aber so kam es nicht. Innerhalb weniger Jahre wurde ihre Mutter krank, und die Geschichten, die sie sich ausdachten, nahmen eine andere Wendung: eine Stadt, in der niemand sie kannte. Ein eigener Garten mit zwei Rosenbüschen, weiß und rot, und genügend Zeit, um sich intensiv darum zu kümmern.
Das Träumen half. So war es schon gewesen, als sie noch Kinder waren und Antworten auf Fragen suchten, auf die kein Erwachsener einging. Es half ihnen, Dingen, die im Alltag unbegreiflich blieben, einen Sinn zu verleihen. Als sie Teenager waren und es zu Hause unerträglich wurde, gingen sie in den Wald, wo sie auf der kühlen Erde zwischen Hemlocktannen liegen und sich vorstellen konnten, woanders zu sein. Über ihnen zitterten die Nadeln an den Ästen. Meteore schossen über den Himmel. Der Vollmond war ein Loch in der Dunkelheit, eine offene Tür in eine andere Welt.
Heutzutage hatten sie nicht mehr so viel Zeit, um sich zuzuflüstern, was sein könnte. Sie mussten ihre Tage mit dem verbringen, was war. Sam träumte trotzdem weiter. Selbst während der vergangenen beiden Winter, als die Tage kurz und dunkel waren, sie sich Sorgen machten, wie gefährlich das Virus ihrer Mutter werden konnte, und das Dasein so sehr von den Regeln der Pandemie eingeschränkt wurde. Sie starrte aus dem Fenster auf die durcheinandergewürfelten Sternbilder. Sie stellte sich vor, dass der Mond hinter seiner weiß leuchtenden Oberfläche voller Rosen war. Sie träumte; und um diese Träume, kostbare Schätze, zu nähren, teilte sie sie mit Elena.
»Danke, Schatz«, sagte ihre Mutter, als Sam ihr das Glas Wasser reichte. Unter dem abgetragenen Baumwollnachthemd zeichnete der Katheter unnatürliche Linien auf ihre Brust. »Ist deine Schwester wach?«
»Sie spült ab.«
»Fragst du sie, ob sie herkommt, wenn sie fertig ist?«
»Brauchst du was, Mom?«
»Elena kann mir helfen«, antwortete ihre Mutter.
»Ich auch. Brauchst du mehr Sauerstoff?«
Ihre Mutter zögerte. Das Wasserglas zitterte in ihrer Hand. Schließlich sagte sie: »Ich muss auf die Toilette.«
»Okay.«
»Tut mir leid. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Heute Abend bin ich zu erschlagen.«
»Kein Problem. Ich helf dir.«
»Aber sei nicht so grob.«
»Bin ich nicht«, sagte Sam. »Versprochen.« Sie spreizte die Finger, ballte sie zur Faust, öffnete sie wieder. Sie konnte die Sanftere von beiden sein.
Sie zog ihrer Mutter die Decke von den Beinen und half ihr, die Füße auf den Boden zu stellen. Dann legte sie den Arm um ihre Taille und half ihr hoch. Ihre Mutter holte tief Luft. Es klang angestrengt. Sam lockerte ihren Griff, und sie gingen zusammen durch den Flur ins Badezimmer. Sam kniete sich auf die pulvrig gelben Fliesen, half ihrer Mutter mit der Unterwäsche und schob sie auf die Schüssel zu.
»Zu schnell«, sagte ihre Mutter.
»Was?«
»Mach langsamer.«
Sams Muskeln waren angespannt vor nicht genutzter Energie. Sie machte langsamer. Half ihrer Mutter auf den Sitz und setzte sich selbst auf die Fersen.
Nach vorn gebeugt sah ihre Mutter sie an. Die krumme Haltung machte ihren Atem noch flacher. Sie hatte Elenas eingefallene Augen, schwere Augenlider, helles Haar und Sams Mund. Sie hatte sich aufgespalten, ihr Gesicht geteilt, um sie beide zu erschaffen.
»Wie war die Arbeit?«, fragte sie.
»Ach«, sagte Sam. »Wie immer.«
Sie schwiegen. Dann sagte ihre Mutter: »Du findest, ich sollte Windeln tragen.«
Sam sagte: »Nein, finde ich nicht. Warum sagst du das?«
»Wäre es nicht einfacher?«
»Sie sind bestimmt ziemlich teuer. Wäre es einfacher für dich? Willst du welche?«
»Ich schaffe das schon«, sagte ihre Mutter. »Wenn ihr nicht da seid, schaff ich’s ja auch. Ich komme zurecht.«
In letzter Zeit war ihre Mutter manchmal nass und roch, wenn sie nach Hause kamen. Elena wechselte täglich die Bettwäsche. Sam sagte: »Na gut.« Ihre Waden bildeten zwei harte Linien auf den Fliesen.
Sam dachte an das Wasser neben der Fähre. Das weiße Muster der gekräuselten Wellen und den massigen Bären, der sie durchpflügte und an ihnen vorbeischwamm. Die bewaldeten Hügel, die sie bei jeder Rückkehr zur Insel erwarteten. Die schaukelnden Masten unzähliger Segelschiffe, die hier vor Anker lagen. Sie dachte an die Mädchen, mit denen Elena und sie zur Schule gegangen waren. An die wenigen, die geblieben waren; an die vielen, die weg waren. An die leeren Häuser, wenn sie mit ihren Familien Urlaub auf Hawaii oder in Mexiko machten. An ihre Hände, die Sams und Elenas Mutter zu besonderen Anlässen manikürt hatte: polierte Nägel, zurückgeschobene Nagelhaut, Formaldehyd und Dibutylphthalat, eingeatmet über Stunden, Wochen und Jahrzehnte. Diese Mädchen, die jetzt Frauen waren, gelegentlich mit ihren Eltern im Golfclub vorbeischauten und sich nicht die Mühe machten, Elena nach ihrer Mutter zu fragen. Elenas Hände im Spülbecken. Die Seehunde, die im Hafen am Fuß der Docks bellten.
»Klopapier bitte«, sagte ihre Mutter. »Danke.«
Sam hielt sie fest, zog ihr Nachthemd glatt und gab sich erneut Mühe, rücksichtsvoller zu sein. Als sie die Spülung betätigte, rief Elena: »Alles in Ordnung?«
»Ja, ja«, antwortete Sam, »mach dir keine Sorgen.« Dann begleitete sie ihre Mutter zurück zum Bett.
In dieser Nacht wachte Sam von ihrem Stöhnen auf. Elena war bei ihr im Zimmer, sprach aber so leise, dass Sam sie nicht verstehen konnte. Sie wollte nicht aufstehen. Sie wusste, dass sie es tun sollte, aber sie wollte nicht — und als sie schließlich beschloss aufzustehen, sprang der Sauerstoffkonzentrator an, Elenas Stimme verstummte, und alles schien wieder in Ordnung zu sein. Sam lauschte und schlief dabei ein. Sie träumte vom Wald.
Danach wachte sie noch einmal auf — mehr Geräusche. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, aber sie hatte so lange geschlafen, dass die erste Fähre des Tages wahrscheinlich schon ausgelaufen war. Doch das kümmerte sie nicht. Ihre Schicht begann erst am Nachmittag.
Dieses Mal stammten die Geräusche nicht von ihrer Familie. Sie kamen von draußen, da kratzte etwas, schnaufte. Ein Tier.
Sie drehte sich auf die andere Seite. Im Zimmer war es so dunkel, dass sie weder die Kommode noch die Tür sehen konnte. Als wären ihre Augen schon geschlossen. Hätte der Bär die Meerenge zu dieser Tageszeit durchschwommen, hätten sie ihn nicht gesehen — er wäre an ihnen vorbeigezogen, schattenhaft und geschmeidig wie ein Fisch. Sie schloss die Augen, schwarz auf schwarz, und dachte an das Tier. Was für ein Glück, es gesehen zu haben. Manchmal schätzte Sam sich glücklich. Manchmal sah sie wirklich schöne Dinge.
Mit frisch gewaschenem Haar und übergeworfener Jacke verließ Sam um die Mittagszeit das Haus und stieß auf einen gesprenkelten Fäkalienhaufen, feucht vom Nieselregen. Sie runzelte die Stirn. Der Haufen lag auf dem kurzen Gehweg zwischen ihrer Haustür und der Straße. Danny Larsen ging gerade mit seinem großen Hund die Einfahrt zu seinem Haus auf der anderen Straßenseite hinauf, und sie rief ihm nach: »Na danke!«
Danny drehte sich um. Der Hund bellte und tanzte um seine Beine. »Was?«, rief er zurück.
Sam schüttelte den Kopf und drehte die Autoschlüssel um ihren Finger. Es reichte anscheinend nicht, dass ihre Nachbarn sie wie den letzten Dreck behandelten; jetzt setzten sie ihnen auch noch wortwörtlich einen Scheißhaufen vor die Tür. Die Luft stank nach Fleisch, Moschus, Haar. Eine eigentümliche Mischung, die ihr die Kehle zuschnürte. Danny und der Hund kamen auf sie zu.
»Meintest du mich?«, fragte er, als er nah genug war. Der Hund sprang in der Einfahrt hin und her. Das dichte bernsteinfarbene Fell hüpfte bei jeder Bewegung mit.
Sam zeigte auf den Haufen. »Warst du das?«
»Nein.« Und dann besaß er doch tatsächlich die Frechheit, sie anzugrinsen. »Normalerweise benutze ich eine Toilette.«
»Dein Hund«, sagte sie. »War das dein Hund?«
Einen irritierenden Augenblick lang fürchtete sie, er könne genauso antworten wie vorher — mein Hund ist doch kein gesprenkelter Haufen Scheiße, mein Hund ist hier neben mir, siehst du ihn nicht? —, doch er schüttelte nur den Kopf, immer noch grinsend. »Nein.«
Hielt er sie für blöd? »Wer geht denn sonst hier mit seinem Hund Gassi?«, fragte sie. »Nur du.«
»Das war kein Hund«, sagte er. »Eher ein Pferd. Das ist riesig.«
Sie biss sich in die Wangen, um nicht noch mehr zu sagen. Wow, was war er doch für ein Experte! Danny musterte sie mit zusammengekniffenen Augen. Der Regen perlte sanft von seinem Bart ab. In der Highschool war er ziemlich beliebt gewesen, ein guter Sportler. Ein Junge, der so tat, als käme er mit jedem aus, aber mit niemandem wirklich befreundet war. Die ganze Schule hatte nur dreihundert Schüler gehabt, was sie zu einer winzigen, klatschsüchtigen Hölle machte, einem Eimer voller Flusskrebse, die übereinander herfielen und nacheinander schnappten. Sam musste sich auf ihre Schwester und den Abschluss fokussieren, um durchzukommen. Aber am Rand ihres Gesichtsfelds tauchte immer wieder Danny Larsen auf, der sich in seinen Fußball-, Wrestling- oder Baseballklamotten mit den Lehrern unterhielt oder mit seinen Klassenkameraden herumalberte.
Damals hatte sie das wütend gemacht. Er und seine Kumpel — die ganze Clique. Eingebildete Kids, die meinten, nichts könne ihnen etwas anhaben. Danny ging aufs College und kehrte ein paar Jahre später zurück, um in der Landschaftsgärtnerei seines Vaters zu arbeiten. Dann ging sein Vater in den Ruhestand, und Danny übernahm. Mittlerweile war er ein echter Geschäftsmann geworden. Er hatte einen Laster mit dem Schriftzug der Larsens, gebrandete T-Shirts und Werbeplakate, auf denen er seine Dienste anbot. Er hatte sich kein bisschen verändert, war noch immer muskulös, freundlich und scheinheilig.
Sam war lieber ehrlich und einsam als scheinheilig und von Bewunderern umgeben. Es war tausendmal besser. Elena fand das auch. Sam konnte es bis heute nicht fassen, dass Danny einmal versucht hatte, mit Elena anzubändeln. Sie konnte sich kaum vorstellen, dass die beiden sich auch bloß unterhielten.
»Habt ihr Wühlmäuse?«, fragte er. Als sie nicht gleich antwortete, weil sie die Frage nicht verstand, zeigte er auf das Haus. Sie drehte sich um. Es erklärte immer noch nichts: klein, schäbig, cremeweiß, wie immer. Büschelweise Unkraut am Fundament.
»Was?«, sagte sie.
»Da hat sich jemand ausgetobt.«
Sie kniff die Augen zusammen, und dann sah sie es. Die Verkleidung neben der Eingangstür war beschädigt. Ein Vinylpaneel war auf Kniehöhe abgesplittert, das Holz darunter beschädigt.
»Verdammt«, sagte sie. »Wann ist das passiert?« Die Frage war mehr an sie selbst gerichtet, doch Danny reagierte mit einem Achselzucken.
»Habt ihr irgendwelche Tunnel im Rasen entdeckt?«, fragte er. »Wühlmäuse graben sich überall durch. Sie nagen sich sogar durch Bäume. Wir könnten helfen, wenn ihr wollt. Sie sind klein, aber eine echte Plage.«
Der Hund hechelte. Allein das Geräusch überforderte Sam. Hunde und Nagetiere — Danny zufolge sogar Pferde — waren dabei, über ihr Grundstück herzufallen und es in einen Zoo zu verwandeln, um die Hoffnung, die Sam und Elena noch blieb, zu zerstören. »Super«, sagte sie. »Tolle Neuigkeiten. Was bin ich froh, dass du vorbeigekommen bist.«
Dannys Mundwinkel verzogen sich. Trotzdem antwortete er mit unverändert freundlicher Stimme: »Du hast mich gerufen.«
»Stimmt«, sagte sie. »Hab ich. Tja. Danke, dass du mich dran erinnerst.«
Sie musste zum Fährhafen. Ihre Schicht begann um drei. Vor Sam lag der feuchte, spiralförmige Haufen.
»Wie geht’s deiner Mom?«, fragte Danny. »Und deiner Schwester?«
»Gut. Beiden.«
»Ich glaube, ich habe eure Mom schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Ist alles in Ordnung?«
»Ja«, sagte Sam. »Alles gut … sie ist nur nicht besonders mobil zurzeit. Ihr wird schnell schwindelig, wenn sie zu lange steht.«
»Das tut mir leid. Sucht ihr nicht nach einem anderen Arzt? Ihr seid doch bei Doktor Boyce, oder?«
»Oh«, sagte Sam. »Ich glaube ja … Keine Ahnung. Das ist eher Elenas Idee. Mom schwört ja auf Boyce.«
»Ich habe Elena die Nummer der Klinik gegeben, in die meine Eltern gehen, für alle Fälle. Die Fachärzte sind alle drüben in Mount Vernon. Meine Eltern sind sehr zufrieden mit ihnen.«
Mount Vernon, eine lange Fährfahrt entfernt. Zwei Stunden alles in allem, wenn man die Autofahrt mitzählte — sie müssten sich einen ganzen Tag freinehmen, nur um ihre Mutter zu einem einzigen Termin zu bringen, wo sie eine Ewigkeit im Wartezimmer sitzen würden, um dann exakt dieselbe Diagnose zu bekommen, die sie bereits kannten: Sarkoidose, pulmonale Hypertonie, interstitielle Lungenkrankheit. Dieselben Vorschläge, an klinischen Studien teilzunehmen, zu denen sie keinen Zugang hatten. Dieselben Angebote für Behandlungen, die sie sich kaum leisten konnten und die ohnehin nichts änderten. Diuretika, Digoxin, Sauerstoff. Alles, um sie von dem abzulenken, was ihre Mutter schon vor langer Zeit als unausweichlich bezeichnet hatte: dass sie daran sterben würde.
»Danke«, sagte Sam.
Der Hund drängte sich an Dannys Hosenbein vorbei, um die faulige Luft zwischen ihnen zu beschnüffeln. Danny streichelte sein weiches Fell und hielt ihn fest. »Wenn ihr was braucht …«
»Alles gut.«
»Trotzdem«, sagte er. »Ich hab’s deiner Schwester auch schon gesagt. Wir wohnen doch nur ein paar Schritte von euch entfernt.«
Sam konnte sich perfekt ausmalen, wie er an einem von Elenas Tischen Chili con Carne bestellte und ihr seine Hilfe anbot. Er war so nervig. Und er brachte Sam dazu, es ihm gleichzutun — das war eine seiner schlimmsten Eigenschaften. Seine Nettigkeit vermittelte ihr das Gefühl, dass sie ebenfalls freundlich sein sollte. »Ich muss zur Arbeit«, sagte sie. »War schön, dich zu sehen, Danny.«
Er zeigte auf den Boden. »Soll ich das wegmachen? Ich habe Plastikbeutel dabei.«
Nein, hätte sie am liebsten gesagt, verschwinde von diesem Grundstück, lass meine Schwester in Ruhe und halt dich aus den Problemen meiner Familie raus. Aber die Vorstellung, dass der allseits beliebte Danny Larsen den Dreck von ihrem Gehweg aufkratzte, war zu verlockend, deshalb sagte sie: »Das wäre toll, danke.«
Hinter ihnen das Haus mit der abgerissenen Verkleidung, ein Teil seiner Innereien freigelegt.
Am Nachmittag wurde der Regen stärker. Von der Fähre aus beobachtete Sam, wie die Tropfen an den Scheiben herunterliefen und die Wellen am Horizont schwappten. Das Schiff schlingerte. Sie hielt sich am Tresen fest. Als sie an der Teestation einem Gast helfen musste, spritzte kochendes Wasser auf ihr Handgelenk; der Gast entschuldigte sich, und sie entschuldigte sich auch, wütend über sich selbst und alle um sie herum. Anschließend nahm sie eine Flasche Apfelsaft aus dem Kühlschrank und presste sie auf die verbrühte Haut.
Als sie nach Hause kam, war die Sonne untergegangen. Der Wald hob sich vor dem Himmel ab. Das Licht über der Haustür brannte, und sie sah, dass der Haufen verschwunden war. Der Regen hatte die Stelle ausgewaschen, den Gestank aber nicht ganz beseitigt.
Sie steckte den Schlüssel ins Schloss, extra langsam, damit der Ärmel der Jacke nicht die empfindliche, gerötete Stelle an ihrem Handgelenk streifte. Neben den Stufen, wo ein Teil der Verkleidung fehlte, hatte die feuchte Luft das rohe Holz dunkler gefärbt. Parallele Splitterreihen verliefen darüber.
Sie schloss die Tür auf. Aus dem Innern des Hauses drangen Elenas Stimme und das Dröhnen des Fernsehers im Zimmer ihrer Mutter. Der Gestank hing in der Luft, es roch nach Magensäure und zerfetzten Körpern, nach nassem Fell und Mundgeruch. Sauer und faulig. Kupfer und Erde. »Hast aber lange gebraucht«, rief Elena aus dem Wohnzimmer, und Sam trat ins Haus.
Am nächsten Tag wachten sie auf, und ein Bär stand vor der Tür.
A





























