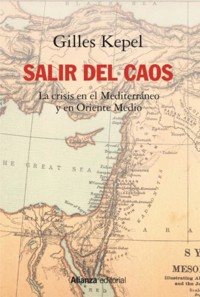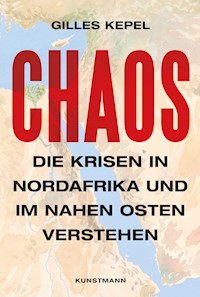
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit wegweisender Klarheit und profundem Wissen durchdringt Gilles Kepel die komplexen Krisen und Konflikte, die seit Jahrzehnten den arabisch-islamischen Raum, seine Gesellschaften und die Welt in Atem halten. Wer Lösungen für die Zukunft des Nahen Ostens sucht, muss dieses Buch lesen. Die Lage im Nahen Osten ist unübersichtlich: Krieg und humanitäre Katastrophen in Syrien und Jemen, das komplexe Kräftemessen zwischen Schiiten und Sunniten, die latente Bedrohung durch die verbleibenden IS-Kämpfer in der Levante, widerstreitende geopolitische Interessen. Zudem ist die ganze Region mit demografischem Druck und der Notwendigkeit eines Wandels überholter Wirtschaftssysteme konfrontiert. Kaum einer kennt den Nahen Osten besser als der renommierte französische Soziologe und Arabist Gilles Kepel. Als Zeuge vor Ort, Beobachter und Chronist verfolgt er seit Jahrzehnten die zunehmende Islamisierung der politischen Ordnung. In seiner Darstellung der letzten fünfundvierzig Jahre zeichnet Kepel nach, wie die gewaltigen Öleinnahmen und die Durchsetzung des politischen Islams den chaotischen Kreislauf antrieben, der mit dem Oktoberkrieg 1973 begann und, paradoxerweise, sowohl über die Ausweitung des Dschihads als auch über die zunächst so hoffnungsvoll begrüßten Aufstände des Arabischen Frühlings 2011 in dem monströsen »Kalifat« des IS und der Zerstörung der Levante mündete. So kenntnisreich wie präzise entschlüsselt Kepel die gewaltigen Herausforderungen, vor denen der Nahe Osten und der Westen heute stehen. Ein unverzichtbares und zukunftsweisendes Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Die Lage im Nahen Osten ist unübersichtlich: Krieg und humanitäre Katastrophen in Syrien und Jemen, das komplexe Kräftemessen zwischen Schiiten und Sunniten, die latente Bedrohung durch die verbleibenden IS-Kämpfer in der Levante, widerstreitende geopolitische Interessen. Zudem ist die ganze Region mit demografischem Druck und der Notwendigkeit eines Wandels überholter Wirtschaftssysteme konfrontiert.
Kaum einer kennt den Nahen Osten besser als der renommierte französische Soziologe und Arabist Gilles Kepel. Als Zeuge vor Ort, Beobachter und Chronist verfolgt er seit Jahrzehnten die zunehmende Islamisierung der politischen Ordnung. In seiner Darstellung der letzten fünfundvierzig Jahre zeichnet Kepel nach, wie die gewaltigen Öleinnahmen und die Durchsetzung des politischen Islam den chaotischen Kreislauf antrieben, der mit dem Oktoberkrieg 1973 begann und, paradoxerweise, sowohl über die Ausweitung des Dschihads als auch über die zunächst so hoffnungsvoll begrüßten Aufstände des Arabischen Frühlings 2011 in dem monströsen »Kalifat« des IS und der Zerstörung der Levante mündete. So kenntnisreich wie präzise entschlüsselt Kepel die gewaltigen Herausforderungen, vor denen der Nahe Osten und der Westen heute stehen. Ein unverzichtbares und zukunftsweisendes Buch.
»Eine meisterhafte Lektion in Geopolitik.«L’Express
Über den Autor
Gilles Kepel wurde 1955 in Paris geboren und studierte Soziologie, Anglistik und Arabistik. Er gilt als einer der bedeutendsten Soziologen Frankreichs und renommierter Kenner der arabischen Welt. Gilles Kepel ist Professor am Institut d’Études Politiques de Paris und Autor zahlreicher Bücher. Bei Kunstmann erschien u.a. Terror in Frankreich. Der neue Dschihad in Europa.
GILLES KEPEL
CHAOS
DIE KRISEN IN NORDAFRIKA UNDIM NAHEN OSTEN VERSTEHEN
Aus dem Französischen vonEnrico Heinemann und Jörn Pinnow
Mit geopolitischen Landkarten vonFabrice Balanche
VERLAG ANTJE KUNSTMANN
© der deutschen Ausgabe: Verlag Antje Kunstmann GmbH, München 2019© Originalausgabe: Gallimard, Paris 2018Titel der Originalausgabe Sortir du Chaos. Les Crises en Méditerranée et au Moyen-orientUmschlaggestaltung: Heidi Sorg und Christof Leistl, unter Verwendung einer Karte von Jacques FerrandezeBook-Produktion: HGV Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice mbHISBN 978-395614-342-7
Für meinen Vater
INHALT
EINLEITUNG
Ein Grab für Syrien
ERSTER TEIL
DAS BARREL UND DER KORAN
1. Die Islamisierung der politischen Ordnung (1973–1979)
Der Niedergang des arabischen Nationalismus
Der Ramadan-Krieg im Oktober 1973: Das Öl als Waffe und der Protodschihad
Die schrittweise Islamisierung der Gesellschaften
Das Schlüsseljahr 1979: Überbietungswettbewerb zwischen Schiiten und Sunniten
2. Der Ausbruch des internationalen Dschihad gegen den »nahen Feind« (1980–1997)
Der Kampf um die Kontrolle über die Islamisierung in den 1980er-Jahren
Das Jahr 1989: der Dschihad und der Zusammenbruch des Kommunismus
Die erste Phase des gescheiterten Dschihad: die 1990er-Jahre
Der Dschihad in Algerien und der Beginn des Terrors in Frankreich (1992–1997)
Der erfolglose Dschihad in Ägypten (1992–1997) und Bosnien (1992–1995)
Die Dschihadisierung des Palästina-Konflikts
3. Die zweite Phase des Dschihadismus: al-Qaida gegen den »weit entfernten Feind« (1998–2005)
Osama bin Laden und al-Qaida
Ritter unter dem Banner des Propheten
Von der Zweiten Intifada zum 11. September: die Beispielhaftigkeit des Selbstmordattentats
Die Katastrophe des 11. September
Die »Neocons« im Spiegel der Dschihadisten: der »Krieg gegen den Terror«
4. Die dritte Generation der Dschihadisten: Netzwerke und Territorien (2005–2017)
ZWEITER TEIL
VOM ARABISCHEN FRÜHLING ZUM DSCHIHADISTISCHEN KALIFAT
Einleitung
Der Arabische Frühling im Kontext,
Sturz des Regimes oder konfessioneller Bruch,
1. Aufstände des ersten Typs: vom Sturz der Despoten bis zur Umwälzung von Gesellschaften
Die tunesische Demokratie zwischen gesellschaftlicher Spaltung und dschihadistischer Gefahr
Der Funke von Sidi Bouzid,
Das demokratische Aufbäumen gegen den Salafismus,
Regionale Spaltung und soziale Gefahr,
Die ägyptische Schlinge: Muslimbruderschaft gegen militarisierte Gesellschaft
Das Happening auf dem Tahrir-Platz,
Die Muslimbrüder in der Offensive,
Die Rückkehr der Armee und die Ausbreitung der Salafisten,
Die Auflösung Libyens: vom »Schurkenstaat« zu dschihadistischen Netzwerken
Westliche Militärschläge und die Auflösung des Staates,
Die Muslimbrüder und die Stämme,
Ausbreitung der Dschihadisten und Zunahme des Menschenhandels,
Schlussfolgerung: Demokratie, Eindämmung oder Chaos
2. Aufstände des zweiten Typs: die Kluft zwischen Schiiten und Sunniten sowie das Scheitern der Rebellionen
Die sunnitische Niederschlagung der Revolte in Bahrain
Vom jemenitischen Stammes-Gleichgewicht zur landesweiten Verschärfung des Identitätskampfs
Der Stammespluralismus, ein Demokratieersatz,
Sektiererische Radikalisierung,
Vom syrischen Aufstand bis zum Dschihad in der Levante
Der Irak als Fabrikationsstätte des syrischen Dschihad,
Die Salafisierung der Rebellion und die Blindheit des Westens,
Spaltung im Herzen des Dschihad,
Die Verkündung des »Kalifats«,
Die russische Intervention und die Rückeroberung Aleppos,
Der türkische Einsatz: zwischen neoosmanischer Projektion und innerstaatlichen Widersprüchen,
Der Sturz des »Kalifats«,
Schlussfolgerung
DRITTER TEIL
NACH DEM SOGENANNTEN »ISLAMISCHEN STAAT«: AUFLÖSUNG UND NEUORDNUNG
1. Der »sunnitische Block« bricht auseinander
Scherbengericht über Katar
Die »Ritz-Carlton-Revolution« in Riad
Sunnitisches Debakel und Mitbestimmung der Schia im Irak
2. Die weltweiten Einsätze im Kampf um die Levante
Die sich abzeichnende Niederlage des syrischen Aufstands: Der Westen in misslicher Lage
Von Afrin nach Kirkuk: wieder »Pech für die Kurden«
Iran: Vormachtstellung oder ein Reich auf tönernen Füßen?
Von »der Stunde Russlands« zu Putins Dilemma mit seinen Regionalverbündeten
Die Zwangslage des Donald Trump
ALLGEMEINE SCHLUSSFOLGERUNG
Die Bruchlinien des Nahen und Mittleren Ostens und die weltpolitische Plattentektonik
ANHANG
Danksagung
Zeittafel
Register
EINLEITUNG
EIN GRAB FÜR SYRIEN
Von 1977 bis 1978, also vier Jahrzehnte bevor dieses Buch entstand, hielt ich mich als Stipendiat der arabischen Sprache für ein Jahr in Syrien auf, am Institut Français in Damaskus. Für uns angehende Arabisten war dies Pflicht und zugleich ein Sesam-öffnedich zu den faszinierenden, uns noch verborgenen grammatikalischen und phonetischen Geheimnissen des Orients. Bis auf wenige Ausnahmen gelang niemandem in unserer Zunft eine Karriere, der nicht im »Scham« geweilt hatte. Mit dem alten und im lokalen Dialekt noch gebräuchlichen semitischen Wort bezeichneten wir unter uns sowohl die Levante als auch deren traditionelle Hauptstadt. In der muslimischen Geografie, in der man sich vom Westen her gen Mekka beugt, steht der Scham für links oder den Norden, und der Jemen für rechts beziehungsweise den Süden.
Weder meine Studienkollegen noch ich hätten uns damals vorstellen können, dass der Begriff des Scham vierzig Jahre später zum verbindenden Schlagwort der Dschihadisten in den französischen Banlieues werden würde, die sich den Kämpfern des sogenannten »Islamischen Staats« (oder Daesh) anschlossen, um »Abtrünnige« zu massakrieren. Zu ihren Opfern gehörten zunächst vor allem Alawiten, also Gläubige jener esoterischen Konfession, zu der sich auch der syrische Präsident Hafiz al-Assad bekannte. Dann kamen sie zurück, um ihre »ungläubigen« Landsleute im Bataclan oder dem Stade de France zu töten. Und in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich mir nicht ausmalen können, als erfahrener Arabist im Juni 2016 von einem franko-algerischen IS-Kämpfer zum Tode verurteilt zu werden. Ursprünglich aus Roanne stammend, war er in Oran aufgewachsen, befand sich nun aber in der syrischen Stadt Raqqa, wo der sogenannte »Islamische Staat« seine kurzlebige Hauptstadt errichtet hatte. Verkündet wurde das Urteil über Facebook.live von einem seiner Handlanger, einem Franzosen mit marokkanischen Wurzeln, der in Magnanville einen Polizisten und dessen Ehefrau ermordete. Ich hätte auch nie geglaubt, dass ich in der Folge gezwungen sein würde, mitten im Pariser Quartier Latin unter Polizeischutz zu leben. Zu meinen Studienzeiten war das Internet natürlich noch unbekannt, ja sogar unvorhersehbar oder undenkbar, und in einem zweidimensionalen Atlas sah man Staaten, deren Staatsgebilde und Territorien eindeutig durch schwarze Linien gekennzeichnet waren. So wie auf der Karte des Römischen Reichs, die 1974, also vor meinem orientalischen Traum, im Unterrichtsraum für Geisteswissenschaften hing und mich dazu verführte, im folgenden Sommer in Venedig ein Schiff zu besteigen. Ich wollte in Istanbul, in der Levante und Ägypten mit eigenen Augen all die Gegenden entdecken, die auf der Karte zu sehen gewesen waren. Niemand konnte damals die zahllosen Zusammenstöße antizipieren, die die digitale Welt und die sozialen Netzwerke in den Köpfen der Menschen und den Darstellungen der Welt auslösen sollten. Niemand ahnte die geistige Verwirrung voraus, die mit dem Verschwinden von Distanzen und Perspektiven einhergehen sollte, mit der Auflösung von räumlichen und zeitlichen Bezugspunkten, die uns vierzig Jahre später die Orientierung hat verlieren lassen.
Auch wenn in Damaskus Ende der 1970er-Jahre Ruhe herrschte, so wütete das Chaos bereits im benachbarten Libanon. Der Bürgerkrieg mit seinen Gräueltaten tobte entlang politisch-konfessioneller Linien und verdeutlichte damit die Verwirrung, die zwischen den beiden Identitäten, »islamisch-progressiv« und »christlich-konservativ«, herrschte. Diese hybriden Bezeichnungen standen für den Konflikt um die bewaffneten palästinensischen Flüchtlinge im Libanon, bei dem die immer weniger werdenden Maroniten, in der Mehrheit pro-westlich eingestellt, mit den Sunniten um die Macht rangen. Da die Sunniten sich eher für den Sozialismus begeisterten, versah man sie mit dem Attribut »progressiv«, auch wenn dies heute eher unangemessen oder veraltet wirkt. Was damals nur wenige Beobachter bemerkten: Die Ölmonarchien der arabischen Halbinsel und des saudischen Wahhabismus waren nach dem Oktoberkrieg 1973 durch den atemberaubenden Anstieg des Erdölpreises unglaublich reich geworden und entwickelten sich nun zu den wichtigsten Akteuren der um sich greifenden Reislamisierung der Region und versuchten, den kosmopolitischen Geist der Levante, wie ich ihn in meiner Jugend kennengelernt hatte, zu ersticken. Und niemand hätte gedacht, dass die Iranische Revolution, die wenig später ausbrach, aus den ehemals eher unbedeutenden, inzwischen aber durch eine konkurrierende islamistische Doktrin radikalisierten Schiiten die wichtigste politische Kraft des Libanon machen würde, die dann über Syrien und den Irak auch Persien erreichte.
Meine Kollegen am Institut Français in Damaskus und ich waren Ende der 1970er-Jahre von der syrischen Kultur fasziniert, in die wir unsere bunt gemischten Wunschvorstellungen hineinfantasierten. Zumeist hatten wir nur wenig gelesen und waren kaum mit den in Vergessenheit geratenen Texten von Orient-Reisenden wie Volney oder Chateaubriand vertraut. Wir waren in der Regel oberflächlich links, mit einer Ideologie ausgestattet, die in den zehn Jahren nach dem Mai 1968 den studentischen Mikrokosmos beherrschte. In dem Jahrzehnt hatte dieses Linkssein jedoch seinen ursprünglichen Dogmatismus verloren, und es blieb nur eine vage Lehrmeinung übrig, eine wirre Vision der Welt, zu der einige wenige feste Überzeugungen wie Antiimperialismus und Antizionismus gehörten. In der Erwartung, dass diese zusammenbrechen würden, applaudierten wir a priori Syrien unter Hafiz al-Assad als Speerspitze des Widerstands gegen Israel und als Vorreiter des arabischen Progressivismus.
Ich habe meine Illusionen recht schnell aufgegeben. Ich liebte die Landschaften Syriens – sie erinnerten mich an die vertraute Umgebung von Nizza, wo ich meine Kindheitsferien verbrachte, und zugleich an die Odyssee, die ich in Vorbereitung auf mein Studium kurz zuvor für einen Griechisch- und Lateinkurs gelesen hatte. Diese romantische Wiederkehr konnte jedoch nur kurz die Brutalität eines Regimes und die Gewalttätigkeit einer Gesellschaft überdecken, wie sie Riad Sattouf sehr anschaulich in den seit 2015 erschienenen Comics Der Araber von morgen beschreibt – und zwar genau so, wie ich es selbst erlebt habe. Im Pariser Quartier Latin war weder die Freiheit meiner Kollegen noch meine eigene je eingeschränkt gewesen, doch in Syrien mussten wir nun lernen, uns in der Öffentlichkeit bedeckt zu halten und anderen Menschen gegenüber misstrauisch zu sein. Wir entdeckten den Alltag in einer »linken« Diktatur und verstanden, dass wir weder von denen sprechen sollten, die in den Kerkern verschwunden waren, noch uns mit ihren Angehörigen zeigen durften. Am Institut Français in Damaskus lernte ich dann den acht Jahre älteren Michel Seurat (geboren 1947) kennen. Der hervorragende Arabist und von Alain Touraine inspirierte Soziologe widmete sich der Analyse des syrischen Regimes. Als er später mit seiner Frau und seinen kleinen Töchtern im Libanon wohnte, musste er seine Forschungsarbeit mit dem Leben bezahlen: Er wurde am 22. Mai 1985 am Flughafen Beirut von der aus Teheran und Damaskus gesteuerten, schwer zu fassenden »Organisation des islamischen Dschihad« entführt und starb 1986 in Gefangenschaft. Seine Mörder schmähten ihn als »spezialisierten Wissenschaftsspion«.
Noch vor diesem traumatischen Ereignis, das mein Leben und meinen Blick entscheidend prägen sollte, war es vor allem die vom Schock der syrischen Realität ausgelöste Desillusionierung, die mich nach meiner Rückkehr nach Paris zu einer Entscheidung trieb: Ich gab das Studium der klassischen Geisteswissenschaften und der von ihnen verfremdeten alten arabischen Kultur auf und widmete mich fortan der Politikwissenschaft, um das Drama, das sich im Nahen und Mittleren Osten abspielte und meine simplen Gewissheiten ins Wanken brachte, zu verstehen. Kaum hatte ich 1978 mein Studium aufgenommen, sah ich mich mit einem weiteren Paradox konfrontiert: dem Ausbruch der »Islamischen Revolution« im Iran. Trotz meiner Zeit in Damaskus verfügte ich nicht über den inneren Abstand, der es mir erlaubt hätte, die »revolutionäre«, schiitische und antiimperialistische Islamisierung in Teheran mit ihrem »reaktionären«, sunnitischen und antisozialistischen Gegenstück in Riad in Verbindung zu bringen. Dabei begann in den 1970er-Jahren jener chaotische Kreislauf, zu dessen Motor zum einen die gewaltigen Einnahmen durch den Ölverkauf und zum Zweiten das Wachstum des politischen Islam wurden – was zur Zerstörung der Levante führte. Das Zusammenspiel dieser beiden Phänomene prägte die vergangenen fünfzig Jahre und damit zwei Generationen von Menschen. Mit der Ausrufung des »Kalifats« durch den sogenannten »Islamischen Staat«, zu Beginn des Ramadan am 29. Juni 2014, erreichte dies im Land des Scham seinen monströsen Höhepunkt. Im selben Jahr sank der Rohölpreis um sagenhafte 70 Prozent, was uns dazu zwingt, die mittel- und langfristigen Perspektiven der Region zu überdenken, also auch ihre politische, wirtschaftliche und soziale Zukunft, darunter auch die Frage nach der Stellung der Religion in der Gesellschaft. Mehrere Gründe hatten zu dem Rückgang des Ölpreises geführt: Durch die gesteigerte Förderung von Schieferöl entwickelten sich die Vereinigten Staaten neben Russland und Saudi-Arabien zu einem der drei größten Ölproduzenten weltweit. Auch das veränderte Konsumverhalten der OECD-Länder, in denen Elektroautos perspektivisch eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, ließ durch sinkende Nachfrage den Ölpreis in den Keller gehen. Da sich beides gleichzeitig abspielt, steht das gesamte Einkommensmodell infrage, das sich in den letzten fünfzig Jahren im Nahen Osten etabliert hat, wie auch der Fortbestand seiner logischen Folge, nämlich des Hegemonialanspruchs des politischen Islam, den sowohl die arabischen Ölmonarchien wie auch ihre iranischen Rivalen auf der anderen Seite des Persischen Golfs propagieren.
Ein scheinbar triviales Ereignis belegt die nie da gewesene Entkopplung des Herrscherhauses der Halbinsel vom salafistischen Establishment, das die Macht der Saudis in den zurückliegenden Jahrzehnten religiös legitimierte, während es sich zugleich dank der Zustimmung der gesamten sunnitischen Welt ausbreiten konnte: Mit seinem Dekret vom 26. September 2017 widersetzte sich der saudische König Salman ibn Abd al-Aziz den Protesten der Ulemas und ihren strengen moralischen Ansprüchen und erlaubte Frauen mit dem Ende des Ramadan 2018 das Autofahren. Siebenundzwanzig Jahre vorher, genauer am 6. November 1990 – rund eine Generation zuvor – waren saudische Frauen, die sich in Riad hinters Steuer gesetzt hatten, noch strafrechtlich verfolgt und angefeindet worden. Kronprinz Mohammed bin Salman sah sich nun mit der Notwendigkeit konfrontiert, den Arbeitsmarkt für den Übergang in das Zeitalter nach dem Öl umzugestalten und Frauen durch einen Zugewinn an Mobilität den Zugang zur Arbeitswelt zu erleichtern. Der mit seinen zweiunddreißig Jahren im Vergleich zum ansonsten von alten Männern dominierten Königshaus noch junge Kronprinz beklagte im November 2017 den extremistischen Überbietungswettbewerb, an dem sich Saudi-Arabien seit 1979 beteiligt habe. Und tatsächlich begann jenes entscheidende Jahr 1979 mit der Rückkehr Chomeinis nach Teheran und endete mit der sowjetischen Invasion in Afghanistan, dem Vorspiel zum dortigen Dschihad. Nun war die Büchse der Pandora geöffnet, und der internationale islamistische Terror hält seitdem unvermindert an. So wurde zugleich die Essenz des saudi-wahhabitischen Systems infrage gestellt, das den Nahen und Mittleren Osten seit dem Sieg der Waffe Erdöl im Oktoberkrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten dominiert hatte. Die anderen Bezeichnungen für diesen Krieg, »Jom-Kippur-Krieg« oder »Ramadan-Krieg«, belegen, wie stark die zukünftige politische Ausrichtung durch religiöse Dogmen geprägt werden würde.
Die folgenden Seiten werden diese chaotischen Jahrzehnte in den Zusammenhang einordnen – und dann versuchen, die sich abzeichnenden Fortentwicklungen zu skizzieren. Schließlich entspricht das vergangene halbe Jahrhundert genau dem Zeitraum meiner eigenen Erfahrungen, die ich persönlich als Zeuge vor Ort, als Beobachter und Chronist gemacht habe, bis ich gar von meinem Forschungsgegenstand aufgesogen wurde, als der sogenannte »Islamische Staat« mich zum Tode verurteilte. Diese jüngere Vergangenheit soll auf persönliche Art und Weise interpretiert werden, wobei ich die Fakten strukturiere und neben mir erhellend erscheinenden Einzelereignissen auch Entwicklungen aufzeige, die auf »lange Sicht« wirksam wurden.
Im ersten Teil des Buches werden die vier Jahrzehnte zwischen dem Oktoberkrieg 1973 und den als »Arabischer Frühling« bekannten Aufständen, die in Wahrheit im Winter 2010/2011 begannen, chronologisch dargestellt. Hier wird die Rede sein von der zunehmenden Islamisierung der Politik und der Gewaltspirale des Dschihad, der nach und nach den ganzen Planeten eroberte – angefangen im Jahr 1979, als man auf die Iranische Revolution mit einem von den USA unterstützten Krieg in Afghanistan antwortete, der zehn Jahre später in den Zerfall der Sowjetunion mündete. Ferner werden die drei Phasen des Dschihadismus erläutert, zu denen auch der 11. September 2001 gehört, an dem die Vereinigten Staaten völlig überraschend und dramatisch wie von einem Bumerang getroffen wurden. Dem beginnenden christlichen Jahrtausend sollte damit auf spektakuläre Art und Weise ein islamistisches Gewand übergestülpt werden. Diese Rückschau baut auf einem halben Dutzend meiner Veröffentlichungen zum Thema auf, angefangen von Der Prophet und der Pharao (1985) bis Terreur et martyre (2008), von denen ich nur jenes Material aufgegriffen und eingebaut habe, das mir für die Interpretation der entscheidenden, während der 2010er-Jahre plötzlich aufgetretenen Phänomene aussagekräftig erschien.
Dieses paradoxe Jahrzehnt steht im Mittelpunkt des zweiten Teils. Es begann hoffnungsvoll mit dem Arabischen Frühling 2011, fand seine Fortsetzung dann aber in der Verkündung des sogenannten »Islamischen Staats« durch Daesh und die Verbreitung des islamistischen Terrors bis nach Europa. Es endete schließlich mit dem Sturz des »Kalifats« im Herbst 2017, als nach Mossul auch Raqqa zurückerobert wurde. Ich habe auf beiden Seiten des Mittelmeers an der Analyse dieser Widersprüchlichkeiten gearbeitet: wie die Demokratiebewegungen trotz aller in sie gesetzten Hoffnung zum einen in das unvorstellbare Grauen des IS münden konnten und zum anderen in autoritären Regimen, Schurkenstaaten sowie recht- und gesetzlose Gebieten. Aufbauend auf Fragestellungen, die ich in Passion arabe (2013) und Terror in Frankreich (2015) entworfen habe, wird es um die Situation der sechs Länder gehen, die eine »arabische Revolution« durchlebten – also Tunesien, Ägypten, Libyen, Bahrain, Jemen und Syrien. Diesen schließen sich Überlegungen zum Irak an, denn im irakisch-syrischen Grenzgebiet erwachte das Monster IS zum Leben. Da der sogenannte »Islamische Staat« glücklicherweise Ende 2017 gestürzt wurde, können wir heute mit ausreichend Abstand die Gesamtheit der Ereignisse jener tragischen Zeit betrachten. Ich habe mich bemüht, aus der Menge an Tatsachen, von denen im Folgenden die Rede sein muss – etwa weil sie uns im wahrsten Sinne des Wortes gewaltsam aufgezwungen wurden –, ein großes Tableau zu entwerfen und aus diesem dann Lehren zu ziehen, indem ich die aktuellen Ereignisse in das Langzeitgedächtnis der vorangegangenen Jahrzehnte eingeschrieben habe. Die Levante und vor allem Syrien, denen der größte Teil dieses Buchs gewidmet sind, bilden das Herzstück der Untersuchung, da in meinen Augen sich in dieser Region die Krisen, die den Nahen und Mittleren Osten sowie die muslimischen Länder Nordafrikas erschüttern, verdichteten und hier ihren Höhepunkt erreichten.
Im letzten Teil schlage ich eine Interpretation jener Ereignisse vor, die sich seit dem Winter 2017/2018 ereignet haben, also seit jener Phase, die mit dem Sturz des IS und der absehbaren Niederlage des syrischen Aufstands eingeleitet wurde. So soll das Ausmaß der tektonischen Verschiebungen erkennbar werden, deren erste Anzeichen bereits heute sichtbar sind. Dieses Material, zum Großteil bei Reisen durch Nordafrika sowie den Nahen und Mittleren Osten gesammelt, erlaubt uns, Hypothesen für die Szenarien genau zu überprüfen, die beide Seiten des Mittelmeerraums betreffen – zum Guten oder zum Schlechten. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Dschihad und dem Salafismus, aus dem Auseinanderbrechen des »sunnitischen Blocks« und den derzeitigen Umwälzungen auf der arabischen Halbinsel? Wird sich der Iran die Hegemonie in einer Region des »schiitischen Halbmonds« sichern oder macht die Auseinandersetzung mit Trumps Amerika diesen Erfolg zu einem Pyrrhussieg? Kann das nach seinem Einsatz in Syrien wieder zu einer Großmacht gewordene Russland unter Wladimir Putin zwischen seinen so widersprüchlichen Verbündeten wie Israel, Saudi-Arabien, der Türkei und dem Iran vermitteln? Und gelingt es Europa, das sich vor allem durch seine von Terroristen wie Flüchtlingen angesteuerte Mittelmeerküste plötzlich wieder in einer Krisenzone befindet, seine Passivität zu überwinden und sich erneut als geopolitischer Protagonist zu positionieren? Derzeit sieht Europa, von der Blockade seiner Institutionen gehemmt, den Zentrifugalkräften einer extremen Rechten wie eines linken, von Islamismus durchsetzten Populismus ohnmächtig zu.
Das Desinteresse der amerikanischen Supermacht, immerhin größter Öl- und Schiefergasproduzent, an der Region begann unter Präsident Obama und wird auf spektakuläre Art und Weise von dessen Nachfolger Donald Trump fortgesetzt. Damit ist Europa gezwungen, seiner Verantwortung voll und ganz gerecht zu werden. Unter diesen Voraussetzungen ist die Wiederbelebung der Levante ein entscheidender Punkt. Die Region wurde ihrer Lebensgrundlage beraubt, als der unternehmungsfreudigste Teil der Bevölkerung an die Küsten des Persischen Golfs abwanderte. Sie dürfte jedoch nach all den erschöpfenden Schlachten zwischen den Feinden auf ihrem Gebiet vom strukturellen Niedergang des Ölpreises besonders getroffen werden. Die Stärkung der Levante als Gelenk zwischen Europa und dem Nahen und Mittleren Osten und der Zusammenhalt der beiden Regionen sind daher das Mittel der Wahl, um einen kulturellen Zusammenstoß zu vermeiden, der ansonsten die Krisen der letzten Jahrzehnte verstetigen würde. Indem es sich bemüht, einen Entwurf für dieses notwendige Vorhaben zu entwickeln, möchte mein Buch einen kleinen Beitrag zum Aufbau unserer Zukunft liefern – über das Chaos hinaus.
ERSTER TEIL
DAS BARREL UND DER KORAN
1
DIE ISLAMISIERUNG DER POLITISCHEN ORDNUNG(1973–1979)
Der Niedergang des arabischen Nationalismus
Wenn wir in diesem Buch den Oktoberkrieg 1973 als Ausgangspunkt des Chaos im Nahen Osten verstehen, das sich ab dem 11. September 2001 über die ganze Welt ausbreitete und im sogenannten »Islamischen Staat« von 2014 bis 2017 gipfelte, dann vor allem, um auf den bedeutsamen kulturellen Bruch mit der damaligen politischen Elite zu verweisen, die im Zuge der Entkolonialisierung die Macht an sich gerissen hatte. Ihre bekanntesten Führer (etwa Nasser und Bourguiba) und ihre symbolträchtigsten Parteien (die Baath-Partei in Syrien und im Irak sowie die PLO in Palästina) hatten sich bei der Machtübernahme über die traditionelle islamische Legitimation, mit der muslimische Dynastien seit der Verkündigung des Propheten ihre Autorität begründeten, sowie über die soziale Ordnung hinweggesetzt, die sich in Medina und Mekka seit Beginn der islamischen Zeitrechnung (622 n. Chr.) herausgebildet hatte.
Noch bis in die 1960er-Jahre hinein trugen sowohl die Baath-Partei als auch die tunesische Neo-Destur-Partei einen Laizismus zur Schau, der dem Atatürks bei der Gründung der türkischen Republik nach dem Untergang des Osmanischen Reichs in nichts nachstand oder auch vergleichbar war mit dem Laizismus am Hof des iranischen Schahs Reza Pahlavi. Nasser besuchte zwar freitags regelmäßig die Moschee, um seine Nähe zur Volksfrömmigkeit der Ägypter zu demonstrieren, instrumentalisierte aber die traditionsreiche islamische al-Azhar-Universität als Propagandainstrument für seine auf die Dritte Welt bezogene Politik und äußerte sich immer wieder abfällig über die Geistlichkeit. Zudem war er gnadenlos gegen die Muslimbruderschaft vorgegangen, die Mutter des politischen Islam im Ägypten des 20. Jahrhunderts. Der Lehrer Hasan al-Banna hatte die Bruderschaft 1928 in Ismailia gegründet. Diese ägyptische Stadt war für al-Banna zum Symbol für die Fremdherrschaft der europäischen Kolonialmächte geworden, da hier das Verwaltungszentrum der internationalen Sues-Gesellschaft lag. Die Muslimbruderschaft wollte die Fackel des von Atatürk 1924 abgeschafften osmanischen Kalifats weitertragen und hatte die Machtergreifung Nassers und seiner »freien Offiziere« 1952 zunächst begrüßt: Sie sah in ihnen ihren weltlichen Arm, mit dem sie einen auf der Scharia basierenden Staat gründen könne – mit einem Rechtssystem also, das von den heiligen Schriften inspiriert war. Nachdem aus den einstigen Partnern Feinde geworden waren, wurde die Organisation 1954 zerschlagen. Mehrere führende Mitglieder der Muslimbruderschaft wurden gehängt, anderen gelang die Flucht auf die arabische Halbinsel, wo sie ihren Bekehrungseifer entfalteten, und noch andere wurden in straff geführten Internierungslagern gefangen gehalten, in denen Folter zum Alltag gehörte. Zu den Verhafteten zählte auch der spätere Chefideologe des modernen Dschihadismus, der Aktivist und Literat Sayyid Qutb.
Die orientalische Säkularisation täuschte einen demokratischen Laizismus wie in Europa jedoch nur vor. Zunächst deshalb, da es keine echte Trennung zwischen der politischen und religiösen Sphäre gab, sondern der politische Machtapparat sich die geschwächten islamischen Institutionen unterwarf, um damit soziale Kontrolle auszuüben oder um zu beweisen, dass der Islam und die nationalistische, ja sogar offiziell sozialistische Doktrin durchaus miteinander vereinbar waren. Und schließlich und vor allem deshalb, da die Eliten den Unabhängigkeitsprozess – auf welchem Wege auch immer – für sich vereinnahmt und sich gewaltsam an die Staatsspitze gesetzt hatten. Entgegen des demokratischen Versprechens, das als Antwort auf das Freiheitsverlangen der ehemaligen Kolonien gegeben wurde, hatte man doch nur die Köpfe ausgetauscht, und die Menschen gerieten unter die Knute von militärischen oder dynastischen Seilschaften und deren Anhängern. Nur dadurch, dass die Unterdrückung nun nicht mehr von europäischen, sondern von inländischen Herrschern ausging, wurde sie nicht erträglicher. Im Gegenteil.
Die außerordentlich schlechten wirtschaftlichen Leistungen und sozialen Maßnahmen der neuen Eliten taten ihr Übriges, auch die Rechtsstaatlichkeit des neuen Justizwesens existierte nur im verlogenen Diskurs der Despoten. In den arabischen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens, und hier vor allem in den »Frontstaaten« in Israels Nachbarschaft, wurde diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit mit Erfordernissen im notwendigen Kampf mit dem zionistischen Feind begründet. Der Antizionismus etablierte sich damit als dritte Stufe eines Nationalismus, der sich zunächst im 19. Jahrhundert gegen die osmanische Vorherrschaft und im 20. Jahrhundert gegen die europäische Bevormundung gerichtet hatte. Dieser Nationalismus stilisierte die jüdische Gemeinschaft im Zentrum der Levante und auf palästinensischem Boden zur letzten Bastion des verabscheuten Kolonialismus. Die arabische politische Rhetorik drehte sich unablässig um die Vertreibung der Juden.
Nach der demütigenden nakba (»Katastrophe«), dem Sieg über die arabischen Armeen 1948 und der anschließenden Staatsgründung Israels durch Ben Gurion am 15. Mai, verstärkte 1956 die Sueskrise diesen Nationalismus erneut: Die vereinten englischen, französischen und israelischen Streitkräfte wurden durch amerikanischen und sowjetischen Druck gezwungen, sich vom Kanal zurückzuziehen, den Gamal Abdel Nasser verstaatlicht hatte. Kairo band sich anschließend enger an die UdSSR und begann mit der Umsetzung eines Sozialismus nach sowjetischem Vorbild. Der Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 bildete hingegen die »Niederlage« (naksa) des arabischen Nationalismus schlechthin. Zu dieser trug insbesondere die erfolgreiche Luftoffensive Israels bei: Der ägyptische Rais hatte zwar die Sperrung der Wasserstraße von Tiran am Golf von Akaba angeordnet, mit der die Belieferung des Hafens von Eilat unterbunden werden sollte. Doch die Armee des jüdischen Staates reagierte sehr schnell und konnte schließlich die Sinaihalbinsel, den Gazastreifen, das Westjordanland inklusive Ost-Jerusalem sowie die Golanhöhen erobern. Neben Gebietsverlusten hatte dieser Blitzkrieg vor allem das endgültige moralische Scheitern der arabischen Führer zur Folge, die aus den Unabhängigkeitsbewegungen hervorgegangen waren. Ihre Rhetorik sackte mit einem Mal in sich zusammen wie ein Luftballon, der angesichts der militärischen Realitäten die Luft verlor.
Für Ägypten bedeutete die naksa den finalen Todesstoß in einer ganzen Reihe innerer und äußerer Rückschläge. Schon seit 1962 kämpfte die ägyptische Armee im Jemen an der Seite der republikanischen Kräfte gegen die von Saudi-Arabien unterstützten Royalisten, was sich zu einem teuren Einsatz mit sehr hohem Blutzoll auswuchs. Um aufkommenden Unmut im Keim zu ersticken, ließ Nasser 1966 Sayyid Qutb hinrichten, den Chefideologen der Muslimbruderschaft. Dieser hatte soeben Zeichen auf dem Weg veröffentlicht, ein Was tun? der radikal islamischen Bewegung. In dem Werk, das für nachfolgende Generationen von Dschihadisten zum Gründungstext werden sollte, erhob der Autor das Gefängnis, in dem die Kämpfer der Bewegung gefoltert wurden, zum Symbol des verabscheuten arabischen Nationalismus. Ihn beschreibt er als Dschahiliya – als Ära des »Unwissens« oder der Barbarei, wie die Schrift die Zeit vor der Offenbarung des Koran durch den Propheten bezeichnet. Mohammed hatte diese mit der Durchsetzung des Islam beendet. Qutb rief in seinem Buch entsprechend dazu auf, die »Dschahiliya des 20. Jahrhunderts« gewaltsam zu beenden, für die der Nasserismus das Paradebeispiel sei, indem man alle Möglichkeiten dazu ausschöpfe, unter anderem die »Bewegung« (haraka), also den bewaffneten Dschihad. Indem er die Machthaber exkommunizierte und »zu Ungläubigen erklärte« (takfir), beruft sich Qutb in Zeichen auf dem Weg auf die religiöse Legitimierung, um Gewalt gegen den Staat zu rechtfertigen. Aus dieser Kampfansage – die nicht bei allen Muslimbrüdern auf Zustimmung stieß – sollte die »radikale« Strömung innerhalb der Muslimbruderschaft hervorgehen, die in der Folge eine gewaltige Entwicklung durchlief, von den Gotteskriegern Afghanistans bis zu al-Qaida. Diesen Wechsel der Stoßrichtung bezahlte Qutb 1966 mit seinem Leben – ein Jahr vor der militärischen Niederlage von 1967. Viele von Qutbs Anhängern zeigten sich überzeugt, dass die Niederlage Allahs Strafe für Nasser war, da er den Märtyrer hatte foltern lassen.
Der Rais gab nach diesem Misserfolg 1967 sein Amt auf, kehrte aber nur kurz darauf an die Macht zurück, nachdem in ganz Ägypten Menschen unter dem Ruf »Nasser, komm zurück!« auf die Straße gegangen waren. Er starb drei Jahre später und mit ihm das panarabistische Ideal, das er verkörpert hatte. In dieses Vakuum drängte nun der politische Islamismus: Im Oktober 1973 fand er einen gewaltigen Hebel, um es auszufüllen.
Ägypten war der größte Verlierer des Sechs-Tage-Kriegs. Mit dieser Niederlage ging auch der Nasserismus unter, an dessen Stelle für einige Zeit die Bemühungen um die Sache der Palästinenser traten, die sich von den arabischen Staaten emanzipieren wollten. 1969 löste sich der neue Führer der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Jassir Arafat, aus der Bevormundung durch Kairo und wählte Jordanien, wo zahlreiche palästinensische Flüchtlinge lebten, zu seiner Basis, um von dort aus seinen Kampf gegen Israel zu führen. Indem die palästinensischen Organisationen mit ihrer Präsenz die Autorität von König Hussein infrage stellten, heizten sie die bestehenden Spannungen zwischen Palästinensern und Jordaniern noch weiter an. Diese erreichten einen Höhepunkt, als am 6. September 1970 drei Linienflugzeuge entführt und zur Landung auf dem jordanischen Flughafen Zarqa gezwungen wurden. Hinter der Tat steckte die marxistische Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) unter Führung von George Habasch. Bei der Niederschlagung der daraus resultierenden Unruhen in Jordanien kamen Tausende Palästinenser ums Leben. Die Vereinbarung von Kairo, die drei Wochen später zwischen Arafat, König Hussein und Nasser getroffen wurde – kurz bevor Nasser verstarb –, sorgte dafür, dass die bewaffneten palästinensischen Gruppen Jordanien verließen. Sie siedelten sich nun in den Flüchtlingslagern im Libanon an, dem fragilsten Staat der Region. An dessen fünf Jahre später beginnenden Auflösung sollten sie maßgeblich beteiligt sein, wie auch an der nachfolgenden fortschreitenden Zerstörung der Levante insgesamt. Und zwar in einem Kontext, der sich durch die Islamisierung der Politik gänzlich geändert hatte und der die neue saudische Hegemonie ankurbelte, die sich aus dem Konflikt im Oktober 1973 ergab.
Der Ramadan-Krieg im Oktober 1973: Das Öl als Waffe und der Protodschihad
Anwar as-Sadat, der Nasser noch im September 1970 nachfolgte, war der Kompromisskandidat, auf den sich der zerstrittene ägyptische Generalstab einigen konnte. Er begann sein Amt als Staatspräsident unter schwierigen Bedingungen: Das Volk stellte ihn mit nukat (Witzen) als dumm dar. Der auf Sadat lastende Druck war umso größer, als er kaum die Mittel hatte, die Schmach der Niederlage vom Juni 1967 durch eine Offensive wettzumachen. Aus einem Dorf im Nildelta stammend, war Sadat jedoch schlau genug zu wissen, wie er über all jene zu regieren hatte, die ihn unterschätzten – nur die Dschihadisten zu beherrschen gelang ihm nicht, und sie waren es dann auch, die ihn schließlich ermorden sollten. Da Sadat in seiner Jugend den Muslimbrüdern nahegestanden hatte, entließ er ihre Anhänger nun aus den Gefängnissen und unterstützte heimlich ihren Bekehrungseifer an den Universitäten, wo Marxisten und linke Nasser-Anhänger zu seinen gefährlichsten Gegnern gehörten. In wenigen Jahren gelang es ihm, diese aus dem Weg zu räumen, woraufhin die al-Dschamaa al-islamiyya (Islamische Vereinigung) in der Nachfolge von Qutb die Kontrolle über die studentische Bewegung gewann.
Sadats sowjetische Militärberater, seine Verbindungsleute zum syrischen Präsidenten Hafiz al-Assad, der wie er nach der Niederlage von 1967 an die Macht gekommen war, halfen ihm bei der Vorbereitung des Angriffs auf israelische Stellungen. Er erfolgte am 6. Oktober 1973, da das jüdische Jom-Kippur-Fest an diesem Fasten- und Ruhetag den Staat Israel verwundbarer machte. Ägyptische Soldaten durchbrachen die befestigte Bar-Lev-Linie am Sueskanal, während Syrien auf die seit 1967 von Israel besetzten Golanhöhen vorrückte. Dieser Anfangserfolg brachte den beiden Staatslenkern Ehrennamen ein, »Held der Überquerung« (batal al ubur) für Sadat und »Oktoberlöwe« (assad tichrine) für Assad, dessen Familienname auf Arabisch »Löwe« bedeutet. Allerdings hätte der Krieg, der die Ehre der arabischen Führer rettete, ohne die entscheidende Intervention Saudi-Arabiens und der Ölmonarchien der arabischen Halbinsel ein anderes Ende gefunden. Denn sie trugen dazu bei, die Situation nach der erfolgreichen Gegenoffensive der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (Zahal) zu stabilisieren: Die israelische Armee hatte den Sueskanal wieder überschritten, die dritte ägyptische Armee eingekesselt und war bis zum Kilometer 101 auf der Straße zwischen Sues und Kairo vorgerückt. In Syrien stand sie derweil schon 40 Kilometer vor Damaskus. Ermöglicht worden war dieser Vormarsch durch eine Luftbrücke der US-Amerikaner, die den jüdischen Staat täglich mit Versorgungsgütern belieferten. Am 16. und 17. Oktober 1973 beschlossen die in Kuwait versammelten arabischen Erdölförderländer eine unilaterale Erhöhung der Rohölpreise um 70 Prozent und eine monatliche Senkung der Ausfuhren um fünf Prozent, die so lange gelten sollten, bis die besetzten Gebiete wieder geräumt und die Rechte der Palästinenser anerkannt würden. Am 20. Oktober verkündete der saudische König Faisal ein Lieferembargo für die Vereinigten Staaten und die Niederlande, die »Israel unterstützen«.
Damit war die entscheidende Waffe gefunden – sie wahrte den arabischen Kriegsführern auf dem Schlachtfeld das Gesicht und sorgte über diese politisch-militärische Episode hinaus für eine Erschütterung der Weltordnung. Die Ölrente bestimmte fortan maßgeblich die Kräfteverhältnisse auf dem Globus und verlieh jenen, die über Erdöl verfügten, eine exorbitante Macht. Der Ölpreis kletterte binnen weniger Tage um das Vierfache. Der ökonomische Druck, der aus dem israelisch-arabischen Konflikt für alle Erdöl importierenden Länder eine innenpolitische Angelegenheit machte, hatte unmittelbar zur Folge, dass die erfolgreiche Gegenoffensive für Israel enttäuschend endete: Sadat und Assad waren von Faisal und dem Erdöl-Emiren gerettet worden, und Tel Aviv musste unter dem Druck der Vereinigten Staaten und des Westens dem Waffenstillstand zustimmen, denn deren Wirtschaftsbilanzen waren wegen des Ölpreisanstiegs durcheinandergebracht worden. Von nun an würden die Ölmonarchien ihre Dominanz durch den Einsatz ihres märchenhaften Reichtums festigen und konnten dank der hohen Ölpreise überall in der sunnitischen Welt ihre strenge und konservative Ideologie verbreiten. Sie sollten sich allerdings schwer damit tun, den Geist des Dschihad zurück in die Flasche zu bekommen, nachdem er einmal freigelassen worden war – und eines Tages fielen sie ihm schließlich selbst zum Opfer.
Ein Großteil der populären arabischen Literatur vergleicht die Niederlage von 1967 mit dem »Sieg« von 1973, indem sie die Niederlage auf die Gottlosigkeit des Nasser-Regimes und den Sieg auf die klar bekundete Frömmigkeit der arabischen Kriegsparteien zurückführt, schließlich wurde der Krieg im Ramadan und mit der rechtmäßigen Dimension eines Dschihad geführt. Tatsächlich muss während des heiligen Monats Ramadan von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet werden – ein Umstand, der sich nur schlecht mit militärischen Operationen verträgt. Dieses Fastengebot darf jedoch im Falle eines Dschihad aufgehoben werden, denn sollte die Gemeinschaft der Gläubigen zu schwach sein für den Kampf, droht sie im Angesicht des Feindes unterzugehen, was den Fortbestand des Islam insgesamt infrage stellen würde. Auf Druck der Machthaber hin hatten folglich die ägyptischen und syrischen Ulemas, islamische Rechtsgelehrte, den Ramadan-Krieg zum Dschihad erklärt, sodass die Soldaten ihre Rationen zu sich nehmen konnten. Jenseits der Instrumentalisierung dieser Fatwa wurde diese Konfrontation im Zuge der weltweiten Bewegung ipso facto wirksam, da schlussendlich die Ölmonarchien siegten, die für ihre religiöse Strenge bekannt waren. Weitere, aufschlussreiche Kommentare mit ähnlicher Stoßrichtung vergleichen den Schlachtruf Allahu akbar, der die siegreichen Truppen 1973 zum Sieg führte, mit dem »Zu Land! In der Luft! Zu Wasser!«, den die »gottlose« Regierung 1967 ausgegeben und der sie in die unvermeidliche Niederlage geführt hatte.
Der Einsatz der Waffe Öl im Oktober 1973 erfolgte zudem vor dem Hintergrund einer sich verschlechternden Beziehung zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten. Formell hatten die Beziehungen beider Staaten durch die Einigung zwischen Franklin D. Roosevelt und König ibn Saud am 14. Februar 1945 an Bord des Kreuzers USS Quincy begonnen, der in den Bitterseen des Sueskanals vor Anker gegangen war. Direkt aus Jalta angereist, wollte Roosevelt angesichts einer konfliktreichen »Aufteilung der Welt« mit der feindlichen Sowjetunion, die mit reichen Erdölvorkommen in Aserbaidschan und Sibirien gesegnet war, die Versorgung des Westens mit Erdöl sichern und trat damit die Nachfolge des im Zweiten Weltkrieg ausgebluteten Großbritannien an. Im Gegenzug für die Nutzung der Ölfelder durch die amerikanische ARAMCO (Arabian American Oil Company) sicherte Roosevelt der saudischen Monarchie den Schutz der Vereinigten Staaten zu. Diese Verabredung wurde am Valentinstag geschlossen – ein für ewige Versprechen sehr günstiges Datum – und bildete den wichtigsten Grund für die amerikanische Präsenz im Nahen Osten. Der Bund mit Saudi-Arabien hatte damit auch Vorrang vor den Beziehungen zu Israel, das bis zum Krieg 1967 vor allem von Frankreich ausgerüstet wurde (die Mirage-Flieger der Firma Dassault galten als entscheidend für den damaligen israelischen Sieg). Während der Sueskrise 1956 hatten die Vereinigten Staaten den Abzug der israelischen Truppen aus dem Sinai wie auch den Rückzug der anglo-französischen Fallschirmjäger verlangt und damit deutlich gemacht, dass in ihren Augen die israelischen Interessen keine Priorität besaßen. Dies änderte sich erst nach der berühmt gewordenen Pressekonferenz vom 27. November 1967, bei der de Gaulle die Besetzung der im Sechs-Tage-Krieg eroberten Gebiete kritisiert und die Belieferung Tel Avivs mit Waffen eingestellt hatte. Daraufhin sprang Washington ein: Erst jetzt setzten sich die Vereinigten Staaten über die Quincy-Vereinbarung hinweg, übernahmen die militärische Unterstützung Israels und räumten dem Schutz Israels Vorrang vor dem Öl-Deal ein. Die saudische Seite fühlte sich auch deshalb frei genug, im Gegenzug im Oktober 1973 der Quincy-Vereinbarung einen Schlag versetzen zu können, da die Preiserhöhung beim Rohöl auf mittlere Sicht den texanischen Ölförderfirmen in die Hände spielte, darunter auch der Zapata Petroleum Company, die 1953 vom späteren US-Präsidenten George H. W. Bush gegründet worden war. So hoffte sie, weiterhin fruchtbare Beziehungen zu den Vereinigten Staaten pflegen zu können. In jedem Fall gaben die veränderten Kräfteverhältnisse den Erdöl produzierenden Ländern die Gelegenheit, die ausländischen Ölfirmen im eigenen Land zu verstaatlichen. Damit sicherten sie sich deren Einkünfte, anstatt sich mit den Förderabgaben begnügen zu müssen, die sie bis dahin von den sieben »Majors« (auch Seven Sisters genannt) erhalten hatten. Die Ölmonarchien mehrten ihren Reichtum zusätzlich und vergrößerten ihre Einflussmöglichkeiten, den Nahen und Mittleren Osten umzugestalten und die Reislamisierung der regionalen politischen Ordnung voranzutreiben.
Die schrittweise Islamisierung der Gesellschaften
Durch die weltweite Verbreitung der wahhabitischen und konservativen sunnitischen Glaubensrichtung trat die saudische Außenpolitik jenen Missionaren der al-Azhar-Universität Kairo entgegen, die Nasser in alle Winkel der Erde ausgesandt hatte, um die Vereinbarkeit von Islam und Sozialismus zu verkünden – ein Nebenprodukt des Kalten Kriegs, in dessen Verlauf sich jede Seite bemühte, den Islam für eigene Zwecke einzuspannen. Kronprinz Faisal gründete dazu am 15. Dezember 1962 in Mekka die Islamische Weltliga, just in dem Moment, in dem die von der Sowjetunion trainierten ägyptischen Truppen im Jemen eintrafen und die Grenze zu Saudi-Arabien bedrohten. Bis 1973 spielte die Islamische Weltliga im großen ideologischen Kampf zwischen Moskau und Washington und ihren jeweiligen Verbündeten jedoch nur eine untergeordnete Rolle, als in der Auseinandersetzung ein sprachliches Register gezogen wurde, das der Religion nur einen nachrangigen Platz zuwies. Nach dem Untergang des Nasserismus erhielt die Islamische Weltliga dank des gestiegenen Ölpreises bedeutende Geldmittel zu ihrer Verfügung, um den saudischen Einfluss weltweit zu verbreiten. Saudi-Arabien wurde, regional wie international, zum Herz des neuen, islamischen Raums, der auf der arabischen Halbinsel sein Zentrum hatte. Fortan kam es darauf an, die entstehende Hegemonie zu festigen und durch ein karitatives und zielgerichtetes Mäzenatentum die Rechtfertigung dafür zu schaffen, dass die Ölrente von den radikalsten Sunniten als Lohn für ihren strengen Glaubenseifer vereinnahmt wurde. Die Liga ließ sich jedoch nicht in die internen Streitigkeiten hineinziehen, die ihren Glanz beschädigt hätten: Sie beschränkte sich auf das Ziel, gegen die »Neuerungen« zu kämpfen, die die »reine und authentische Botschaft des ursprünglichen Islam« entstellten – was vor allem auf den mystischen Sufismus abzielte –, und überließ den Muslimbrüdern ihren Platz. Damals galten diese als Verbündete im globalen Bemühen um die Islamisierung der Gesellschaften und als Akteure, welche die zu bekehrende moderne Welt besser kannten als die etablierten saudischen Ulemas.
In der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre, als viele Muslime in Europa, vor allem Gastarbeiter, massiv von der Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit betroffen waren, zu denen die Vervierfachung des Ölpreises maßgeblich beigetragen hatte, eröffnete die Liga erste Büros und Moscheen auf dem alten Kontinent. Ziel war es, die entstehende Islamisierungsbewegung in diesen von einer Identitätskrise erschütterten Milieus zu flankieren, also bei Millionen von eher zufällig sesshaft gewordenen Individuen, die sich dafür entschieden hatten, in ihren Aufnahmeländern zu bleiben, auch wenn dort die unqualifizierten Arbeitsplätze immer weniger wurden.
Ägypten war zwar durch seine enormen Militärausgaben und das demografische Gewicht gehemmt, blieb aber dennoch weiterhin ein potenzieller Gegenpol zur Ausbreitung des Wahhabismus, vor allem dank der langen glanzvollen Geschichte der al-Azhar-Universität, in der die von den Salafisten verabscheute Sufi-Bruderschaft stark vertreten war. So blieb Ägypten ebenfalls im Visier der Liga. Ägypten musste stabil, aber auch in ständiger Abhängigkeit gehalten werden, damit es nie auf die Idee käme, sich der neuen saudischen Führungsrolle entgegenzustemmen. Bevor Sadat wegen seiner Reise nach Jerusalem und seiner Rede vor der Knesset am 20. November 1977 von der arabischen Welt mit einem Bann belegt wurde, hatte er selbst das Spiel der Islamisierung gespielt. Er trug die berühmte zabiba (»Rosine«), wie man in Ägypten den Gebetsfleck auf der Stirn eines Gläubigen nennt, der sich fünf Mal am Tag zum Gebet auf den Boden niederwirft. Auch ergänzte er seinen offiziellen Titel um den vormals nicht verwendeten Vornamen Mohamed und verfügte, dieser müsse vor dem offiziellen Titel des »gläubigen Präsidenten« (al rais al moumin) genannt werden. In Ägypten entstanden zahlreiche neue Moscheen, riesige, neongrün gestrichene Bauten, deren aufgedrehte Lautsprecher die städtische Kakofonie übertönten. Auf sämtlichen Flügen von Egypt Air wurde Alkohol verboten, und bald investierten die unter Nasser an den Golf emigrierten Muslimbrüder ihre Petrodollar wieder in islamische Banken, die schariakonforme Geschäfte betrieben. Das Jahrzehnt von Sadats Präsidentschaft veränderte auch das Erscheinungsbild der Menschen im Land, denn immer mehr Ägypterinnen trugen nun einen Schleier.
All diese Maßnahmen hatten prophylaktische Funktion: Das mit antizionistischer Propaganda übersättigte Volk sollte die Kehrtwende akzeptieren, die 1979 mit dem ägyptisch-israelischen Friedensvertrag eingeleitet wurde. Sie konnten freilich nicht verhindern, dass sich die islamistische Protestbewegung radikalisierte, im Gegenteil. Diese fand einen fruchtbaren Boden vor, in dem sie tiefe Wurzeln schlagen konnte. Und sie sollte dem »gläubigen Präsidenten« zum Verhängnis werden: Am 6. Oktober 1981 wurde Sadat während einer Militärparade zu Ehren der »Helden der Überquerung« des Sueskanals von der »Organisation al-Dschihad« ermordet. Dass dem unbeliebten ägyptischen Pharao in seinem Heimatland kaum jemand eine Träne nachweinte, habe ich in Kairo, meinem damaligen Wohnort, selbst miterleben können. Unter den für den ägyptischen Humor so typischen zynischen Witzen gehörte die Geschichte eines Straßenfegers zu den bekanntesten. Dieser säubert am Tag nach dem Attentat auf Sadat den Boden vor der Ehrentribüne und findet eine Art Rosine auf dem Boden: »Was ist denn das? Ach so, ja, die zabiba des Präsidenten!« Der Gebetsfleck auf der Mitte der Stirn, mit dem Sadat seine Frömmigkeit zur Schau stellte, war also nur aufgeklebt.
Ein weiterer Meilenstein in der schrittweisen Islamisierung des Nahen und Mittleren Ostens war der libanesische Bürgerkrieg, der das Repertoire der politischen Mobilisierung in religiöse Kategorien überführte. Die politische Mobilisierung war bis dahin vom Nationalismus bestimmt gewesen, angestachelt von der zentralen Bedeutung des »palästinensischen Widerstands« gegen den »zionistischen Feind«, und hatte sich in die globale Auseinandersetzung zwischen dem sowjetischen und dem US-amerikanischen Block eingefügt. Die palästinensische Militärpräsenz im Libanon war durch eine am 3. November 1969 in Kairo unterschriebene, geheime Vereinbarung zwischen dem Chef der libanesischen Armee und Jassir Arafat zustande gekommen. Mit ihr wurde im Süden des Landes, an der Grenze zu Israel, eine Art Staat im Staate geschaffen, dem sich nach den Massakern des »Schwarzen Septembers« 1970 immer mehr Kämpfer aus Jordanien anschlossen, die mit Unterstützung der arabischen Staaten schrittweise in den Libanon umgesiedelt wurden. Für die arabischen Staaten ging es darum, gegenüber ihrer Bevölkerung eine gesichtswahrende Lösung zu finden, indem sie nahe der »zionistischen Einheit« ein Zentrum errichteten, von wo aus sie den nötigen Druck eines Guerillakampfes mittlerer Intensität aufrechterhalten konnten. Die Vorstellungswelt des Widerstands hatte damit ihren Zenit erreicht, verstärkt noch durch das jämmerliche Bild, das die arabischen Armeen während des Sechs-Tage-Kriegs geboten hatten. Die linken Zeitungen im Quartier Latin, wo ich Schüler gewesen war, lieferten in diesen Tagen Überschriften wie »Der palästinensische Widerstand wird den Vertrag von Kairo hinwegfegen« oder »Der Weg nach Jerusalem geht über Amman, Beirut und Kairo«. Im weltweiten Kampf für die Durchsetzung des Sozialismus wurde hier die »zionistische Einheit« mit der »arabischen Bourgeoisie« gleichgesetzt.
Die grandiosen Projekte eines marxistischen Messianismus führten nirgendwohin; im Gegenteil, das zerbrechliche konfessionelle Gleichgewicht des Libanon wurde durch den Aufbau einer bewaffneten Bewegung durcheinandergebracht. Die nach ihrer nationalen Identität ganz und gar palästinensische Bewegung war eine muslimische und sunnitische Kraft – also weder christlich noch schiitisch. Im Mosaik des Zedernstaats wurde der Bevölkerungsanteil der Maroniten stetig kleiner, dabei war doch für sie 1920 unter französischem Völkerbundmandat der Libanon gegründet worden, und ihm verdankten viele Maroniten ihren Wohlstand und Aufstieg in die Mittelschicht. Im Gegenzug wuchs die Bedeutung der verarmten und marginalisierten schiitischen Bevölkerung deutlich an, was zu einer Landflucht und dem Entstehen eines gigantischen »Vororts« (dahiye) im Süden Beiruts führte. In der ersten Hälfte der 1970er-Jahre – also vor der iranischen Revolution 1978–1979, die die besondere Identität dieser Gruppe herausstellte – betrachtete man die Schiiten im Libanon eher undifferenziert als Muslime und zählte sie damit zur Klientel der sunnitischen Würdenträger, aus deren Mitte der Ministerpräsident bestimmt wird (der Staatspräsident, der die Regierungskontrolle in Händen hielt, muss laut Verfassung maronitischer Christ sein). Parallel dazu verstärkte die Ansiedlung der bewaffneten palästinensischen Organisationen die Muslime im Land insgesamt, die auf eine Reform des politischen Systems zu ihren Gunsten und auf Kosten der Christen drangen. In der Tat entwickelten die Palästinenser, die nahe der Grenze zu Israel im Süden des Libanon lebten, zur dort vorherrschenden schiitischen Bevölkerung eine ganz besondere Beziehung. Abu Dschihad, ein Stellvertreter Arafats, half Mitte der 1970er-Jahre dabei, die ersten schiitischen Parteien zu gründen wie etwa Amal oder die »Bewegung der Entrechteten« des Imam Musa as-Sadr. Wegen Gebietsstreitigkeiten und den vom Libanon aus abgeschossenen palästinensischen Katjuscha-Raketen, die israelische Bombardements auf den ganzen Süden des Landes nach sich zogen, traten nun allerdings Spannungen zutage. Während der Iranischen Revolution bot Arafat Chomeini 1978 organisatorische Mitarbeit an und erbat später Fatwas zugunsten der »palästinensischen Revolution«, um die Feindseligkeiten mit der schiitischen Bevölkerung zu verringern. Mit der Ausweitung der israelischen Angriffe nach 1972 verschlechterte sich insgesamt das Verhältnis zwischen dem libanesischen Staat, insbesondere dem christlichen Bevölkerungsanteil, und den Palästinensern.
All diese Gründe erklären den Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs am 13. April 1975, als ein Angriff von Phalange-Milizionären (Maroniten) auf einen Bus mit Palästinensern 27 Todesopfer forderte. Mit seiner Reaktion sicherte sich das »islamisch-progressive« Lager, dem die Palästinenserorganisationen die entscheidende Feuerkraft verliehen, die militärische Überlegenheit, und zwar zunächst mit syrischer Billigung. Im Juni 1976 jedoch ließ Hafiz al-Assad seine Armee in den Libanon einmarschieren, um das Gleichgewicht wiederherzustellen und Kapital daraus zu schlagen. Die syrische Besetzung eines Großteils des Landes dauerte fast drei Jahrzehnte und endete erst im April 2005. Von den vielen Wendungen des Bürgerkriegs, zu denen unter anderem der Einmarsch Israels im Südlibanon 1978 und zwischen 1982 und 1985 dann im gesamten Land bis an die Grenzen der Hauptstadt gehören, aber auch die Entführung westlicher Geiseln sowie die Bruderkriege zwischen christlichen Fraktionen, sind für meine Betrachtungen zwei Ereignisse entscheidend. Erstens die Gründung der Hisbollah Ende 1982, die seit 1985 offiziell existiert. Auf Betreiben von Chomeinis Iran gegründet, sollte diese schiitische Partei drei Jahrzehnte später das politische Leben des Libanon bestimmen, nachdem sie den Widerstand gegen Israel von der PLO übernommen hatte. Zweitens besiegelte das 1989 im saudi-arabischen Taif geschlossene Abkommen die Niederlage der Christen, indem es die politische Macht vom maronitischen Staatspräsidenten auf den sunnitischen Ministerpräsidenten übertrug. Der bedeutendste Profiteur dieser Regelung war der libanesisch-saudische Milliardär Rafiq al-Hariri, der ab 1992 wiederholt den Posten des Ministerpräsidenten einnahm und die zerstörte Innenstadt von Beirut wiederaufbauen ließ. Dieses »Solidere« genannte Projekt sollte die Wirtschaft des Landes ankurbeln – bis zu Hariris Ermordung am 14. Februar 2005 durch einen Anschlag auf seine Fahrzeugkolonne in eben dem Stadtteil, dem er so sehr seinen Stempel aufgedrückt hatte.
Die deutliche Umgestaltung des Libanon in einen sunnitischen Raum spiegelte sich an der Demarkationslinie zwischen der christlichen und der muslimischen Zone der Hauptstadt, im zerstörten Suq-Viertel und sichtbar im Bau der »Hariri-Moschee« wider, die so gewaltig ist, dass sie die benachbarte maronitische Kathedrale beinahe erdrückt. Paradoxerweise stellte das Abkommen von Taif, obwohl es ausdrücklich darauf abzielte, Muslime auf Kosten der Christen zu stärken, in Wirklichkeit doch einen schwachen Versuch der Sunniten dar, dem unaufhaltsamen Aufstieg der schiitischen Gemeinschaft einen Riegel vorzuschieben. Diese war zur inzwischen größten Bevölkerungsgruppe des Landes herangewachsen und wurde über den Umweg der Hisbollah vom Iran unterstützt und bewaffnet. Um die Logik des Aufstiegs einer schiitischen Macht in Konkurrenz zu Saudi-Arabien im islamischen Raum zu verstehen – aus dem sich letzten Endes auch der syrische Bürgerkrieg 2018 als Konsequenz ergab –, müssen wir uns in die Perspektive der Ereignisse des Schlüsseljahrs 1979 begeben. Es begann mit der Rückkehr Chomeinis nach Teheran im Februar und endete am Weihnachtstag mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan sowie dem dortigen Beginn des sunnitischen Dschihad. Unterdessen hatten im März Israel und Ägypten in Washington auch ihren Friedensvertrag unterzeichnet.
Das Schlüsseljahr 1979: Überbietungswettbewerb zwischen Schiiten und Sunniten
Wie alle Erdöl exportierenden Länder hatte auch der Iran in großem Umfang vom Anstieg des Barrelpreises profitiert – selbst wenn er, als nicht-arabischer Staat, zu keinem Zeitpunkt an der Entscheidung für das Embargo im Oktober 1973 beteiligt gewesen war. Doch Schah Mohammad Reza Pahlavi setzte in der Folge einen Überbietungswettbewerb in Gang. In der Vervierfachung des Ölpreises erkannte er die Möglichkeit, sein Land zu einem der führenden Staaten weltweit zu machen, und gab seine überdimensionierten Pläne durch große Anzeigen in der internationalen Presse bekannt. Der Schah stieg in die europäische Firma zur Urananreicherung Eurodif ein und beunruhigte damit seine Nachbarstaaten am Golf, die eine iranische Vorherrschaft in der Region befürchteten. Seine Megalomanie zeigte sich beispielsweise in den prunkvollen Feierlichkeiten in Persepolis, wo im Oktober 1971 für mehrere Milliarden US-Dollar die 2500-Jahr-Feier der Gründung des Perserreiches begangen wurde. Ansonsten profitierten von den enormen Erdöl-Einnahmen vor allem seine Vertrauten, die Armee und der Staatsapparat, wohingegen die Zivilgesellschaft gewalttätigen Repressionen durch die Polizei ausgesetzt war. Der Abstieg der Mittelschicht, verkörpert durch die Basarhändler oder die schiitischen Kleriker, die aus ihr hervorgegangen waren, förderte die soziale Krise. Verschlimmert wurde sie noch durch den Zustrom von Menschen aus ländlichen Gebieten in die Städte, wo ihre Hoffnung enttäuscht wurde, vom Geldsegen der Ölerträge zu profitieren; sie bildeten ein riesiges Proletariat der »Entrechteten«. Vor diesem Hintergrund wandten sich zahlreiche Empfänger großzügiger Stipendien, die zu Zigtausenden zum Studium in den Westen entsandt worden waren, um den Iran der Zukunft aufzubauen, schließlich gegen das autokratische und korrupte Herrscherregime.
Im November 1977 löste der Schah mit seinem Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten, in denen sich der demokratische Präsident Jimmy Carter gerade von seinem Vorgänger Richard Nixon abzusetzen und die US-Außenpolitik zu »moralisieren« versuchte, gewalttätige Gegendemonstrationen aus. Das Tränengas, das die Polizei einsetzte, um die vor allem marxistischen oder linken Studenten und Aktivisten von der Mall in Washington zu vertreiben, wurde vom Wind in den Rosengarten des Weißen Hauses geweht, sodass Mohammad Reza Pahlavi seine Radio- und TV-Ansprache unter Tränen abbrechen musste. Die symbolische Wirkung dieser Bilder setzte dem Regime zu und ermutigte die iranische Opposition, zumal die US-amerikanischen Forderungen nach einer Anerkennung der Menschenrechte zu einer Mäßigung der Repression führten. Wie dann in Algerien 1988 und bei dem »arabischen Aufstand« zu Beginn der 2010er-Jahre wässerten die religiösen Kräfte die schon gelegte revolutionäre Saat, um damit die Bewegung für sich zu vereinnahmen und nach ihren Vorstellungen umzugestalten. Wie in den benachbarten arabischen Staaten, in denen modernisierende Autokraten den Laizismus im Dienste ihrer Diktatur missbrauchten und die Legitimität einer demokratischen Opposition, die ebenfalls diese Ideale vertrat, damit kompromittierten, hatte auch der Iran unter Pahlavi eine solche Polarisierung bevorzugt. Auf der einen Seite stand noch die kommunistische Partei, auf der anderen standen die am stärksten politisierten Gruppen der schiitischen Kleriker.
Trotz des von den Marxisten behaupteten Atheismus existierte zwischen diesen beiden Gruppierungen eine Art struktureller Affinität: Wie bei den leninistischen Organisationen ist der schiitische Klerus hierarchisch aufgebaut und immer in der Lage, effektiv für die Verbreitung von Slogans und die Mobilisierung der Anhänger zu sorgen (was sie von der sunnitischen Welt unterscheidet, in der durch die verschiedenen, zueinander in Konkurrenz tretenden Ulemas die religiöse Autorität zersplittert ist). Dank dieses kostbaren Werkzeugs kann unablässig die revolutionäre Bewegung im Kampf gegen die Herrschenden angetrieben werden. Diese Ähnlichkeit manifestierte sich in zahlreichen islamisch-marxistischen oder islamisch-linksgerichteten hybriden Gruppierungen. Zu den bekanntesten gehören die Volksmudschaheddin, die bereits im Namen die Ideale des Dschihad und des Populismus kombinieren. Diese Verbindung geht zurück auf den Intellektuellen Ali Schariati, der aus einer Klerikerfamilie stammte und seine letztgültige Ausbildung im Quartier Latin erhalten hatte. Er übersetzte Frantz Fanons Werk Die Verdammten dieser Erde ins Farsi und formulierte die berühmte marxistische Gegenüberstellung von »Unterdrückten« und »Unterdrückern« in korankonformes Vokabular um, wenn er von »Entrechteten« (mostadafin) und »Selbstgefälligen« (mostakbirin) sprach. Diese Neuformulierung griff jedoch nicht die gleichen Kategorien auf wie das Original: Indem sie den Begriffen eine starke religiös-moralische Bedeutung mitgab, ermöglichte sie es, die Grenzen des Klassenkampfs zu verschieben. Damit gehörten zur großen Gruppe der »Entrechteten« nun alle Gegner des Schahs, vom Kaufmann im Basar bis hin zum nach der Landflucht gebildeten Proletariat. In diesem Verständnis vereinigten sich im revolutionären Prozess und unter der Führung eines Klerus, der für eine ähnliche Ideologie gewonnen wurde, die fromme Mittelschicht und die arme, städtische Jugend, die, streng sozial betrachtet, eigentlich Gegenspieler hätten sein müssen.
Ajatollah Chomeini verbrachte von 1964 bis 1978 sein Exil in der den Schiiten heiligen irakischen Stadt Nadschaf und ging anschließend in den Pariser Vorort Neauphle-le-Château. Bei seiner triumphalen Rückkehr nach Teheran am 1. Februar 1979 bewies er das politische Genie, die eben beschriebene Möglichkeit aufzugreifen und sich für die Sache der »Entrechteten« einzusetzen. Es gelang ihm, den Klerus, der ihm anfangs nicht wohlgesinnt war, zu kontrollieren und die linken Bewegungen zu instrumentalisieren, bevor er sie dann nach seinem Sieg und der Verkündung der »Islamischen Republik« aus dem Weg räumte. Dazu griff er, ganz ähnlich wie es der Salafismus in der sunnitischen Welt tat, auf eine fundamentalistische und von jedem Dogma »gereinigte« Form zurück, die sich deutlich von den im Laufe der Geschichte entwickelten Kompromissen zwischen den Ajatollahs und den Herrschern absetzte. Nach Chomeinis Auffassung repräsentiert der Imam Hussein, als Märtyrer im Oktober 680 im Kampf gegen Soldaten des sunnitischen Kalifen Yazid gestorben, die erhabene Inkarnation der »Entrechteten«, während der Schah den »selbstgefälligen« Yazid personifizierte. Indem er so die Grundlagen des durch seine Ideologie neu interpretierten Glaubens mit den Gegebenheiten der Gegenwart zusammenführte, gelang Chomeini eine beachtliche Mobilisierung, die die Oberhand über alle übrigen Anhänger der Opposition und auch des Königshauses gewann.
Folglich entwickelte sich Chomeini, der an Bord einer Air-France-Maschine nach Teheran zurückgekehrt war und sich fortan »Revolutionsführer« nennen ließ, nun im Kontext der Islamisierung des Nahen und Mittleren Ostens, die sechs Jahre zuvor vom saudischen Königshaus und seinen Alliierten mit dem Ramadan-Krieg und der Vervielfachung des Ölpreises begonnen worden war, zu einer besonders starken, konkurrierenden schiitischen Kraft. Der Antagonismus zwischen Sunniten und Schiiten sollte zur wichtigsten Triebfeder der Kriege und Krisen werden, die die Region in den folgenden vier Jahrzehnten heimsuchten. Er reichte sogar darüber hinaus und traf durch den wiederkehrenden Export des islamistischen Terrors besonders Europa, wo er die hier lebenden muslimischen Migranten zu seinen Geiseln machte. Infolge der schwankenden Ölpreise sollte dieser Gegensatz schließlich sogar jene Bruchlinie relativieren, die der arabische Nationalismus nach den Unabhängigkeitsbewegungen herausgebildet hatte – den israelisch-palästinensischen Konflikt –, bis er schließlich Teil der bestehenden Logik der Auseinandersetzungen wurde (wie seine Vereinnahmung durch die libanesische Hisbollah und die palästinensische Hamas zeigt, die beide unter dem Einfluss Teherans stehen). Die Dynamik dieses Konflikts wurde durch den unablässigen Überbietungswettbewerb geschürt und vollzog sich auf Kosten einer ständigen Verschlimmerung des Chaos inmitten der Gesellschaften des Nahen und Mittleren Ostens. Was vor allem an einer unverantwortlichen Politik lag, die durch die Öleinnahmen möglich geworden war und bis in die Mitte der 2010er-Jahre als endlos weiterführbar angesehen wurde.
Die Herausforderung der Iranischen Revolution für Saudi-Arabien und seine Verbündeten war beachtlich, denn der Iran beschränkte nun die Reichweite einer Islamisierung unter sunnitischer Führung und nahm ihr die soziale und heroische Anmutung. Die über die Emire der arabischen Halbinsel laufende, lockere Verknüpfung eines weltweiten salafistischen Netzes und die finanzielle Unterstützung, die zu dieser Zeit ein Großteil von ihnen der internationalen Muslimbruderschaft zukommen ließ, entzündeten keinen solchen Enthusiasmus, wie ihn die Ereignisse im Iran bei der muslimischen Bevölkerung weltweit spontan auslösten. Umso mehr, als der Diskurs Chomeinis gleichzeitig zwei globale Feinde ins Visier nahm: den »großen Satan« Amerika (sowie in dessen Begleitung den »kleinen Satan« Frankreich, trotz aller in Neauphle-le-Château gewährten Gastfreundschaft), aber auch die Ölmonarchien, die er schlicht als Lakaien der Vereinigten Staaten darstellte. Indem Chomeini sich den Ideen Schariatis und damit einer weltweiten Dritte-Welt-Bewegung anschloss und die Vereinigten Staaten attackierte, ging er über die einfache religiöse Dimension hinaus. Das wiederum trug ihm Sympathien bis nach Lateinamerika ein. Und durch die Kritik an den Ölmonarchien versuchte er, über die rein persische und schiitische Identität (die nur etwa 15 Prozent der Muslime weltweit bilden) hinauszuwirken, um die Führung des universellen Islam durch die wahhabitischen Herrscher, »die Wächter der zwei Heiligen Stätten«, infrage zu stellen.
Die amerikanisch-saudische Antwort auf die Iranische Revolution bestand zum einen im Dschihad in Afghanistan. Die Gelegenheit dazu war die Vergeltung für den Einmarsch der Roten Armee an Weihnachten 1979. Im selben Jahr wurde am 26. März auch der ägyptisch-israelische Friedensvertrag unterzeichnet – ein Zeichen für die Verschiebung der Hauptkonfliktlinie vom Nahen Osten und der Mittelmeerregion hin zum Persischen Golf und nach Zentralasien. Anders noch als bei den sowjetischen Interventionen in Ungarn 1956 und der Tschechoslowakei 1968, die im Rahmen der Jalta-Verträge stattfanden und keinerlei militärische Reaktion der »freien Welt« nach sich zogen, verstieß die Ankunft von Fallschirmjägern und Panzern in Kabul gegen die Regeln, die am Ende des Zweiten Weltkriegs aufgestellt worden waren. Breschnew sah sich zum Handeln gezwungen, um die örtlichen Kommunisten an der Macht zu halten, die in ihrem atheistischen Bekehrungseifer auf den allgemeinen Widerstand einer in Volksgruppen und dem ländlichen Leben äußerst verhafteten Gesellschaft mit starken traditionellen Normen gestoßen waren. Das Weiße Haus konnte eine erneute Schmach nicht einfach hinnehmen, war es vier Jahre zuvor doch bereits in Vietnam unterlegen und hatte Anfang 1979 mit dem Iran einen Verbündeten verloren. Letzteres war ein durchaus relevantes geopolitisches Problem, da der Schah zuvor die Rolle eines »Polizisten am Golf« übernommen und die unermesslichen Ölvorräte des Landes damit dem sowjetischen Zugriff entzogen hatte. Darüber hinaus mussten die Vereinigten Staaten eine beispiellose Demütigung erleiden, nachdem »Studenten von der Linie des Imam« am 4. November Geiseln in der US-Botschaft in Teheran genommen hatten und der Versuch ihrer Befreiung gescheitert war. Die sowjetische Militärpräsenz in Afghanistan, einem Nachbarland des Iran, dessen eigene kommunistische Partei Tudeh zu den revolutionären Kräften gehörte (Chomeini ging erst in seinen letzten Jahren gegen sie vor), frischte, über den Verstoß gegen den Pakt von Jalta hinaus, die amerikanische Angst vor Moskaus Durchbruch in Richtung der »warmen«, d.h. eisfreien Weltmeere auf. Man darf dies als zeitgenössische Variation des anglo-russischen »Großen Spiels« in Zentral- und Südwestasien seit dem 19. Jahrhundert verstehen.
Und schließlich wurde das Ende des Jahres 1979 von einem Drama beherrscht, das, aus Sicht der islamischen Welt, mit hoher Symbolkraft ausgestattet war: Der 20. November markierte den ersten Tag im 15. Jahrhundert der islamischen Zeitrechnung. Unter Berufung auf die islamische Lehre, nach der in jedem Jahrhundert ein »Erneuerer« (mouhi) oder »Messias« (mahdi) auftritt, der nach vielen Abweichungen die Reinheit des Glaubens wiederherstellt, überfiel an diesem Tag eine radikale Dschihadistengruppe die Große Moschee in Mekka. Ihr Anführer, Dschuhaiman al-Utaibi, stammte aus einer bedeutenden Familie des Landes und wollte mit dem Überfall gegen die Korruption der vom Westen abhängigen Herrscherfamilie protestieren und seinen Schwager, Abdullah al-Qahtani, zum Messias ausrufen lassen. Dschuhaiman, der zu den Randgruppen der strengsten Verfechter des salafistischen Establishments Saudi-Arabiens gehörte, hatte »Briefe« in Umlauf gebracht, von denen sich 30 Jahre später der sogenannte »Islamische Staat« inspirieren ließ. Erst nach zwei Wochen konnte das Heiligtum in Mekka zurückerobert werden, auch dank des Eingreifens einer Truppe der nationalen französischen Gendarmerie (GIGN). Das allerdings wurde streng geheim gehalten, da es Nicht-Muslimen untersagt ist, heiligen Boden zu betreten (haram