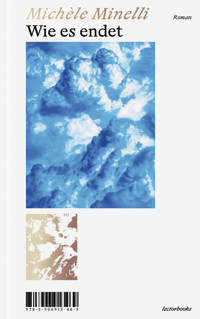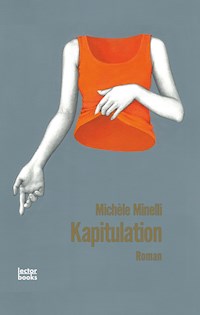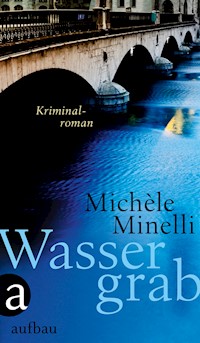11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Jungbrunnen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Schulabschluss und dann die Filmakademie. Das ist der Ausbildungsweg, den Antonia einschlagen muss, um zu ihrem Traumberuf zu kommen: Sie möchte Filmregisseurin werden. Das Einzige, was sie dafür brauchen würde, ist etwas Ordnung und Struktur. Aber statt sie zu unterstützen, macht Antonias Mutter Angi ihr das Leben schwer. Die hält weder etwas von Schulpflicht noch von einer geregelten Ausbildung. Sie selbst lügt sich ihr Leben zurecht, wie sie es gerade braucht, um ihren aktuellen Liebhaber zu beeindrucken. Ihren drei Töchtern macht sie klar, dass nichts über die tatsächliche Familiensituation nach außen dringen darf, weil sonst die Gefahr besteht, dass ihr die jüngste Tochter, Pippa, vom Jugendamt weggenommen wird. Antonia fühlt sich für alle verantwortlich und versucht, nichts außer Kontrolle geraten zu lassen – bis ihr die Dinge über den Kopf wachsen und sie plötzlich für ihr eigenes Leben keinen Weg mehr sieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Autorin dankt der Dr. Heinrich Mezger-Stiftung für die Förderung dieses Projekts.
ISBN 978-3-7026-5954-7eISBN 978-3-7026-5955-4
1. Auflage 2021
Einbandgestaltung b3k unter Verwendung eines Fotos von alamy. Stuart Corlett
© 2021 Verlag Jungbrunnen Wien
Alle Rechte vorbehalten – printed in Austria
Druck und Bindung: Buch Theiss GmbH, A-9431 St. Stefan
Wir legen Wert auf nachhaltige Produktion unserer Bücher und arbeiten lokal und umweltverträglich: Unsere Produkte werden in Österreich nach höchsten Umweltstandards gedruckt und gebunden. Wir verwenden ausschließlich schadstofffreie Druckfarben und zertifizierte Papiere.
Michèle Minelli
Chaos im Kopf
Antonia – vierzehn-dreiviertel
Für Dimea, Lauro und Lión
Michèle Minelli
wurde 1968 in Zürich geboren und arbeitete zuerst als Filmschaffende, später als freie Schriftstellerin. Sie schreibt Romane und Sachbücher und probiert gerne verschiedene Textformen aus. Mit vierzig absolvierte sie das Eidgenössische Diplom als Ausbildungsleiterin und unterrichtet seither regelmäßig „Kreatives Schreiben“ und andere Themen in literarischen Lehrgängen.
INHALT
TAKE ONE
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
TAKE TWO
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
TAKE THREE
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
TAKE FOUR
Kinder- und Jugendnotrufnummern
TAKE ONE
Ton ab!
Ton läuft!
ANTONIA
„Scheißeaberauch.“
Kapitel eins
Das Problem ist meine Mutter. Ich sehe Harry, den Mund offen wie ein gestrandeter Fisch, ich sehe Paul, die Hände in den Taschen, ich sehe Tim mit Glotzaugen rauf und runter Haut-den-Lukas üben, und natürlich strahlt Emmi über beide Backen. Emmi strahlt so, dass ich mich unweigerlich weit weg von hier wünsche, ich bin gerade überhaupt nicht hier, überall wäre ich lieber, als genau jetzt genau hier.
Es ist nicht das erste Mal in meinem vierzehndreivierteljährigen Leben, dass sich die Köpfe nach meiner Mutter umwenden. Ich habe das nachdenkliche Hochziehen von Hosenbünden gesehen, das Strammstehen von Beinen, das Klappen von Unterkiefern, verursacht durch schiere Überwältigung. Ich habe literweise Schmeichelei von Lippen tropfen sehen, ich habe Männermienenspiele beobachten dürfen, so schmachtend, so überrascht begeistert, so unerwartet bewegt. Ich habe oh, là, là gehört, wow, hey Süße, Zuckerschnecke, und Pfiffe, die ich tagelang nicht aus meinem Ohr gebracht habe und von denen mir, ich schwörs, rechts ein Tinnitus verblieben ist.
Aber egal, wie sehr ich mich sträube, ich komme nicht darum herum. Ich muss mir ansehen, was alle sehen; mein Lehrer Schoch hat vor gefühlten drei Minuten mitten in seiner Begrüßung zum Elternbesuchstag zu sprechen aufgehört, also drehe ich meinen Kopf, blicke über meine linke Schulter und nehme das Unvermeidliche in Augenschein.
Mein dritter Gedanke ist: Und woher hat sie diese weißen Westernstiefelchen? Gedanke eins und zwei sind in meinem inneren Tumult untergegangen.
Meine Mutter winkt mir zu. Emmi neben mir winkt ihr zurück. Ich hebe kurz die Hand, meine es aber nicht so.
Schoch hat seine Stimme wiedergefunden. Ich bin gottfroh, dass er sich nicht verhaspelt. Ich habe genug damit zu tun, mich in dem Blickegewirr, das herrscht, nicht zu verirren.
Das macht mich jedes Mal fertig. Wie meine Mutter angestarrt wird.
Von bloßen kantigen Knien unter kanariengelbem Schottenrock (mini) hoch zum Jeansjäckchen (mindestens zwei Nummern zu klein), von der weißen Lochstickbluse, die über dem Busen meiner Mutter perfekt spannt, zu ihrem Spaghettiblondhaar, dem Perlenstirnband (gefaked, nach indianischer Art, und online ersteigert), das sich unter ihren langen geraden Fransen durchschlängelt, zurück zu den Westernstiefelchen mit Türkis-Steinbesatz – und das alles in ständigem Hin und Her zwischen Klasse, Lehrer, mir.
Schoch bittet darum, Platz zu nehmen. Die Ansprache ist beendet. Stühlerücken. Nackengeradesetzen, Hefte hervornehmen, nervöses Füßescharren. Ich frage mich, wie sie das immer wieder schafft, zur optimalen Unzeit hereinzuschneien. Und ich schicke ein Stoßgebet zum Himmel, dass der jährliche Elternbesuchsmorgen bald vorüber sein möge.
Emmi pufft mich in die Rippen: „Übel, Toni!“ Und noch einmal, puffen und: „Echt übel“. Sie beißt in ihr veganes Sandwich, das sie mit einem Ofen-Schnitzel vom Mittagskiosk gepimpt hat. „Voll retro.“
Ich schlucke hart an der Cola und reiche die Flasche an Emmi zurück. „War da nicht mal eine Gruppe aus Dänemark? Schweden? Abba?“ Emmi mampft. „Hochglanz-Hippie. Ich wünschte, meine Mom wär so geil.“
Manchmal ist es das Beste, Emmi einfach reden zu lassen. Lustlos gable ich aus meinem Tupper die Rosinen heraus. Dank freitäglichen Reissalats bin ich mit den Spatzen beste Freundin.
„Warum ist deine Mutter eigentlich nicht gekommen?“, frage ich Emmi. Sie bläst die Backen auf. Das sieht besonders bei ihr lustig aus. Emmi hat ein rundes hübsches Gesicht, schwarze Augen, die sie nach Wunsch glühen lassen kann. Ihre südamerikanische Herkunft betont sie mit gigantischen Kreolen, die von ihren knuffigen Ohrläppchen schaukeln. Mit der Ferse schiebt sie eine der verloren gegangenen Rosinen näher an einen Spatz heran.
„Was weiß ich? Die hat halt wieder einen wichtigen Klienten. Irgendeinen Psycho, der sich in die Hose kackt, wenn sie seine Therapiestunde absagt.“ Mit der Seite des kleinen Fingers streicht sie sich die veganen Fake-Butterreste, wie sie das nennt, vom Mund. „Wie immer halt.“
Dann zeigt sie wieder Zähne: „Echt geil. Angi ist eine Trendsetterin!“
Emmi ist davon überzeugt, dass meine Mutter in no time eine Million Follower generieren würde, wenn sie als Influencerin einen eigenen Instagram-, Twitter- oder Youtube-Account hätte. Nur versteht meine Mutter von sozialen Netzwerken rein gar nichts. Noch weniger als von analogem sozialem Verhalten. Ich glaube, es käme einem Wunder gleich, wenn meine Mutter wenigstens sich selbst verstehen würde. Nachdem sie zwei Jahre lang vom Gedanken besessen war, wir alle stammten von der Venus, und sich und uns auf die Rückkehr dorthin vorbereitet hatte, dauerte es ein dreiviertel Jahr, bis sie ihren Körper von der Astralebene auf die irdische Ebene zurückgeführt hatte. (Sie fühlte sich sehr allein damals, ich sah es ihren hängenden Schultern an, aber ich hasste sie dennoch. Ich konnte nicht anders, ich war ganz getrieben davon.)
Ich frage mich noch immer, wo sie diese Stiefelchen herhat. Als die Glocke klingelt, schauen wir beide auf die Uhr. Die Hoffnung, dass die Glocke einmal falsch gehen könnte, geben wir nicht auf, Emmi und ich.
Ich lasse mich von ihr hochziehen. Dann klopfen wir uns gegenseitig den Hintern ab. Mit einem Mal steht Seb vor mir. Mit perfekter Totengräbermiene legt er mir seine Hand auf die Schultern, jetzt bekomme ich richtig Angst.
„Mein herzliches Beileid“, sagt er.
Ich verstehe Bahnhof. Seb ist eigentlich nicht der sonderbare Typ.
„Es tut mir sehr leid“, fährt er fort und flüstert, weil er offenbar dabei ist, mir ein Geheimnis zu verraten, „dass ihr Bobstar One einschläfern lassen müsst …“
Sein Gesicht kann ich nicht lesen. Luft strömt zwischen meinen Zähnen hindurch, meine Lungen füllen sich.
„Euren Zuchthengst.“
Dong!
Emmis Blick möchte ich jetzt gar nicht sehen. Ich sage, nachdem ich stoßartig ausgeatmet habe: „Oh, das.“ Mehr fällt mir nicht ein, und Emmi beginnt mich glücklicherweise in Richtung Tür zu schieben. „Danke“, sage ich zu Sebastian und reiche hilflos ein Trauerlächeln nach.
Seb und ich kennen uns seit dem Kindergarten. Früher hat er gern mit Puppen gespielt. Irgendwann haben wir aufgehört, miteinander zu reden. Vielleicht, als Emmi kam. Vielleicht wegen der Geschichte mit der Vorstellung der Feldbusch, dem Elternabend damals. Jetzt sind wir Teens und begegnen uns jedes Mal wie neu. Unsere Kinderfreundschaft ist unterwegs eingeschlafen. Als wir uns an unsere Plätze setzen, knufft Emmi mich und sagt: „Ich wusste gar nicht, dass ihr einen Zuchthengst habt?“
Ich verdrehe die Augen: „Hats irgendwer gewusst?“
Offenbar verbreitet meine Mutter gerade eine Mär über einen todgeweihten Zuchthengst auf unserem Schulhausplatz. Ihr fällt immer wieder etwas Neues ein, wenn es darum geht, vor der Lehrerschaft zu vertuschen, dass ich noch keinen Schnupperplatz habe.
Nach Schulschluss folge ich Emmi bis zu ihrem Block. Geübt stößt sie das Fenster auf mit einem Ast, den sie extra zu diesem Zweck im Gebüsch versteckt hält. (Ich habe auch so einen Ast unter meinem Zimmerfenster.) Wir wohnen beide ebenerdig.
„Soll ich dir nicht doch lieber die Räuberleiter machen, damit du wenigstens bis auf Fensterhöhe klettern kannst?“
„Die hört nichts. Ihr Therapiezimmer ist absolut schalldicht.“ Mit Schwung schmeißt Emmi zuerst ihren, dann meinen Schulranzen durchs Fenster. „So.“ Sie reibt sich die Hände wie ein Klempner.
„Baustelle?“, fragt sie.
„Baustelle“, antworte ich.
Die Baustelle ist ein Abbruchgebäude, zwei Kilometer von unserer Siedlung entfernt. Ehemals Ziegelei, bietet sie unerschöpflich Raum für Entdeckungen und Rückzugsmöglichkeit. Wir traben auf unsichtbaren Pferden. Hin und wieder macht eine von uns Wiehergeräusche, und die andere ergänzt mit „brr“ oder „hü“.
Als wir ankommen, binden wir unsere Pferde am Zaun fest. Ihres nennt sie Blitz, ich meines Schatten. Dann klettern wir über den Schuttberg in der vorderen Halle und weiter die schadhafte Eisenleiter empor. In einer Art Zwischenstock läuft ein schmaler Gittersteg die Wände entlang. Hier verschränke ich meine Hände für Emmi auf Hüfthöhe. Emmis Schuhe sind immer wie saubergeleckt, ich weiß auch nicht, wie sie das schafft. Als sie oben ist, zieht sie mich hinauf. Wir sind schon fast am Ziel. Den einen Fuß auf einem Rohr, den anderen horizontal gegen die Wand gestemmt, hieve ich mich zu ihr auf den Gusseisenträger. Wir befinden uns jetzt gut sechs Meter über dem Boden. Wo der Doppel-T-Stahlträger parallel zu der Reihe hoher Kunststoffscheiben verläuft, hocken wir uns längs hin und strecken die Beine. Zwecks Gemütlichkeit haben wir die Hohlräume der Träger mit alten Kissen ausgestopft.
Hier können wir stundenlang herumsumpfen und das Licht von außen über die schmutzverkrustete Scheibe ziehen lassen. Als Auftakt ins Wochenende nicht der schlechteste Ort. (Als Verschnaufpause nach allem, was war und für alles, was kommt: der beste.)
Emmi zieht eine Packung Zigaretten aus ihrem Camouflage-Windbreaker. Mir welche anzubieten, hat sie aufgegeben nach meinem äußerst peinlichen Hustenanfall vor einem Monat. Sie ist dahintergekommen, dass ich das Inhalieren nur vortäusche, also habe ich als Beweis richtig tief inhaliert. Und bin fast draufgegangen.
So viel zu diesem Erfolg.
Sie bläst den Rauch in Kringeln. Ich kaue auf einem Nagelhäutchen herum. Dann vibriert ihr Handy. Ich bewundere sie, wie sie mit ihren langen, nach vorn oval zulaufenden Traumnägeln tippen kann. Manchmal einhändig. Manchmal mit zwei Daumen. Emmi beherrscht beides. Gäbe es ein Instrument mit einer Tastenanordnung wie bei einem Handy, würde Emmi damit Konzertsäle füllen.
INNEN TONHALLE – NACHT
EMMI schreitet mit ihren langen, festen Schritten auf die Bühne. Das Publikum applaudiert zuerst zögerlich, dann in einer anschwellenden Welle. EMMI verneigt sich würdevoll. Ihr volles, schwarzes Haar wirkt wie die opake Oberfläche eines Sees, der in zartem Kräuseln in Bewegung gerät.
Sie nimmt Platz auf einem Stuhl, verkehrt herum, die geschwungene Lehne vor ihrer Brust, die Beine scharf gespreizt. An der Oberkante der Lehne ist ein Instrument angebracht.
SCHEINWERFER AUF HANDY
ZOOM IN
„Jepp“, reißt sie mich aus meiner Tagträumerei. Ich hebe die Augenbrauen: „Jetzt schon?“
„Jepp“, sagt sie noch einmal und wirft die Kippe in hohem Bogen durch die Luft: „Bleib brav.“
Ich nehme das nicht als Beleidigung. Auch nicht, dass sie sich ein Frischer-Atem-Plättchen auf die Zunge legt. Ich nehme das nie als Beleidigung. Gemäß Emmi könnte ich auch bleiben und zusehen. (Nein, danke.) Ich will gar nicht genau wissen, was sich da abspielt im „oberen Kommandoraum“, wie wir die Wandnische nennen, welche die Jungs, mit denen Emmi rumhängt, mit Matratzen ausstaffiert haben. Dass sie nicht mit all denen schlafe, hat sie mir versichert.
„Es gibt ja Hände“, sagte sie, aber ich wedelte ihre weiteren Ausführungen weg.
Mir sind diese Typen auch zu alt. Emmi ist ja doch anderthalb Jahre älter als ich, aber weil sie einmal wiederholen musste, geht sie in meine Klasse. Dabei ist sie manchmal noch genauso kindisch wie wir anderen auch. Die Jungs, die gleich hier auftauchen werden, sind achtzehn, neunzehn. Vom Stil her Yuppies, wie Emmi mit Augenrollen betont hat. Nicki ist sogar zweiundzwanzig, sie sind also alle ziemlich viel älter als wir. Das sind schon richtige Männer mit Brusthaar und Achselschweiß. Emmis prüfender Blick erwischt mich, ich lächle ihr zu und hoffe, dass es nicht schleimermäßig aussieht. Sie reicht mir eine Hand, damit ich mich besser rückwärts hinunterhangeln kann. „Tschüss, dann.“
„Tschüss, ja.“
„Nimmst du bitte Blitz mit?“
„Geht klar.“
Mir passt die Art nicht, wie mich Nicki und Jan und Ivan anschauen, wenn sie mich mit Emmi zusammen sehen. Es ist jedes Mal so, als ob ich mich nachher umziehen müsste. Blitz und Schatten vergesse ich und marschiere schleunigst davon. In meinem Kopf ist ein Durcheinander.
Ich weiß, dass Emmi auf Nicki steht. Sie findet seine Lockentolle süß. Auf seine maskulinen Oberarme fährt sie voll ab. Und die seltenen Male, die er sie in seinem roten Alfa Romeo Spider mitnahm, sind Legende.
Für mich sind diese Typen austauschbar. Gruselig alle miteinander.
Endlich erinnere ich mich, dass ich die Pferde stehen gelassen habe. Ich pfeife ihnen, und schon springe ich auf und trabe durchs hohe Feld gegen Osten, Emmis Blitz als Handpferd. Schatten prescht dahin, wohin ihn meine Schenkel lenken. Es ist mir ganz egal, wer mich so sieht, ich galoppiere jetzt grenzenlos. Mit meinen Fantasiepferden um mich herum ist die Welt in Ordnung.
(Ich muss Sultan noch ein letztes Mal umarmen, meine Nase in sein Fell reiben. Ihn ein letztes Mal halten.)
Ich weiß. Eigentlich wollte ich da ja nicht mehr hin. Eigentlich habe ich schon vor zwei Tagen von Sultan Abschied genommen, dem einzigen echten Pferd in meinem Leben. Dem Pferd, das ich seit vier Jahren striegle, streichle und hin und wieder reiten darf. Ich verhalte mich unreif, würde Emmi sagen. Ich solle gefälligst Cheekbone zeigen und lachen, Trübsal ertrage sie nicht, die würden schon genug Leute in ihr Zuhause schleppen.
Aber als ich beim Stall anlange, bin ich froh, noch einmal hier zu sein. Sultan schnaubt, als er mich sieht, und lässt die Unterlippe vibrieren. Traurig vergrabe ich meine Hände in seiner weißen Mähne und quittiere sein Schnauben mit einem Seufzer. Sein Hals ist warm, feucht. Meine Wange passt perfekt da hin.
Ich brauche mich nicht umzuschauen. Die Laufboxen von Queenie und Max sind bereits leer. Nur noch Sultan wartet auf seinen Abtransport. Danach werde ich kein Pflegepferd mehr haben.
Der vertraute Geruch von Lederfett, Heu und Pferdefutter, der in der Luft hängt, besänftigt mich. Ich beginne mir ein Szenario auszumalen, in dem Sultan hierbleiben kann …
Ich sollte besser höflich sein, ich weiß. Aber ich befinde mich gerade mitten in einer Szene voller ewiger Treueschwüre, als Sultans neue Besitzerin, Isabell, hinter den Strohballen auftaucht. Die Frau, die ihn mir wegnehmen wird, die Frau, an die mein Pflegepferd verkauft worden ist. Isabell hat diese scharfgeschnittenen Augen und darin das Blitzen der Mehrmächtigen, aber offenbar überlegt sie es sich anders. Sie nickt mir kurz zu. (Sehr kurz. Ich kann eine Duldung von einer Einladung unterscheiden.) Mir bleiben nur noch wenige Momente. Schweren Herzens verabschiede ich mich in dieser Woche zum zweiten Mal offiziell von Sultan und zum hundertsten Mal inoffiziell, felsenfest davon überzeugt, dass hier ein Paar auseinandergerissen wird, wie es die Welt nie wieder sehen wird.
Dann mache ich mich endgültig auf den Heimweg. Früher oder später werde ich mich ihr ja doch stellen müssen, meiner Mutter. Nach einem prüfenden Blick in den Spiegel. Sonst sieht sie mir meinen Ärger gleich an. Darin unterscheiden wir uns nämlich nicht. Wir merken immer, wenn etwas in der anderen vor sich geht. Fast schon gespenstisch.
Das Erste, was mir entgegenschlägt, ist gelb. Dann schießen mir in rascher Folge durch den Kopf: Wand und Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Zusammen ergibt es das heutige Werk meiner Mutter: eine lichtecht bemalte Esszimmerwand in einer Wildwestfarbe, einem Sandsturmgelb, einem …
„Ocker!“, ruft meine Mutter heiter aus. „Die Farbe des Lichts und der Bodenverbundenheit. Die Farbe, die Himmel und Erde vereint.“
„Aha“, erwidere ich und schnappe gerade noch den belustigten Blick meiner älteren Schwester Belinda auf, „und wozu brauchen wir das? Eine Verbindung von Himmel und Erde?“
„Ach, Antonia.“ Jetzt tanzt sie um mich herum und deutet mit der Hand eine Streichelbewegung über meinen Kopf an. (Meine Mutter darf mich schon lange nicht mehr berühren.) Missmutig beobachte ich sie dabei, wie sie Teller (ist das Geschirr etwa neu? Gelb?) auf papiernen Tischsets platziert, als verteile sie Hostien an Gläubige. Mir entgeht nichts. Auch nicht, dass sie ihre Westernstiefelchen in der Wohnung anbehalten hat. Schuhe in der Wohnung anbehalten. Das hat jede von uns nur einmal zu tun gewagt. Belinda mit ihren Plateausohlen-Lederstiefeln am Tag der Street Parade, Pippa mit ihren Lackschuhen und ich mit meinen Reitstiefeln. (Stiefel, die ich am liebsten gar nie ausgezogen hätte, verbinden sie mich doch mit Sultan und seiner unverbrüchlichen Liebe zu mir. Mehr Bodenhaftung ist gar nicht möglich. Aber von einer solchen Verbundenheit kann Angi nur träumen.) Jedes Mal gab es Gezeter. Aber sie? Jetzt? Hat Westernstiefelchen an. Mit einem flüchtigen Blick nehme ich Pippa wahr, die ihre zwei Meerschweinchen unter ihre Nackenhaare krabbeln lässt. Pippa ist elf, benimmt sich wie acht und schaut gerade zum hundertsten Mal eine Kindersendung an, die ich strunzdumm finde.
„Mach dich hübsch, Toni, wir bekommen Besuch.“
„Aha.“
Der strafende Blick von Belinda entgeht mir nicht. Mit den Lippen formt sie Worte, die ich ablesen soll, aber dafür bin ich zu verärgert. Was soll der Zirkus?
Wie lange ist es her, dass meine Mutter alle zwei Minuten zum Fenster gerannt ist, den Vorhang zurückgezogen hat und ins spärlicher werdende Licht gesperbert hat? Wie lange, dass ein gewisser Massimo Esposito dann doch nur auf einer Vespa angetuckert kam, anstatt in einem Tesla? Oder in einem Lexus, wenigstens in einem Lexus? Er habe ihr was vorgemacht, war der Schluss, ein hundsgemeiner Betrüger. Massimo Esposito, Chefchirurg einer Vorstadtklinik, schrumpelte ultraschnell zu der Schnecke zusammen, die er war. Verkappter Medizinstudent. Schleimiges Aas, oder etwas in der Art hat Angi ihm nachgerufen. Das war nach nur zwei Tagen. Ein so kurzer Aufenthalt auf dem Olymp war noch keinem beschert. Die meisten bleiben länger auf dem Podest, bevor sie fallen.
Und was war mit der Wand damals? War sie blau? Silbergrau? Bordeaux? Die Teller? Aus Porzellan? Goldgerändert?
„Er hat Pferde“, sagt Belinda in diesem Zischelzaschel, das typisch ist für ihr betontes Flüstern, „ein ganzes Gestüt, Toni!“ Ich verdrehe die Augen. Zu spät. Meine Mutter hat es schon gesehen. „Er ist ein richtiger Züchter, Antonia! Er wohnt inmitten einer riesigen Pferdeherde, stell dir vor!“
Dass meine Schwester und meine Mutter die Worte ins Unendliche dehnen, nervt mich wahnsinnig. Dafür habe ich heute keine Zeit. Es ist Wochenende. Ich gehe nach hinten zu meinem Zimmer und sperre mit meinem Schlüssel das Vorhängeschloss auf.
Eine Stunde später erscheint er. Der Messias des Monats.
Ich habe ja schon einige Supermänner bei uns catwalken sehen. Aber dieser hier toppt alles. Viel zu jung! Schottenkarohose? Zweifarbiges Kragenhemd? Gucci Aktenmappe. Rolex. Breite Hosenträger. Und Gel. Mehr Gel als Haare auf dem Kopf.
Meine Mutter leuchtet nur für ihn, als sie uns ihm vorstellt: „Das sind Belinda, meine Älteste, eine Beauty-Bloggerin“, (hier erwartet sie ein Kompliment von der Sorte: Man sieht ja kaum, wer die Mutter, wer die Tochter ist!, was für einmal, dankenswerterweise, ausbleibt), „und das ist meine Mittlere, Antonia, sie ist vierzehn“, (vierzehn-dreiviertel, wenn mans genau nimmt), „und diese junge Dame hier ist Philippa, mein Nesthäkchen. Und hier, meine Lieben“, ihr Leuchten erreicht das hohe C der Lichtstärke, „hier seht ihr Charles Feodor Blavatsky.“ Das leicht verzögerte Anheben seines linken Mundwinkels, das auf sein Kieferknacken folgt, kann ich nur siegesgewiss nennen. Seine Augen sind kohlschwarz und groß. Es schwingt etwas Machtvolles mit. Aus jeder Pore einzeln verströmt dieser Charles Federboa Blabla Zuversicht auf irgendeinen Hauptgewinn. Wir mustern uns, er jetzt doch noch lächelnd wie ein Hundewelpe. Betont lieb. (Ich schwörs, ich seh ihn wedeln.)
Kapitel zwei
Die Samstagmorgen gehören eigentlich Emmis Familie. Irgendwann zwischen neun und zehn tauche ich bei ihnen auf und dann begehen wir den traditionellen Brunch. Emmis Adoptivmutter Karen holt den frisch gebackenen Zopf aus dem Ofen, ihr Adoptivvater Hanns-Holger schneidet Früchte zu kunstvollen geometrischen Formen für das Müsli zurecht. Wir trinken Mate-Tee oder irgendeine Bioladenentdeckung, die Karen und Hanns-Holger heiter je für sich reklamieren, wozu sie einen verbalen Boxkampf austragen. Aber vor allem hocken und schwatzen wir stundenlang.
Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal bei den Petersens eingeladen war, damals zu einem Mittagessen, in der vierten Klasse. Ich staunte darüber, wie die miteinander reden. Das waren richtige Gespräche. Mit Frage und Antwort und so weiter, man hörte einander zu und ging aufeinander ein, wie Karen dazu sagt. Mich hat das geplättet.
Meine Mutter fragt mich nie Dinge wie: Wie wars in der Schule? Was habt ihr heute gemacht? Und wie gehts dir gerade? Woher sie weiß, dass ich Filmregisseurin werden will, ist mir ein Rätsel. Habe ich ihr das gesagt?
Unsere Gespräche drehen sich nämlich eher um ihre Lockenwickler (wenn sie ihre Spaghettihaare, mit denen die Natur sie gestraft hat, in Szene setzen will). Oder um Haushaltsarbeiten, die sie von uns erwartet (Belinda ist dem Staubsauger zugeteilt, ich dem Staubwedel. Pippa kümmert sich um ihre Meerschweinchen. Belinda wäscht ab, ich trockne und räume das Geschirr weg. Pippa kümmert sich um ihre Meerschweinchen. Wer für das wöchentliche Schrubben der Badewanne und das Abfallhinaustragen verantwortlich ist, haben wir noch nicht abschließend geklärt, wobei Pippa schon von vornherein als Siegerin feststeht: Sie hat sich um ihre Meerschweinchen zu kümmern). Oder wir versichern unserer Mutter, dass sie eine ganz tolle Fish-Sticks-Köchin ist, und dass Gefrierspinat gesund ist, die Vitamine springen einen doch schon an, wenn er aus dem Beutel flutscht. Und freitags Reissalat? Wer könnte ihn besser mit steinharten Rosinen anreichern als sie?
Ehrlich gesagt, sind wir schon zufrieden, wenn überhaupt etwas auf dem Tisch steht. Wenn sich unsere Mutter in ihrem komplizierten, wie sie sagt ausgeklügelten Zeitplan, den sie nach einem Tipp einer Selbsthilfegruppeleiterin auf einem Blatt Papier festgehalten hat, zurechtfindet und sich um fünf vor zwölf in die Küche begibt. Damit wir nicht zum Mittagskiosk müssen. Damit wir von der Schule kurz nach Hause kommen können, weil eine SMS piepst: Essen steht auf dem Tisch! Wenigstens einmal die Woche. Irgendetwas findet sich immer im Kühlschrank. Und dass sie daraus zaubert, bestätigen wir ihr reihum, an den Tagen, an denen sie es nötig hat. Ihre Schulterhaltung gilt da allgemein als Abbild ihrer Psyche. Ein Schauspiel, wenn wir den Schüttkorb unserer Komplimente über ihr ausleeren.
Nur, dass ich das leid bin.
Nur, dass ich an Wochenenden zu Emmi, Karen und Hanns-Holger gehe.
Nur, dass ich nicht mehr die Retterin sein will für sie.
Als ich an diesem Samstagmorgen ins Esszimmer komme (eigentlich will ich nur ein Glas Wasser trinken), wappne ich mich innerlich gegen die Wucht der farblichen Verpaarung von Himmel und Erde.
Die Erwartung, meine Mutter so früh am Morgen nicht anzutreffen, erfüllt sich nicht. Ich überrasche sie dabei, wie sie in einem durchsichtigen Teilchen den Tisch deckt. (Dieses Teilchen kenne ich seit seinem ersten Tag, damals war es noch nicht ausgeleiert. Jahre her.) In seiner hellblauen Einsatzfreude wirkt es auf mich allemal albern. Ich jedenfalls werde mich nie für irgendeinen Macker so herausputzen. Wer meine Reitstiefel nicht erträgt, hat in meinem Leben nichts zu suchen. Mögen sie noch so verkrustet sein.
Eins, zwei, drei, vier, ich zähle fünf Gedecke.
Keine Chance, dass sie mich ziehen lässt.
Weil ich keine Lust habe, mit ihr zu reden, beschränke ich meine heutige Freundlichkeit auf ein Nicken.
„Oh, Antonia! Würdest du bitte kurz zum Bäcker laufen und uns frische Brötchen holen?“
Ich bin noch nicht mal richtig angezogen!
Ich bin eben erst aufgestanden!
Ich entscheide mich für Option drei: „Wo hast du das Geld?“
„Ist keins mehr in der Kaffeedose?“
„Seit Äonen nicht mehr.“ Die erste Wahl. (Ein Fehler.) Zur Verfügung gestanden wären noch Das hast du längst verpulvert und War da je welches? Wie vorausgesehen, reagiert meine Mutter unwirsch. Äonen. Das erträgt sie nicht. Ich deutsche also aus für sie und bleibe dabei sogar im Rahmen: „Die Dose ist seit Ewigkeiten nicht mehr aufgefüllt worden.“
„Oh!“ Ihre Hände flattern. Ihr Teilchen flattert. Meine ganze Mutter flattert aufgeregt durch die Küche, das Wohnzimmer, das Esszimmer (so viel zur Verbindung von Erdenschwere und Himmelszelt), „Oh – dann bring mir mein Portemonnaie, da muss noch etwas sein.“
„Äh“, druckse ich herum, „dein Portemonnaie ist in deiner Tasche. Und deine Tasche vermute ich jetzt mal in deinem Zimmer, wo offensichtlich noch“, ich erlaube mir eine vage Andeutung auf ihre Montur, „jemand schläft?“
Sie lacht ihr nervöses Lachen. Ich kann meine Mutter so leicht verunsichern, dass es mir nicht geheuer ist. Wenn ich will, habe ich sie voll im Griff.
Sie probiert es trotzdem: „Toni, das macht Charlie doch nichts aus! Er ist nicht verklemmt! Bring mir mein Portemonnaie, damit wir frühstücken können!“
Betont langsam lehne ich meinen Rücken an das Ockerbündnis und verschränke meine Arme unter der Brust.
Sie wischt an mir vorbei und ruft nach Belinda. Zu mir sagt sie: „Dass du auch immer gleich so eifersüchtig bist, wenn ich einmal jemanden für mich habe!“
Das trifft die Sache ziemlich weit vom Kern.
Das trifft voll ins Leere.
Meine Mutter ist felsenfest davon überzeugt, dass ich ihr ihre Freunde madig mache aufgrund einer tief sitzenden Eifersucht. Weil ich ohne Vater aufwachse und partout einen Mann in meinem Leben brauche. Ihr beibringen zu wollen, dass für mich vollkommen andere Sachen wichtig sind, habe ich aufgegeben. Sie glaubt mir, wenn sie frisch verliebt ist, ohnehin nichts. Dass uns alle drei Väter nach einer gewissen Zeit, in der wir sie auf dem Sockel zu bewundern hatten, auf den meine Mutter jeden ihrer Männer stellt, verlassen haben, vergisst sie großzügig. Dabei will, soviel ich weiß, keine von uns einen Mann in ihrem Leben. Und schon gar nicht einen von der Sorte, die wieder abhaut. Alle drei haben sie das Weite gesucht und meine Mutter damit in ihrem Standpunkt bestärkt, in ihrem Urteil, das sie jedem um die Ohren haut: „Es gibt keine guten Männer mehr.“ Davon ist sie wenigstens so lange überzeugt, bis sie der Welt (und uns!) ein neues Exemplar präsentiert. Dann fängt das Trauerspiel von vorne an. Entweder Held auf Podest oder Schurke. Ein Dazwischen gibt es nicht. Und irgendwann verwandelt sich jeder Held in einen Schurken, das Leben ist kein Film. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich das verabscheue. Es gibt keine Worte dafür. Wenn man ihr Urteil nämlich zu Ende denkt, heißt es, kein anderes Leben leben zu können als sie.
Belinda reibt sich die Augen. Ihre langen honigblonden Haare stehen ihr elektrisiert vom Kopf. Sie gähnt. Meine Mutter treibt sie zur Eile an.
Übel gelaunt denke ich an all die vergangenen Weihnachten, an denen meine Mutter ihren Eltern einen neuen Freund vorgestellt hat. Den falschen Yoga-Meister (ein arbeitsloser Zeitschriftenverkäufer). Den falschen Tierforscher (ein Verkäufer in einer Zoohandlung). Den falschen Stararchitekten (ein Fantast). Jedes Weihnachtsfest ein anderer Götterbote an ihrer Seite. Jungschriftsteller. Tangolehrer (Pippas Papi). Jedes Jahr ein Neuer, so sicher wie in einer Comedy der Running Gag, nur, dass das bei uns in einer Tragödie und meine Mutter in einer Heulphase endet. Immer. Jedes einzelne Mal.
Die beiden gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. (Warum denkt eigentlich nie jemand an das Dritte, den Rand? Ich denke an den Rand. – Es muss einfach noch eine dritte Möglichkeit geben zwischen Auf und Ab).
Ich rede mir ein, dass der Aktuelle spätestens übernächste Weihnachten in der Versenkung verschwunden sein wird. Dieser Held. Dieser zukünftige Schurke. Dieser Hauptdarsteller … mir bleibt die Spucke weg: Charles Feodor Blavatsky steht in einer pinkfarbenen Unterhose vor mir und kratzt sich auf dem gelverklebten Kopf. „Äh…“, sagt er.
„Morgen.“
„Du bist die Mittlere, stimmts?“
Ich bin die berühmte Filmregisseurin der Zukunft.
Oscar-Preisträgerin to be.
Ich bin …
… „Jepp.“
Kratz, kratz. Ich weiche nicht von der Stelle. Sein Blick ist dösig.
Dass ich ihn nicht mag, hab ich längst beschlossen.
Ich sehe deine Zukunft, Komparse, denke ich.
„Du bist die, die reitet?“
„Jepp.“
Kratz, kratz. Dann ein Schieflegen des Kopfes: „Tut mir leid, mit deinem Pferd.“
Ich überlege, ob Angi ihm von Sultan erzählt hat.
„Muss ein herber Verlust sein, das eigene Pferd. Und dann noch Zuchthengst.“
Danke, danke, danke Seb! Dank dir verliere ich jetzt nicht die Fassung. Ich sage, indem ich den Blick senke: „Hm-mh.“ Wenn meine Mutter will, dass er an einen Zuchthengst glaubt, soll er das.
Wie sich herausstellt, hat Charlie (du kannst ruhig Charlie zu mir sagen, Charlie sagen alle meine Freunde zu mir) doch keine Pferdezucht. Sein Haus steht nicht inmitten einer übers Grasland ziehenden Herde, und als Hobby, das er zum Ausgleich zu seinem stressigen Versicherungsjob braucht, geht er squashen. Die ganze Pferdesache beschränkt sich darauf, dass seine Eltern oder deren Eltern, so genau habe ich das nicht verstanden, weil meine Mutter auftauchte und lauter kleine bestätigende Laute in unser Gespräch warf und dazu klatschte, dass also irgendjemand in seiner weitverzweigten ehemals russischen Verwandtschaft auf einem Gehöft mit Pferdezucht aufgewachsen war.
Aha.
Soso.
Das also.
„Achal-Tekkiner? Baschkiren? Don?“, frage ich ihn beim Frühstück dann doch giftig. Aber er sagt nur: „Hä?“, dann wird er von Angi abgelenkt. Sie erzählt ihm von ihrer eigenen Kindheit, die sie, was mir völlig neu ist, zum Teil ebenfalls in Russland verbracht haben will. Belinda mampft und sperrt Augen und Ohren auf. Pippa merkt wieder gar nichts, und ich beginne in mich hineinzufuttern, obwohl ich längst satt bin. Zum Glück bin ich eine schlechte Verwerterin. Wenn meine Mutter Dinge aus ihrem Leben zum Besten gibt, von denen ich keine Ahnung habe und deren Wahrheitsgehalt ich, gelinde gesagt, anzweifle, löst das in mir immer so ein komisches Gefühl aus. Mund zustopfen. Damit ich nicht schreie. Sie ist einsame Spitze darin, Begebenheiten auszuschmücken. Meist macht sie das, wenn es sich um schreckliche Ereignisse handelt, zum Beispiel, als sie dem falschen Tierforscher weismachte, sie habe eine Zeit lang in Florida gelebt und dort Alligatoren mit der Flasche großgezogen. Die habe dann aber ein gewissenloser Tierparkbesitzer bestialisch geschlachtet und den Touristen als argentinisches Rind aufgetischt. Angi schwadronierte von ausgerissenen Beinen. Gebrochenen Kiefern. Und Zähnen als Souvenir. (An all die Details rund ums Schlachten möchte ich mich gar nicht erinnern.)
Manchmal macht sie das aber auch bei Schönem. Details auftischen. Fakten frisieren. Eigentlich kann man sich bei Angi nie sicher sein, wann und wo die nächste Ungereimtheit beginnt. Das ist etwas, was mich verrückt macht. Ich bekomme davon Chaos im Kopf. Ich meine, ich weiß einfach, dass meine Mutter nie in Florida gelebt hat. Aber bei konkretem Nachfragen wird sie sauer. Und dann schreit sie oder heult oder schmeißt mit Dingen um sich. Danach ist sie tagelang beleidigt. (Meine Mutter kann sehr nachtragend sein.) Ich habe mir angewöhnt, zuzuhören, die Zahlen von eins bis hundert in meinem Mund zu zermalmen und die Lippen geschlossen zu halten. Oder zu essen. Das funktioniert. „Schlucks runter“, sagt auch Emmi. Und bis das mit Sebs Eltern geschah, hatte auch er hin und wieder ein aufmunterndes Wort für mich.
Ich wünschte nur, dieser Charlie hätte seinen Mund gehalten. Dann hätte er meine kindische Hoffnung wenigstens nicht zerstört. Dann wäre die Illusion noch als Möglichkeit im Raum …, ein Pferdezüchter in der Familie. Jetzt, wo Sultan abtransportiert wird. Offenbar gelingt es meiner Mutter immer noch, Hoffnung in mir zu wecken.
Ich spüre den Schmerz wie üblich mit Verspätung.
Charlie redet unbeirrt und – wie es scheint – begeistert über sich selbst. Über sein Dasein in der Welt, die voller Licht und Liebe sei, sein Hiersein mit uns vier Goldigen, (nichts an mir ist goldig, nicht ein Fitzelchen. Da komme ich nach meinem schurkischen Vater, sorry, mein Haar ist nussbraun!), redet über die tiefer liegende Philosophie von Status, Aufstieg und über die grenzenlosen Möglichkeiten seines Gehalts (da gibt es kein Limit, Angi, uns sind keinerlei Grenzen gesetzt! Wir werden logieren und dinieren wie die Götter im Olymp!)
Da tun sich ja ganz neue Dimensionen auf.
Cut!
Die Äußerung meiner älteren Schwester holt mich zurück. Seit wann weiß sie über Hummer und Meeresfrüchte Bescheid? Charlies Blick knistert, als er von einem Austernbuffet erzählt und Belinda munter nickt. Betont selbstbewusst verschließt meine Mutter den veilchenblauen Morgenmantel über ihrer linken Brust, die sich auf unerklärliche Weise grad eben von allein in die Freiheit befördert hat. Und lächelt. Meine Mutter lächelt voller Glückseligkeit. Auf ihrer Stirn steht geschrieben: Ein Muschelkenner! Jetzt wird alles gut.
Mir wird speiübel.
Mir wird das jetzt zu viel. Gleich zwei, die auf diese Gelkappe abfahren.
Ich stehe auf und marschiere in mein Zimmer.