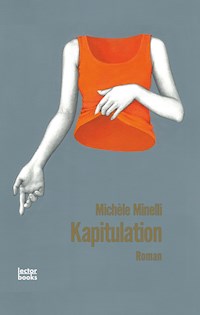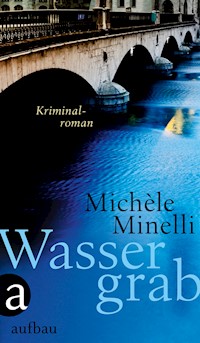Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Salis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Als die junge Lili bei ihrem großen Idol, dem Schriftsteller Noah Berger, klingelt, rechnet sie mit allem, nur nicht mit dessen zweiter Frau Sonja. Egal, wie sehr sie es will, Lili wird nicht zu Noah durchgelassen. Immer wieder probiert sie es, immer neue Ausreden hat Sonja parat. Und so beginnt Lili heimlich, einen Roman über das Paar zu schreiben. Doch was hat ihre Geschichte von Flurin und Cristina noch mit den Vorbildern Sonja und Noah Berger zu tun? Und spiegelt sich da nicht auch Lilis eigene, belastete Beziehung? Was ist Wirklichkeit, was Fiktion? Michèle Minelli öffnet in ihrem neuen Roman subtil und klug mehrere Ebenen des Geschichtenerzählens. "Der Garten der anderen" handelt von neuen und alten Beziehungen, von den Möglichkeiten der Fiktion, von der Macht der Sprache und nicht zuletzt vom Glück in einem fremden Garten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MICHÈLE MINELLI
DER GARTENDER ANDEREN
ROMAN
Wir danken der Gemeinde Uesslingen-Buch, der Stadt Zürich und dem Kanton Zürich für die Unterstützung dieses Buches.
Der Salis Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
Michèle Minelli
Der Garten der anderen
Roman
Verlag
Salis Verlag AG, Zürich
www.salisverlag.com
Lektorat und Korrektorat
Patrick Schär für www.torat.ch
Satz
Peter Löffelholz für www.torat.ch
Umschlaggestaltung
André Gstettenhofer für www.torat.ch
Foto Umschlag
markmedcalf, Adobe Stock
Foto Autorin
Anne Bürgisser
1. Auflage 2018
© 2018, Salis Verlag AG
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-906195-73-5
Für Lisa, Diana und Anne
Inhalt
DAS LEBEN, DAS WIR FÜHRTEN
BLEIB!
ALLES, WAS WIR NIEMALS WOLLTEN
DAS VERSPRECHEN VON GLÜCK
ANMERKUNG DER AUTORIN
DANK
ZUR AUTORIN
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
The Road Not Taken, Robert Frost, 1916
DAS LEBEN, DAS WIR FÜHRTEN
Wie viel Glück steht einem zu? Und wenn man aus dem Vollen schöpft, nimmt man dann von einem anderen weg?
Im Moment sieht der Spielstand traurig aus. Ich schaue dich an. Du siehst mich nicht, aber ich bin da, oben, im ersten Stock stehe ich am Fenster und schaue dich an. Wieder bin ich überrascht, wie du dich einer Blume entgegenbeugst. Sie scheint zu duften, ich vermute in deinem Gesicht das Lächeln, mit dem ich mich an dich erinnerte die letzten zwanzig Jahre.
Wieder und einmal mehr beugst du dich einer Blume entgegen, und ich denke: Von dir möchte ich das Leben lernen.
Hinter meinem Rücken wedle ich ihn mit den Händen fort. Ich will nicht, dass er mit laufendem Motor wartet. Ich will, dass er verschwindet. Er lässt den Landy aufheulen, was mich nervt. Das intakte Rücklicht taucht in einen Bausch Morgennebel. Tschüss, Fred, wir sehen uns heute Abend.
Die Windwacht ist ein über hundertjähriges Bauernhaus. Fachwerk, ostseits geschindelt, Ziegeldach. Der Winter knarrt und schabt an dem Gebäude, der Wind fährt ihm zwischen Mauer und Läden und trommelt dort. Im Sommer muss es eine Pracht sein. Eine Clematis bis ganz oben. Die vertrockneten Blütenstände der Hortensien, mit eisigem Hauch überzogen, still. Links und rechts der Treppe sehe ich vom Schnee gebückte Schattenpflanzen, die kurzen vielleicht ehemals Leberblümchen, die großen Silberblatt. Um das Kellerfenster – ich nehme an, es ist ein Kellerfenster – zeugen kleine Füßchen an der Wand von Efeu, der hier einmal gerankt hat. Verbliebene Haftwurzeln als Zeichen der Zeit. Es sieht so aus, als ob jemand mit einem Hochdruckreiniger versucht hat, die Reste zu entfernen, Teile des Verputzes abgesprengt. Hinter mir rauscht eine Schneewechte vom Dach einer Scheune. Herrgott, was für ein Geräusch! Vorsichtshalber blicke ich den knorrigen Baum zu meiner Linken hoch bis in sein oberstes Geäst. Eine Mehlbeere. Die Vögel haben ein paar der korallenroten Früchte übrig gelassen; gescheite Natur.
Keiner auf der Straße bei diesem Wetter, um diese frühe Zeit. Nichts bewegt sich. Nirgends niemand, nur die Stille steigt um mich himmelwärts. Aber ich bin mir ganz sicher, ich habe jemanden im Haus gehört. Ich halte meinen Daumen länger auf die Klingel; ich will, dass das hier funktioniert.
Im oberen Stock ein Vorhang, der zuckt. Ich bleibe eisern. Von jener Sturheit, die Fred an mir hasst. Ich stampfe mir den Schnee von den Bootys. Hohler Rückhall von der Scheunenwand. Neben der Tür steht ein kleiner Besen. Wenn Noah mir öffnet, werde ich mir damit vor seinen Augen die Schuhe reinigen. Das wird Eindruck machen. Plötzlich muss ich an den Dachsbau denken, den wir beim Hochfahren durch die Reben im Hang gesehen haben. Halten Dachse Winterschlaf? Ein Riesenloch, geformt wie ein Strudel, im Wurzelwerk einer Eiche. Wie viele Kammern hat so ein Bau? In irgendeiner dieser Kammern versteckt er sich. Vielleicht ist sein Kopf wie der Kopf eines Dachses: schwarz-weiß. Ich habe im Internet keine aktuellen Bilder gefunden, vielleicht ist sein dichtes schwarzes Haar durchsichtige Firnis geworden, Wachs oder Schlick. Vierundneunzig Jahre. Aber ich bin mir sicher, ich habe den Vorhang zittern sehen, da war jemand, und jetzt ist mir wirklich kalt. Seit ich erfahren habe, dass er hier wohnt, nur wenige Kilometer von mir entfernt, weiß ich, doch, das muss ein Zeichen sein, eine Botschaft von ihm an mich. So etwas kann kein Zufall sein.
Unablässig taumeln mir Flocken ins Haar, die Winterwelt um mich herum ist überzogen von Trillionen von Miniaturkatarakten. Ich muss dringend pinkeln. Dabei hat Fred behauptet, Winter gebe es hier oben keine, Winter, das sei eine Erinnerung an Stiefelgröße 28, ordentliche Winter habe er seit Kindertagen nicht mehr erlebt.
Vielleicht war das eine Schnapsidee. Ich lecke meine Handinnenseite. Rücke meine Wirbelsäule zurecht. Verwische den Film in der Luft. Halte mir die leicht klebrige Fläche an die Nase. Coolmint. Listerine, alles klar. Ich will keinen Mundgeruch bei unserer ersten Begegnung haben. Nur gegen den säuerlichen Geruch meiner Haut komme ich nicht an. Pepsodentlächelnprobe. Ich warte weiter. Herrgott, diese Bise ist unerbittlich.
Wenn ich jetzt wieder nach Hause gehen muss, mit diesen blöden Schlupfstiefeln. Wenn ich –
Die Tür öffnet sich in einem Schwung, und vor mir steht eine Frau in Hosen, Schürze und Hemd; ein farbloser Zopf hängt ihr müde über die Schulter. Wir verfangen uns in einem Blickduell. Sofort präsentiere ich mich mit meinen ganzen einhundertneunundfünfzig Zentimetern, und wie die Alte da schaut, bin ich mir meines Aufzugs bewusst, meiner lila Schlupfstiefel, meiner pinken Alpakawollstulpen, meines knielangen isländisch gemusterten Strickmantels in Blau, Gelb und Pink, meiner überdimensionalen Schultertasche, und wer weiß, vielleicht kleben mir auch Schneeflocken in den getuschten Wimpern, Rehblick im Winter, laufen schwarze Mascaratränen aus meinen Augen die Wange hinunter, bin ich gar nicht so tadellos, wie ich mir das für die Begegnung mit Noah Berger vorgestellt habe. Ich strecke dieser Dienstmagd, Köchin, Haushaltshilfe meine Hand entgegen, die, die noch im Fäustling steckt, und formuliere überzeugt munter, überzeugt glatt: »Ich bin Lili. Ich möchte bitte zu Noah Berger. Ist er da?«
Sie lässt ihre Hände unten. Zunächst ist alles, was ich denken kann: Das darf jetzt aber nicht wahr sein, das geht nicht, die muss mich zu Noah lassen, ich friere mir den Arsch schwarz, so kurz vor meinem Ziel, aber dann macht sie einen Schritt zur Seite und öffnet mir die Tür ganz.
Ich atme aus. Sie dreht sich von mir ab und verschwindet im Flur um die Ecke.
Als ich ihre Stimme höre, ist sie wie ein eigenständiges Wesen, eine autonome Klangwelle, die sich zu mir schlängelt, laut, klar, ruhig. Ihr nach folgt die weißhaarig Gezopfte, ein Paar Filzpantoffeln, einer an jeder Hand, und dann erst verstehe ich, was sie sagt: »Deine Zehen müssen halb erfroren sein. Diese Größe dürfte passen.« Ich fühle mich wie Aschenputtel. »Das ist ein zu grimmiges Wetter, um draußen in der Kälte zu stehen. Es tut mir leid, dass ich dich so lange habe warten lassen. War das Fred, der dich hergefahren hat?«
Natürlich. Wer kennt Fred nicht. Alfred C. Fenner, den Rucksacklandwirt, Fred, das Rucksackmitglied des Gemeinderats, Fred, dessen Familie seit ungezählten Generationen – wir reichen bis zu den erstbekannten Schenkungsurkunden im 11. Jahrhundert zurück, ein Vorfahre mit Namen Erlewin steht verewigt, und in unserer Familienchronik etc. pp. blabla – hier wurzelt. Im Winter bedient Fred den Schneepflug der Transportfirma, für die er als Fahrer arbeitet. Rumpelt die Dutzendschaft der Orte ab, die von dieser Gemeinde zusammengeklammert werden, je nach Zählweise Weiler oder Dorf, die eine Wirtschaft haben, nennt man Dorf, sagt Fred, weckt die Schlafenden auf mit seinem mächtigen Getriebe. Aus irgendeinem Grund bleiben die Worte in meinem Hals stecken, also zerdrücke ich sie zu einem »M-hm.«
»Ich dachte mir, dass das sein Land Rover ist.«
»Darf ich kurz Ihr Klo benutzen?«
Wie konnte ich da nicht dran denken, dass auf dem Land alle über jedes Bescheid wissen und jeder alles weiß! Ein Dreivierteljahr hier, und noch immer nichts kapiert. Und als ob sie das verstanden hätte, als ob ich das eben laut gedacht hätte, sagt sie, als ich wieder vor ihr stehe und mir die Eisspitzen aus den Fingern knete: »Egal wie lange, als Zugezogene bleibt man hier ewig fremd.« Altersflecken auf der Hand. »Ich bin Sonja.« Händedruck wie ein Mann. »Komm doch rein, ich bin spät dran. Ich muss endlich Feuer machen.« Seufzen.
Eine Ostmagd ist das keine.
Ich stehe unbeholfen in ihrer kalten Küche, drücke meine Zehen gegen den Filz und schaue ihr, langer gerader Rücken, schweigend zu, wie sie den Ofen füllt. Aus einem Stapel zieht sie Äste und legt sie in den Brennraum. Sorgfältig schiebt sie Reisigbüschel und dann wieder einzelnes Geäst dazwischen und schichtet schließlich sechs Hartholzprügel auf. Das erste Streichholz, das sie anreißt, erlischt sofort. Beim zweiten fängt das Reisig Feuer. Erneutes Seufzen. Langer Rücken. Ich warte, bis sie die Ofentür schließt und die Lüftungsklappe richtet. Die Küche füllt sich mit warmem Holzgeruch. Er ist wie etwas Organisches und wird zu einer dritten Entität im Raum.
Jetzt wäre ein Moment, aber sie kommt mir zuvor und sagt: »Lili, ja, sagst du? Lili, heute ist kein guter Tag für einen Besuch. Noah empfängt niemanden. Aber wie ich Fred kenne, kommt der so bald ja nicht zurück, und wenn du willst, trinken wir jetzt erst mal einen Tee.« Wieder betrachtet sie mich von oben bis unten, eindringlich, unheimlich das. Ihre Körpergröße flößt mir Angst ein. Alte Menschen haben ohnehin etwas Beunruhigendes. Sie machen Geräusche, die jungen Menschen fremd sind. Sie riechen anders. Sie bewegen sich unvorhersehbar, einzelne führen eine Unwucht in ihrem Schritt. Und sie tragen das Wissen vieler gelebter Jahre in sich, manche wie einen Triumph. Diese hier ganz besonders. Ich trau mich nicht, sie anzureden. Sage ich Du? Sie zu ihr?
Sie beginnt damit, Wasser aufzukochen. Tausendfach ausgeführte Griffe. Sie könnte blind sein. Ich schaue mich um und sehe alles zum ersten Mal. Die sanfte Unordnung in dieser Küche, ein Stapel altmodisch ozeanblauer Tassen auf der Anrichte, Edelstahlkochbesteck an einer Holzstrebe aufgehängt, Abtrocknungstücher, zwei, nein drei, übereinandergefaltet an einem Bügel, altmodisches Design, Einmachgläser, halb gefüllte und gefüllte, Schraubdeckel, Pinsel, Löffel. Eine Taschenlampe im Brotkrumenmosaik. Ungespülte Teller. Sie scheint sich dafür nicht zu schämen. Und langsam dämmert es mir. Sie ist überhaupt keine Magd, keine Angestellte. Sie ist Noahs Frau.
»Wärmer? Willst du mir nun deinen Mantel zum Aufhängen geben?«
Als sie zurückkommt, kocht das Wasser. Weil ich mit einem Mal so verwirrt bin – Fred habe ich weggescheucht, Noah Berger empfängt mich nicht, seine Frau Sonja kocht mir Wasser für Tee, den ich nicht will –, weil ich etwas zum mich dran Halten brauche, frage ich: »Kann ich helfen?«
Sie zeigt auf einen Küchenschrank und bittet mich, die bauchige blaue Kanne herauszuholen, die wohl ganz zuhinterst sei. »Die ist die größte.«
Ich höre ihre Stimme, wie sie murmelnd Teesorten gegeneinander abwägt, Eisenkraut nein, Lavendel nein, Johanniskraut ungeeignet, Kamille vielleicht, Rosmarin, Salbei … »Wie wäre es mit Melisse? Krampflösend und antiviral – bei diesem Wetter.«
»Eigene Ernte?«, frage ich tapfer. Ich bin noch immer enttäuscht, dass mir diese Alte den Zugang verwehrt.
»Sie wächst mir über beide Ohren.«
Sie sagt mir. Nicht uns. Ist es ihre Melisse? Noah Berger gärtnert doch noch? So stand es im Gemeindeblick, der uns vom Gemeindeamt kostenlos zugestellt wird mit den letzten Neuigkeiten zur traditionellen Holzersteigerung, dem Traktorpulling, dem Versetzen von Verkehrsberuhigungspollern vor dem Friedhofplatz. Dem unverzichtbaren Verkündungsorgan von hundertsten Geburtstagen – Emmi Fries feiert heute … – und Ehrungen – Michaela Zurbrüggen ist die 1111. Einwohnerin unserer Gemeinde. Dem Blättchen, das ich als Reingeschneite, fremder Fötzel, gründlich lese. Um mich informiert zu halten, mich zu integrieren. Um eine Chance zu haben in diesem Knoblauch-, Apfel- und Bauernland. Und da stand es, Schwarz auf Weiß in einem Beitrag, den die neue Gemeindeschreiberin Gerthuld Gisi verfasst hat, bei ihrer Rundschau für den Gemeindeblick, der Rubrik, die einzelne Bürgerinnen und Bürger herausstreicht, um den weniger wichtigen über sie zu berichten: 94 Jahre und Noah Berger gärtnert noch. Hätte da nicht ein Komma reingemusst? Ohne aktuelles Bild zwar, die beiden Fotografien, welche die Gemeindeschreiberin, dritte Tochter eines ebenfalls alteingesessenen Ortsgeschlechts, gewählt hat, zeigten das ewig gleiche Porträt, bekannt von seinen Büchern, und einen üppig blühenden Garten. Vielleicht ist Noah für die Blumen zuständig und sie für das Kraut.
Sie gießt das Wasser um und holt ein Einmachglas aus dem Kühlschrank. Als ich zwei der blauen Tassen greife und sie warm ausspüle, lächelt sie mich an. »Schlehdornmus. Ich streiche uns zum Tee ein paar Brote«, sagt sie schmunzelnd. Und jetzt erkenne ich die auftauenden Schlehen im Sieb, die Farbreste im Topf und lächle das erste Mal zurück. Sie sagt: »Ich war Kommunikationswissenschaftlerin, von Pflanzen hatte ich keine Ahnung, als ich damals hierhergezogen war.« Sie lacht. »Das habe ich alles von Noah gelernt. Deswegen bist du doch hier, oder?«
»Kann ich Du sagen?«
»Sicher.«
Ich überlege noch einen Moment, ob ich lügen soll. Dann aber sage ich, und es ist, als ob alle Fakten zugleich aus mir herausbrechen wollten, eine kleine Sturzflut von aufgeregten Worten, etwas, das gar nicht zu mir passt: »Ich bin eigentlich Lehrerin, also mein Erstberuf ist Oberstufenlehrerin, Phil. I, aber das ist nicht, was ich mache, ich habe eine Zweitausbildung absolviert zur Landschaftsgärtnerin, und jetzt arbeite ich für die Altherr GmbH, drüben im Loch, Teilzeit wenigstens, die kennst du sicher, die kennt jeder hier, aber deswegen bin ich nicht …, also natürlich schon ein bisschen, weil Noah ja auch gärtnert, so habe ich ihn schließlich kennengelernt, nicht ihn persönlich, meine ich, aber seine Bücher, allen voran Zaungespräche, und dann natürlich die späten Romane, die Heldengeschichte, nach dem Studium von Heldengeschichte war ich sogar selber einmal in Schottland, in einem Writing Retreat, aber es ist …, es war …, ich möchte Noah kennenlernen, weil: Ich schreibe nämlich auch.«
Die ganze gefasste Haltung: dahin. Wie kann ein Mensch, der sich so unbeholfen ausdrückt, behaupten, dass er schreibt?
Sie fragt nicht weiter.
Als ich zwei Stunden später zu Hause bin, fällt Anspannung von mir ab. Ich habe nicht gewusst, dass sie mich umfasst gehalten hat. Ich habe mich in Sonjas Küche gelöst gefühlt. Beim Verarbeiten der aufgetauten Schlehen ging ich ihr sogar etwas zur Hand. Danach, in der Stube, verströmte der Kachelofen heimelige Wärme, und mein Blick in den winterweißen Garten half mir über ihr Nein hinweg. Ich glaube, bereits nach dem ersten Schluck Tee habe ich tief durchgeatmet. Aber offenbar ist da doch ein Restchen Spannung verblieben, das mich jetzt erst entlässt. Obwohl sie gesagt hatte: »Dann erzähle eben ich dir alles, was ich weiß.« Eine lausige Rehabilitierung für Noahs Absenz.
Ich forsche im Internet. Sie scheint jemand zu sein, der sich rar darin macht. Oder jemand, der alle Einträge über sich hat löschen lassen. Ich finde nichts. Aus dem weltweiten Michgibtesrundgemälde hat sie sich hinausretouchiert, wie eine Figur, die man nach tieferer Überlegung aus einem Roman streicht, Szene für Szene, Satz für Satz. Vielleicht hat es damit zu tun, dass sie gesagt hat, sie möge das Internet und alles, was es mit sich bringt, nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ihr Exmann scheint ein IT-Pionier gewesen zu sein. Über ihn existieren Hunderte von Links, und auf mindestens einem davon sehe ich auf einem Foto neben ihm eine Frau, die eine sehr junge Version von Sonja sein könnte. Demnach wäre sie einst blond gewesen. Die Bildunterschrift nennt die beiden Personen Eheleute. Könnte sein. Muss nicht. Kann, wenn ich es will.
Es ist, als ob sie sich der virtuellen Welt verweigert. Zwei, drei Links, die auf berufliche Publikationen von ihr verweisen. Neunzehnhundertsoundso. Wie ist das in der Kommunikationswissenschaft: Veralten die Texte da? Gewinnt man ein Leben lang neue Erkenntnisse dazu? Muss man Inhalte umschreiben, wenn man dabeibleiben will?
Sie hat keinen Facebook-Account. Nichts auf Instagram. Kein LinkedIn, Twitter, Xing und auch keine eigene Homepage. Vielleicht besitzt sie noch nicht einmal ein Smartphone? Ich habe keins herumliegen sehen, und als meins klingelte, zuckte sie zusammen und ihr Rücken wurde steif. Abgesehen vom Poltern aus dem ersten Stock – ich komme nicht drauf, was das für ein Geräusch war – hüllte die Umgebung unser Gespräch in weiche Stille. Kein Radioplärren, nicht ein akustisches Signal. Obschon – ich kenne Menschen über siebzig, die mit sozialen Medien ebenso virtuos umgehen wie wir, diejenigen mit der Drei vornedran.
Ich muss immer wieder daran denken, was sie auf meine jämmerliche Frage, ein Moment der Unachtsamkeit, gesagt hat. »Zwanzig Seiten.« Da hat ihre Stimme jung geklungen, erstaunlich fest und melodiös, ein Mädchen, das kokettiert. »Und wenn du noch nicht sicher bist, schreib in Braun.« Alles, was Schwarz auf Weiß vor einem stehe, impliziere Endgültigkeit. »Lass deinen Entwurf atmen, schreib ihn lila, grün oder blau. Schenk deinen Gedanken diesen Spielraum, aber schreib zwanzig Seiten, besser sogar dreißig, wenn du es ernsthaft mit einer Geschichte probieren willst, sicher aber zwanzig, keine weniger als das.«
Ist das ein Trick der Kommunikationswissenschaft? Die Repetitio? Oder sollte das eine angedeutete Anapher sein? Hat sie das so gemacht bei ihren eigenen Büchern? Das Wesentliche wiederholt? Sie klingt wie ich damals vor meinen Schülern. Die erste Fassung hirschbraun tippen. Schreibt Noah hirschbraun? Oder schreibt er seine Erstfassungen von Hand?
Ich finde vier Titel von ihr, alle wissenschaftlich, alle nur noch antiquarisch aufzutreiben.
Ich hätte sie fragen sollen, ob das Noahs Arbeitsweise ist, braun oder grün, das würde zu ihm passen.
Es zieht. Ich stopfe noch mehr Tücher in den beschlagenen Hohlraum zwischen Vorfenster und Innenfenster. Ich hasse das. Greife mir eine zweite Wolljacke. Werde zu einem Michelin-Frauchen.
Tippe Buchstaben mit Fingern, die aus Handschuhen gucken, bei denen das letzte Fingerglied aufgetrennt ist. Es ist Freds freier Tag und damit auch meiner. Ich weiß, dass ich ungerecht bin, auch er muss sich an die neue Situation gewöhnen. Trotzdem fühle ich mich verletzt, dass er diesen Tag in der Traktorhalle verbringt. Was soll der Scheiß. Nur weil ich ihm gesagt habe: »Geh.«
Die Fläschchen und Tuben der Biopflegelinie meiner Freundin Milessa, welche ich als Gastgeschenk mitgeschleppt habe, habe ich Sonja auf den Küchentisch gestellt. Soll eben sie sie Noah geben. Dass Verpackungen zu einem sprechen, sagte sie, sei ihr noch nie aufgefallen. Vielleicht ist sie eine Anhängerin von Zero Waste, ohne dass sie davon weiß. Vielleicht war sie der Trendsetter, und jemand, der sie beobachtet hatte, hat eine neue Bewegung gegründet. Vielleicht streckte sie dem Verkäufer ihr Konservenglas hin, damit er ihr Joghurt hineinlöffelte, worauf sie das Glas zuschraubte und nach Hause trug. Vielleicht macht sie ihren Joghurt selbst.
Mir ist leicht übel bei dem Gedanken. Ich mag mich aber nicht von diesem Tisch fortbewegen, und ich will mich nicht übergeben! Zwanzig Seiten das Verdikt. Verhängt von einer ehemaligen Kommunikationswissenschaftlerin, einer Frau Prof. emerit.; wie alt mag Sonja sein? Ich schätze sie auf über siebzig. Siebzig Jahr, blondes Haar. Google findet aber auch wirklich gar nichts. Dabei war ihr erster Mann ein Computerlinguist, das hat sie gesagt, als ich meinen Laptop hervornahm. Einer der ersten Stunde, behauptet Google. Und ja! Über ihn entdecke ich viele Beiträge und unzählige Bilder. Eine Koryphäe muss er gewesen sein. So eine Berühmtheit wie Noah Berger auf seinem Gebiet oder dessen erste Frau, die Bühnenschauspielerin Claudette Mizzi. Seinerzeit.
Unser Gespräch beim Kachelofen. Chronik der linguistischen Annäherung. Zuletzt lachten wir. Weil ich ihre Wortwahl übernommen habe. Seinerzeit. Freilich. Klosett und Katzenmusik. Sprachliche Archaismen. Sie hat so etwas Mütterliches im Blick. Wohlwollend und prüfend.
Wie sicher sie mich zur Bushaltestelle gefahren hat in ihrem alten Volvo. »Gell, du musst Winken, wenn er kommt.« Schnee und Dreck ist von ihren Reifen gespritzt. Und auch ihr Auto: ein Rücklicht nur, das geht.
Wo bin ich hier gelandet?
Ein Dreivierteljahr, und noch immer nicht zu Hause. Ich löffle Schlehenmus. Auf meinem Tisch steht eine kleine Schüssel. Sie hat Wachspapier darübergespannt.
Vielleicht doch eine Zero-Waste-Anhängerin.
Ich suche weiter. Nutze alternative Suchmaschinen. Kehre zu Google zurück. Ich will eine Suchmaschine, die mit mir zusammenarbeitet. Denn jetzt habe ich angebissen. Ich will jetzt endlich: Glück.
Bevor das mit dem Salz begann, schwappte das Meer über die Brandungsmauer und spritzte zwischen den Eisenpollern hindurch, die schräg und wie aus der Tasche eines Riesen gefallene Zahnstocher kreuz und quer aus dem Wasser ragten. Die Luft war mild, und im Wasser wechselten sich überraschend kühle mit angenehm warmen Passagen ab, nie wusste sie, welcher Art die nächste Stelle sein würde, die sie mit ihrem Armschlag durchpflügte. Ein ferner Vogel pfiff in unregelmäßigen Abständen eine sich wiederholende Melodie, ansonsten nur das Wasser, die Schaumkrönchen und eine Unzahl von gleißenden Tupfen Sonnenrest, hüpfend, auf und ab.
Sie hatte sich auf diesen Moment vorbereitet, hatte ihn herbeigesehnt und gefürchtet. Die Erkenntnis aber, dass in dem Hotelkomplex fast ausschließlich Lemuren hausten, hatte ihr den nötigen Ruck verschafft, und sie hatte Nils gesagt, sie gehe jetzt, gleich, nein, doch: jetzt.
Sein Blick voller Liebe, der Klang der Worte, die er ihr hinterhergesprochen hatte wie eine Schutzumhüllung, mein Mädchen, der Stolz, der in seiner Stimme lag, bildeten die soliden Planken, auf denen sie hinunter in Richtung Ozean geschritten war; eine Königin, sein Mädchen. Allein, das wollte sie so; wenn er nicht mitkäme, dann eben allein.
Das Meerwasserbassin war schmutziger als erwartet. Schartige Farbblätter lösten sich von der Betonmauer, Bruchstücke davon trieben auf dem Wasser obenauf, aber das Meer, das von hinter der Bassinmauer hereinzüngelte, die Sonne, die sich auf ihren Abgang vorbereitete, und ihre Arme, ihre Hände, die an den Kleidern zupften, sich die Bluse über den Kopf zogen, über den Nacken wie ein Mann, die Leinenhose abstreiften, ihre Finger, die über wulstige Pölsterchen glitten, und nur ein ferner Vogel, der etwas hätte erhaschen können, hätte er denn geschaut und nicht gesungen, wieder und wieder dieselben Noten, dasselbe Lied, alles drängte sie und beteuerte: Es ist gut.
Cristina wollte sich nicht umdrehen, ob da vielleicht doch jemand war. Besser, man vertraute darauf, dass da keiner war, besser, man ging vorwärts jetzt, ein Zeh ins Wasser, ein Fuß, die Wade, das Knie, ein zweites Bein, das folgte, mit ihren Händen fuhr sie sich über die weichen Stellen, die Hubbel, welche die Narben hinterlassen hatten, und die neuen kleinen Röllchen, und um sie zu verstecken, müsste man bis über die Hüfte hineinsteigen ins Nass.
Alles in ihrem Körper schien aufwärts zu fliehen, kopfwärts, als die kühle Oberfläche des Wassers um ihren Bauch spielte. Es nahm ihr den Atem. Aber unten, bei ihren Beinen, spürte Cristina etwas Neues, eine Wärme, die aus der Bewegung des Wassers kam, eine Einladung einzutauchen; Cristina tauchte ein.
Der Meeresspiegel war jetzt so hoch wie der Wasserspiegel im Bassin, es gab keine Betonmauer mehr, zwischen den Zahnstochern wurden einzelne Farbplättchen hinausgetragen ins offene Gewässer, und mittendrin badete Cristina, streckte die Arme, furchte, pflügte, strampelte mit den Beinen, tauchte ab und tauchte auf, die langen braunen Haare schlängelten hinter ihr wie hundert Aale; sie lachte ohne Laut. Über allem strich ein Wind, ein Hauch von Ungestüm, und so merkte Cristina zuerst nicht, dass da ein weiterer Gast den Rand des Bassins betreten hatte, sich daranmachte, sich von der Treppe abzustoßen und einzutauchen in die nasse Welt, die doch jetzt ihre war, ganz.
Sie erschrak.
In erzwungener Langsamkeit schwamm sie in die andere Richtung, durchmaß das runde Becken, hörte den eigenen Atem über die Brandungswellen hauchen. Der Mann, es war ein Mann ohne Zweifel, planschte wie ein Kind. Warf sich auf den Rücken, ruderte mit den Armen durch die Luft, prustete, lebensfroher, kräftiger Wal. Machte ununterbrochen Geräusche, Zeichen, dass keine Gefahr von ihm ausgehe. Zeichen, dass er die Schwimmerin, die vor ihm da gewesen war, respektieren würde. Friedenszeichen, weißes Tuch. Sie drehte sich ebenfalls auf den Rücken. Das flache Sonnenlicht blendete sie, glitzerte gegen harte Schatten an, Wellenberg und Wellental ein rhythmisches Funkeln. Cristina kniff die Augen zusammen. Nun tauchte er unter. Sie sah ihn nicht mehr, sie konnte ihn nicht mehr sehen und machte vorsichtshalber ein paar Schwimmzüge in Richtung Bassinrand. Dann hörte sie ihn, er spritzte offenbar wieder Wasser gegen den Himmel. Sie stellte sich vor, wie es auf ihn herunterrieselte. Und ärgerte sich, dass sie seit seinem Auftauchen die Temperatur des Wassers nicht mehr fühlen konnte. War es warm? Kalt? Wechselte es, und wo? Ihr Sensorium war blockiert durch diesen Mann, der sich nur wenig von ihr entfernt wie ein Kind benahm.
Allmählich bekam sie Schrumpelhaut. Ihre Lippen bibberten schon. Einmal hatte er freundlich zu ihr herübergewinkt, dann hatte er sich wieder nur um sich selbst und seine Freude gekümmert, ungeachtet dessen, dass er damit die Freude einer anderen beeinträchtigte.
Immer öfter sah Cristina nun Fetzen von Farbe durch das Wasser treiben, einmal etwas Braunes, das wie Kacke aussah; unwillkürlich schlug sie mit der flachen Hand und strampelte es weg. Er hatte nicht geschaut, sie hatte jedenfalls nicht bemerkt, dass er geschaut hätte, aber dann sah sie Nils, Nils, der mit rettenden Schritten den Abhang herunterkletterte, was für ein Glück, jetzt Nils, unbeholfen auf seinen Latschen, ernst, mit einem Handtuch in der Hand, das er schützend öffnete, darauf wartete, dass Cristina angeschwommen kam, die strampelte, um rasch zu ihm zu gelangen, wo er sie bereits auf halber Treppe, bis zur weißen Wadenmitte im Wasser, die Latschen hatte er abgestreift, in Empfang nehmen konnte, sein Mädchen, seine Königin, Cristina, die die Liebe seines Lebens war.
Dankbar ließ sie sich einwickeln. Nils legte einen Arm um ihre Schultern, »du hast ja ganz blaue Lippen«, sagte er.
Sein Körper fühlte sich kühl an, kühl und mit einem zarten Film von Schweiß über der Haut, er hatte bestimmt die ganze Zeit mit eingeschalteter Aircondition gearbeitet, ihre Kniegelenke lotterten. Gemeinsam schritten sie über die Platten, die einen Weg bildeten vom Strand hinauf in die Anlage.
Üppiger Blumenbombast staute sich zu einem Gemälde, aus dessen Zentrum plötzlich etwas Scharfes in Cristina drang. Der Blick einer Frau. Cristina zog das Tuch enger. Sie hatte vorher nicht bemerkt, dass hier ein Liegestuhl stand. Hinter sich hörte sie eine Stimme, sie musste dem Mann im Wasser gehören, die »Hallo« rief. Vermutlich winkte er, die Frau setzte sich in ihrem Liegestuhl auf und winkte an Cristina vorbei mit knapper Geste einen Gruß zurück.
»Also? Wie war’s?«, fragte Nils, unbekümmert, laut. Das Wasser der Freiluftdusche hüllte sie mit seiner Sonnenwärme ein; zwei-, drei-, viermal harkte sie ihre Haare mit ihren Fingern von der Stirn zum Hinterkopf. Die Augen hielt sie geschlossen. Es roch ganz wunderbar nach Blütenstaub und Meer.
Nils hielt ihr das Tuch so, dass sie sich in dem Zelt aus- und wieder ankleiden konnte, Slip, Hose, BH, Hemd; sie spie das letzte Restchen Wasser aus: »Gut«, sagte sie und rubbelte sich mit einem Zipfel die Haut. »Gut war’s. Genau das Richtige. Und« – jetzt strahlte sie ihn an, ihren Nils, immer ein bisschen desorganisiert, wenn es um das wahre Leben ging – »ich bin froh, dass du gekommen bist.«
Nils drückte sie. »Hmm«, aber das hätte er gar nicht zu sagen brauchen. Seinem Blick sah sie an, dass er in Gedanken oben war, wo sein Hochleistungsrechner auf ihn wartete.
Das alte Hotel wirkte wie ein Relikt aus einem Filmset, für dessen Abbau keiner Zeit gefunden hatte. Aus, letzte Szene gestorben, Techniker auf ein anderes Set beordert.
Und da hingen nun die Balkone an ihren rostigen Stahlträgern, einzelne Fensterhöhlen waren mit Plastik ausgeschlagen, ein Gerüst auf Rädern schepperte im Wind. Eimer, in denen die Lasur längst bröckelte, warteten in einer langen Reihe vor einer Wand, deren einstige Tönung blau gewesen sein musste, blau oder lila vielleicht. Mit dem Prospekt, den Nils’ Mutter zur Überzeugung beigelegt hatte, hatte dieses Gemäuer jedenfalls nichts zu tun. Selbst die wenigen Palmen, gepflanzt auf dem schmalen bewässerten Landstreifen zwischen Hotelanlage und Strandweg, standen schief. Man musste aufpassen, dass man nicht über die buckligen Kantsteine stolperte, die Grenzlinien markieren wollten, welche keiner verstand.
Vorhänge zitterten in der Abendluft, und wieder staunten Cristina und Nils stumm über die Hotelgäste, die im Vorraum des Hotelrestaurants auf Sesseln entschlackten, stundenlang, und dort getrocknete Weißsemmeln mit einer Geduld einspeichelten, die nur gottgegeben sein konnte. Sie hatten bei ihrer Anreise nichts davon geahnt, dass hinter den Werbewörtern Health und Spa die Philosophie des Entgiftens durch Bittersalze, Kräutertees, Einläufe und Bauchmassagen stand, und schockiert auf die Männer und Frauen gestarrt, die in allen Ecken herumhockten und vor sich hinkauten, Menschen, die den Glanz des Lebens bei der Garderobe abgegeben hatten, hellblau der eine, hellgrau die andere, freudlose Münder in bleichen Gesichtern, die Körper blutarm und blass.
Betroffen waren sie an ihrem ersten Abend durch eine Schiebetür gestolpert, hinter der dann doch noch so etwas wie ein Restaurantsaal auftauchte. Schwarztee gab es zwar auch hier keinen, und die Suppe war nicht viel mehr als getöntes Wasser, durch das das ausgewaschene Muster des Geschirrs schimmerte, aber heute reichte man ihnen beim Eintreten immerhin eine Karte, darauf freuten sie sich jetzt, auf das Lesen und Auswählen, als sie, Hand in Hand, zu ihrem Tisch gingen. Cristina hatte sich die Haare zu einem Knoten auf dem Hinterkopf geschlungen, beide verspürten jeweils wenig Lust, sich im Zimmer oben umzukleiden, herauszuputzen für den Abend. Herausputzen, das war die Welt der anderen, Herausputzen hatte für Nils und Cristina keinen messbaren Wert. Cristina hatte das gleich bemerkt, als sie sich auf Nils eingelassen hatte, als sie die Bereitschaft in sich gespürt hatte, mit Nils ein gemeinsames Leben zu wagen. Eines, das Ewigkeit versprach, weil so unkompliziert, so ruhig und gleichmäßig liebend. Mit Nils gäbe es kein Drama. Keine Egospiele; die Beziehungsbedingungen waren schnell geklärt. Nächtelanges Heulen und Sich-auf-die-Zunge-Beißen, bis der andere endlich nach Hause käme, gäbe es mit ihnen nicht. Keine versteckten Botschaften auf Zettelchen, die ihr beim Umdrehen der Hosentaschen in die Hände fallen würden, wenn sie Wäsche machte, keine kurzatmigen Anruferinnen, die auflegten, wenn sie den Hörer abhob. Mit Nils war endlich Ruhe in ihr Leben eingekehrt und damit das, was sie so sehr wollte.
Großzügig hatte man die bodentiefen Fenster zur Seite geschoben, sodass der Innenraum mit dem Außenbereich verschmolz. Die Luft trug das Meer heran, das im Hintergrund wogte wie ein einsam vor sich hinfeierndes Banner in Blau. Die Liegestühle standen leer. Auch der rechteckige, beheizte und chlorgesättigte Hotelpool war um diese Zeit verwaist. Von fern hörte man den Ozean branden, deutlich ruhiger, die Flut zog sich zurück, und Cristina vermutete, dass das Meerwasserbassin zu seiner Mußezeit zurückgefunden hatte und wieder so war, wie sie es angetroffen hatte, ruhend, in der Ferne der Gesang eines Vogels, und glatt.
Der Kellner brachte Brötchen, Butter in einem Schälchen, von dem eine Ecke abgebrochen war, kleine Teller und Zwergen messer.
Nils betastete die Brötchen einzeln, aber auswärts essen war ohnehin etwas Schwieriges mit Nils. In hastigen Worten erzählte er von einem Teilproblem, dessen Lösung er auf die Spur zu kommen schien, nun, da die Internetverbindung stabilisiert war, einem neuen Ansatz, den er ausprobieren wollte. Die alte Sache von der Stimmcharakteristik, in der sich Wesentliches versteckte, der momentane Zustand des Sprechers, sein Alter, sein Gesundheitszustand, da war so viel Information enthalten, was es schwierig machte, einzelne Sprachsignale statistisch zu beschreiben. »Wenn du den Laut A nimmst und schaust, in welchen Wörtern er vorkommt, so sieht er doch von verschiedenen Menschen gesprochen verschieden aus. Deshalb arbeiten wir ja mit diesen statistischen Ansätzen, mit Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Sprache ist ein wahnsinnig komplexes, ein wahnsinnig kompliziertes System, Cristi, aber wenn es unserem Team gelingt, ein wenigstens etwas schlaueres Dialogsystem zu entwickeln, dann wäre das für den Fortschritt …, dann wäre das für uns …«, seine Lippen bewegten sich schnell, »dann könnte man zum Beispiel Bahnhof-Ticketautomaten mit Kameras und Mikrofon ausstatten, und das mühsame Sich-durchs-Programm-Klicken, bis man endlich die Verbindung hat, die man sucht, wäre Geschichte. Man würde einfach sagen, wohin man will, und fffft wäre das Ticket da. Im Moment ist das natürlich noch schwierig, Umgebungsgeräusche, Lautsprechergeräusche, die Frage Spricht da überhaupt einer zu mir?, die sich die Maschine stellen muss, Kommt da ein akustisches Signal, das für mich bestimmt ist? Entschuldige, Cristi«, er lächelte, »ich will dich nicht langweilen, aber ich glaube, ich bin da etwas Gutem auf der Spur.« Er senkte den Blick zum Brötchen, dem Messerchen, das er noch immer in der Hand hielt.
Draußen gingen die Frau und ihr hintendrein der Wasser speiende Mann vorbei. Von seinen Schultern tropfte es. Ein Hotelangestellter knipste die Gartenlampen an, und Cristina stellte mit Erstaunen fest, dass es heute Abend gesalzene Butter gab. Ihr Gesicht glühte wie das eines von einer Überraschung beglückten Kindes, glich dem Sonnenball, der in unbegreiflicher Ferne soeben im Ozean versank.
Der Raum war überschaubar, das Deckenlicht grell. Seine Frage, ob es nicht irgendwo eine Stehlampe gebe, hatte man mit einem schiefen Lächeln quittiert. Seither wartete er allein im Saal. Sieben Reihen zu acht Hartschalenplastikstühlen. Ausrangiert war das Wort, das ihm die Stirn zerfurchte, ausrangiert, wie ich.
Er durchwanderte die freie Fläche, fügte einen Schritt an den nächsten. Als ob sich dadurch etwas beweisen lässt, dachte er bei sich. Einatmen. Ausatmen. Dem Körper Zeit lassen, bis das Einatmen wiederkam. Er war eine große stattliche Erscheinung – war er das noch? Er hatte Charme – hatte er den noch? Einen Brustkorb wie ein Eichenfass.
In seinem Schienbein pochte ein leiser Schmerz, an der Stelle, wo ihn heute die Welle gegen einen Poller gedrückt hatte. Die würde morgen blau sein. Was hieß morgen, jetzt, jetzt war sie schon blau. Dabei hätte er gern einmal Shorts getragen.
Sechsundfünfzig Plätze. Ein Flügel, der unter einer Plastikfolie harrte. Kein Fenster – was war das für ein Ort?
Jemand schurrte einen Tisch heran, viel zu groß, viel zu kahl. Flurin traute sich nicht, nach einer Tischdecke zu fragen. Noch mehr Kunststoff hätte er nicht ertragen. Der Tisch blieb ohne Stuhl. Als niemand wiederkam, hob Flurin einen der Stühle aus dem Publikumsbereich. Jeder Schritt hallte. Er stellte den Stuhl zum Tisch, mit Zeigefinger und Mittelfinger auf der Lehne ließ er ihn vor- und zurückschaukeln. Wie würde das mit seiner Stimme sein? Das letzte Mal war schon eine Weile her. Er probte. Eins, zwei, drei, sagte: Eichelhäher, Nussbaum, Gartenpflege. Vier, fünf, sechs, sechs, sechs, sagte: Sechs Sachsen suchen begeistert ihre sieben Sachen. Sagte: Frischer Fischleim schmeckt wie Frischschleim. Sagte: A E I O U Ä Ü. Ölbohrung, Gewölbekeller, Glockentrommler, U-Bahnhof. Marmeelaaade. Konfitüüüre. Mimte Gähnen.
Einer kam, blickte sich um und entschuldigte sich. Dann war er wieder weg.
Flurin schaute auf seine Uhr. Noch sechzehn Minuten. Hélène würde pünktlich sein, Hélène wäre gleich da. Er entspannte sich. In seinen Händen hielt er sein letztes Buch. Sieben Jahre. Verflixte sieben Jahre war das her. Seither nichts. Sein Leseexemplar. Mit Bleistift hatte er sich Notizen auf jeder Zeile gemacht. Wo er eine Emphase setzen würde, einen Knaller, einen Punkt. Ein sanftes Abrutschen in ein Nichts, immer dort, wo der Text zu Herzen ging, ein sicherer Wert, besonders die Stelle mit dem Schlussakt, mit dem alles endete, jeder Naturkreislauf, vor seinem Neuanfang.
Nicht daran denken. Anderswohin denken. Dem Meer entgegen. Dem Wind und dem Vogel, dessen Identität er nicht hatte erraten können trotz genauen Hinhörens im Bassin vorhin. Eine Brillengrasmücke vielleicht. So gut kannte er sich nicht aus mit Inselvögeln. Noch zwölf Minuten und noch keiner da.
Er hatte sich schick gemacht, die dunkle Hose mit der Bügelfalte angezogen, das weiße taillierte Hemd. Eine Krawatte hatte er für zu feierlich befunden, die Bedenken laut geäußert. Hélènes Flunsch darauf.
Plastik. Wie hätte es auch anders sein können, hier, in diesem Saal ohne natürliches Licht, hätte keine Pflanze überlebt.
Langsam schritt er zurück von ganz hinten nach ganz vorn, als doch noch zwei Hotelgäste durch die Tür traten. Ob hier die Lesung sei, wollten sie wissen, Flurin bejahte. Sofort war er ein Stückchen größer geworden, hatte er den Raum zwischen seinen Wirbeln gedehnt. Zwei, dachte er, zwei habe ich schon. So schlimm wie im Skiresort vor vier Jahren kann es also nicht werden.
Als wenig später Hélènes zierliche Schultern im Türrahmen erschienen, wie immer schwungvoll, elastisch, das honigblonde Haar frisch auf Kinnlänge getrimmt, die Lippen, wie er fand, mit etwas zu viel Rubin – und auch das liebte er, dass sie sich zu stark schminkte, zu viel parfümierte, liebte man nicht das, was unzulänglich war? Das Unperfekte, liebte man nicht immer das am meisten? –, konnte er bereits auf stolze sieben Besucher blicken. Munter zwinkerte er ihr zu, sie nahm sich einen Platz rechts außen.
Als sie sich in ein mitgebrachtes Programmheft vertiefte, wippte der Pagenschnitt an der Linie ihres schmalen Kinns entlang. Ihr gefolgt waren die Gäste acht und neun, zwei ältliche Herren, die sich umständlich am Ellenbogen des jeweils anderen festzuklammern suchten. Flurin räusperte sich.
Seine Ahnung wurde Wahrheit. Von Heilprogramm und Ernährungsplan übersättigte Hotelgäste überwanden sich, für einen Abend wenigstens eine kulturelle Ablenkung über sich ergehen zu lassen. Damit man das auch gemacht hätte. Damit man das auch erlebt hätte. Damit man davon erzählen könnte, wenn man wieder zu Hause war. Das war in den Hotels der Skiresorts nicht anders als in den Hotels mit eigenem See und auch hier, wo er nie hingewollt hatte, Flurin, auf den Kanaren.
Aber seiner Frau einen kleinen Luxusurlaub zu bescheren, war eben auch nicht nichts. Und – so pflegte er sich einzureden bei jeder dieser äußerst selten gewordenen, äußerst raren öffentlichen Veranstaltungen – er geriete dann nie ganz aus dem Gespräch. Ein Anlesen gegen das Vergessengehen, dachte er und gluckste unwillkürlich; Hélènes Scheitel zitterte. Es wäre vermutlich auch in einem Hotel auf dem Mond noch dasselbe.
Diese schlauen Angebote. Diese findigen, bauernschlauen Angebote! Man lade sich einen abgehalfterten Schriftsteller mit Gattin ein, ködere ihn mit einem All-inclusive-gratis-Urlaub von sieben Tagen, wenn er sich dazu bereit erklärte, jeden zweiten Abend eine Lesung für die Hotelgäste abzuhalten. Bücherverkauf: Sache des Autors. »Perfekte Einnahmequelle, stellen Sie sich vor: all die vielen Gäste!«
Und nun stand er also hier, eine letzte Minute vor neun Uhr abends, draußen wehte bestimmt ein Lüftchen durch müde Palmenblätter, vor ihm blätterten die müden, ausgelaugten Gesichter todkranker Patienten ab … Er musste sich zusammenreißen.
Gerade als er beginnen wollte, streckte ein dürrer alter Mann, einer der beiden, die gemeinsam hereingetorkelt waren, sein Händchen in die Luft, wobei der Hemdsärmel nach unten rutschte und am knochigen Ellenbogen hängen blieb, einem Ellenbogen, der grün und violett und dunkelbraun schimmerte, mein Gott, ist das die Zukunft von uns Männern, knochig und unter der Grauschicht bunt zu werden? Flurin fragte: »Ja? Bitte?« Dabei spürte er sein Schienbein unangenehm pochen.
»Ähäm«, räusperte sich der Alte, »und von wem ist das nun, was Sie uns da vortragen werden?«
Ein ungeplanter Lachlaut sprang aus Flurins Kehle. Ein Ton, aus der Not geboren. Jetzt nur nicht Hélène ansehen, jetzt locker und amüsiert aussehen, souverän, Hélènes Versteifung nahm er aus dem Augenwinkel wahr. Flurin versuchte es freundlichkollegial, von älterem Herrn zu Greis, aber es klang vielleicht doch jovial. »Von mir, Flurin Padrutt. Ich lese Ihnen nun, meine geschätzten Damen und Herren, aus meinem jüngsten Buch vor: Der glückliche Garten. Band drei.«
Just in diesem Moment hob in einem der Nebenräume eine Stimme zu singen an. Eine Frauenstimme, begleitet von einer Gitarre: das Parallelprogramm.
»Ja, ist das Konzert denn nicht hier?«, wollte eine Dame wissen, stand auf und huschte hinaus. Noch bevor sich die Tür hinter ihrem pfauenfederfarbenen Gewölbekleid geschlossen hatte, schoben sich zwei weitere Personen in den Saal, ein ultradünner Mann mit Rundglasbrille, schütterem Blondzopf im Nacken und Geißbärtchen, Typ John Lennon, und mit ihm: die Frau aus dem Bassin. Sie trug eine weite Leinenhose und ein ultramarines Baumwollhemd. Die beiden zogen die Köpfe ein und setzten sich vorn auf zwei der vielen freien Stühle; sie drehte sich mit einer halben Bewegung um, kein Zweifel, dass sie die Leere des Saales bemerkte. Dann ließ sie sich etwas tiefer in die Schale des Sitzes rutschen und lächelte unbestimmt. Ein Höflichkeitslächeln. Hoffentlich kein Fremdschämlächeln. Er dachte: Eins, zwei, drei. Marmelaaade, Konfitüüre. Dennoch zögerte er, ein kurzes Fallen, unbestimmte Ratlosigkeit, dann hob er, nach einem letzten klangvollen Atemzug, zu lesen an: »Pflanzen. Bäume, Blumen, Büsche, Gras. Sie alle können mehr, viel mehr als wir. Sie können …«, ja, ja, blabla. Habe ich das so geschrieben? Steht das wirklich da? Ich muss mich konzentrieren, »die Schwerkraft berechnen, die auf sie wirkt, komplexe Informationen austauschen, und das nicht nur untereinander, sondern auch im Zusammenspiel mit Vögeln, Insekten – uns …« Wie abgedroschen. Wackelt der Stuhl? Ich hätte doch lieber stehen sollen. Hoppla, bin ich eine Zeile runtergerutscht? »… ist ihr Wurzelwerk ein noch viel erstaunlicheres Gebilde von …« Das weiß doch mittlerweile jedes Kind. »… und auf alle Fälle ein viel zuverlässiger funktionierendes als …« Das ist ja peinlich. Schluss jetzt: Ich muss sofort in meinen Text hineinkommen, sonst geht das daneben. Waren das Hélènes Waden? Hat Hélène ihre Waden aneinandergerieben? Ärgert sie sich etwa schon über mich? Mist. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich Netz, Internet oder Web gesagt habe, Web versteht hier doch keiner. »… Schwingungen beispielsweise, die wir mit unserem Gang über den Rasen …« Jetzt kommt die erste gute Stelle, gottlob, konzentrier dich! »… Augen, Ohren, Nase, Mund: Jede Pflanze hat ihre ureigenen Organe entwickelt, die sich ihren ureigenen Lebensbedingungen angepasst haben, und so ist zum Beispiel ein Rebstock mit …«, hört mir hier überhaupt irgendjemand zu? Ein Einziger? Was scharrt denn da so beharrlich? Zeichnet da einer ein Muster mit seinem Stock? Man müsste ihnen ordentlich zuprosten, mit Alkohol, damit sie sich entspannen, »Abermillionen von zarten Öhrchen übersät. Der ganze Rebstock ist Gehör. Aber nicht nur der Boden trägt Schallwellen, auch die Luft …« Mal schauen, vielleicht kann ich sie mit dem Experiment vom Weinbauer aus Montalcino aufwecken, da wollte ich schon immer hinreisen, den einmal persönlich kennenlernen. »… reifen schneller. Der Pflanzenwuchs bei mit Musik beschallten Reben ist insgesamt kräftiger, und der Geschmack …« Eigentlich hätte ich nicht fliegen wollen. Gar nicht fortgehen. Wann mache ich jetzt bloß den Winterschnitt? »… beeinflussen so bestimmte Frequenzbereiche das Wachstum …« Meine Reben, einfach so zurückgelassen, hört ja doch keiner zu hier. »Wir alle können, wenn auch nicht unbedingt Weinflüsterer …«, sage nächstes Mal, »so doch zumindest Gartenflüsterer werden, die auf die Bedürfnisse von …«, nicht von mir, ein fremder Text, der, »… Rücksicht nehmen und voll der Genügsamkeit …«, irgendwann, »erleben wir ein Zusammenspiel, das in Würde und …«, zu Ende geht.
Nach der Lesung wurde den Gästen ein Glas Orangensaft aus dem Tetrapack offeriert. Wer an der Mayr-Heildiät teilnahm, hatte zu verzichten und wurde vom Servicepersonal mit einem bedauernd ermunternden Nicken bedacht.
Weil ein paar der Gäste in ihr Gespräch über Weißsemmeln und die Schädlichkeit von schwarzem Tee vertieft den Ausgang versperrten, nutzte Flurin die Gelegenheit und arbeitete sich stückchenweise vor. An seiner Seite zwei eifrige Damen, die ihm im Kanon von ihren eigenen Gartenerfolgen berichteten und sich über ihre verwirklichten Outdoor-Wellnessoasen ausließen. Er verstand kein Wort. Als im Nebensaal der letzte Ton verklang und ein kläglicher Applaus sich von vermutlich ebenso ramponierten Sitzgelegenheiten erhob, legte Hélène den Kopf schief und horchte. Sie saß noch immer betont aufrecht, dezidiert gepflegt auf ihrem Stuhl, blätterte in ihrem Programmheft, den Kulturellen Veranstaltungen der Woche.
Ja. Sie hatte ihn gewarnt. Er hätte ein besseres Foto einschicken sollen, nicht dieses unscharfe von ihm in seinem Garten. Er würde dieser Feststellung nachher beipflichten müssen. Aber da hatte er es endlich geschafft, sein Gesicht mimte eine mumifizierte Zustimmung, die beiden Damen schwatzten von Feinsteinzeugplatten in Holzoptik und deren Lebensdauer in nördlichen Breiten, aber nun stand er nahe genug bei der jungen Frau aus dem Pool, die unentschlossen in einem seiner Bücher blätterte, die er auf dem Beistelltisch neben der Tür angeordnet hatte, die Hand von John Lennon ruhte auf der ansteigenden Wölbung, da, wo ihr Rücken in den Po überging, ein Hauch einer Berührung, sanft wie Morgentau, dachte er und war plötzlich tief gerührt von dieser Erkenntnis. Etwas zitterte, als er es wagte, ihr Blick wich dem seinen aus, aber er sagte es dennoch, sagte: »Hallo.« Hélène, plötzlich an seiner Seite, ganz misslaunige Verwunderung, aber er hatte »Hallo« gesagt, und die Frau mit den langen braunen Haaren, die auf ihrem Hinterkopf eine lose Schlaufe, ehemaliger Knoten, bildeten, wandte ihm ihr Gesicht zu, die sorgenlose Augenbrauenlinie hob sich, und Flurin sagte: »Cristina, nicht wahr? Wir kennen uns von früher, du erinnerst dich vielleicht.«
Mein Atem stockt. Etwas Raues in meiner Kehle. Habe ich Durst? Ein Gefühl der Unsicherheit. Nichts Schlimmes. Nichts, das mich jetzt aus dem Gleis wirft. Ich sehe Sonjas Gesicht. Die Augenbrauen, der offene Mund, Zähne. Ein langer Zopf. Alles habe sie von Noah gelernt. Sie meinte den Garten. Und wenig später: »Dann erzähle eben ich dir alles, was ich weiß.«
Habe ich ihr überhaupt eine Frage gestellt?
Stand sie so offensichtlich im Raum?