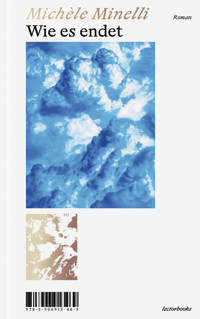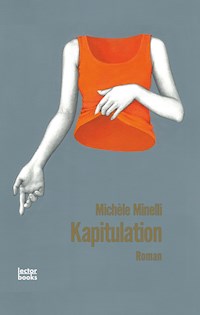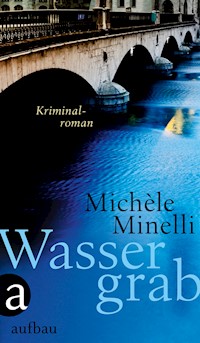
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In Zürichs Unterwelten.
Zwei Frauen bereiten Kommissar Scheu Probleme: eine unkenntliche Tote in der Kanalisation, die niemand vermisst, und eine einschüchternd attraktive Lettin, die jemanden sucht. Unten, im Abwasserkanal bei der von Ratten angefressenen Leiche, umfängt ihn eine eigentümliche Welt von strenger Ordnung und wohltuender Stille. Gerade die fehlt ihm neuerdings im Büro. Es wird nicht leichter durch die mysteriöse Lettin, die ausgerechnet jetzt ihre vor 39 Jahren verschwundene Mutter suchen lassen will ...
Ein im wahrsten Sinne abgründiger Krimi mit einem Ermittler, der seine Untiefen hat.
„Minellis Worte beleuchten die Figuren wie das Blitzlicht einer Fotokamera.« Zürichsee Zeitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Michèle Minelli
Wassergrab
Kriminalroman
Impressum
ISBN 978-3-8412-0669-5
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Oktober 2013
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2013 bei Aufbau, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung hißmann, heilmann, Hamburg unter Verwendung eines Motivs von Quadriga Images/getty images
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Für Michael T. Fetzer
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
November
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Dezember
Kapitel 22
Kleines Glossar jenischer Begriffe
Abkürzungen
Danksagung
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne ...
November
Kapitel 1
Umzüge aber waren das Schlimmste. Verreisen, Taschen packen, irgendwohin fortzufahren, um diese Taschen wieder auszupacken – kein Wunder, dass sein letzter Urlaub Jahre zurücklag. Nie würde er sich freiwillig auf eine Reise begeben, und er verstand sie nicht, seine Kolleginnen und Kollegen, die das Jahr für Jahr aufs Neue taten. Manche sogar mehrmals.
Ein fast unmerklicher Schauer fuhr durch seinen Körper wie über ein Xylophon; wenn er noch länger so vor der Türe stehenbliebe, hätte es sich bald ausgetropft, und sein Mantel wäre trocken. Behutsam hob er einen Fuß, der Boden machte schmatz. Ein halber Blick zurück durch den langen Flur, dann drückte er die Klinke.
Imogen war schon da. Sie saß hinter ihrem Schreibtisch, in sich gedrängt, kompakt wie eine Kröte. Die braunen Haare locker ums Gesicht. Der Grüntee dampfend in der Tasse. Ihre Finger prasselten als Flageolett-Glissando über die Tastatur. Ihre Stirn lag gewellt, ihre Zunge ruhte im Mundwinkel, ein Zeichen, dass sie in Konzentration gefangen war und damit meilenweit entfernt.
Er drehte sich um und streifte seinen Mantel ab. Sorgfältig hängte er ihn an die Garderobe. Mit der flachen Hand strich er die Ärmel glatt. Letzte Tropfen glitten über den Saum und fielen in die Geräuschlosigkeit. Am Boden standen in einer Plastikschuhschale ein paar kleine weiße Gummistiefel, modisch verziert mit pinkfarbenen Kätzchen. Imogen trug demnach ihre Büro-Shape-ups. Als er sich umdrehte und auf die Kisten und Ordner und Akten und Mappen, über die Stapel auf und neben seinem Tisch blickte, schwang sich ein kurzer hoher Ton in seinem rechten Ohr zu einem Pfeifen. Und verschwand. Wie auf ein Zeichen hin schaute Imogen über den Rand ihrer Schreibbrille.
»Dann bist du jetzt also da. Willkommen im neuen Büro, Leandro Scheu.«
Unendlich langsam bewegte er sein Gesicht zu ihr hin. »Dann bin ich jetzt also da, ja.«
Sie schaute schon nicht mehr. Stirnfalten, Zunge, Finger, alles am rechten Platz, tippte sie weiter an ihrem Bericht. Jeder Anschlag saß. Wie ein gut einstudiertes Fingerspitzenkonzert. Auf ihren Lippen die Spuren eines Lächelns.
Draußen trommelte der Regen. In seinem Kopf prasselten leere Worthülsen zu Boden. Was hätte man nicht alles darauf antworten können, wenn man wortgewandt wäre! Wenn man schlagfertig wäre und locker. Aber das war man nicht, nicht, wenn man Leo Scheu hieß, und nicht im Umgang mit den Kollegen. Die rechten Worte fand man offenbar stets nur mit denjenigen, denen man im Leben kein zweites Mal begegnen würde. Nun, das stimmte so auch nicht. Ehrlicher wäre, und das wusste Scheu, es war ihm zutiefst präsent und unangenehm, ehrlicher wäre, sich einzugestehen, dass einem die rechten Worte immer da fehlten, wo man in freundschaftliche Beziehung hätte treten sollen. Oder können. Wollen. Müssen. In Sachen Beziehungssabotageakte hätte Scheu einen Bestseller mit integriertem 12-Punkte-Plan verfassen können. Na ja, schreiben war auch nicht so seins.
Er fuhr sich mit beiden Händen zwei-, dreimal durchs Haar und wandte sich dem Einrichten seines neuen Arbeitsplatzes zu.
»Wo keine Hoffnung ist, ist Schicksalsergebenheit«, murmelte er ungehört. Wie immer hatte Imogen ihre Ohren abgeschottet, die Menschen redeten ohnehin meistens aneinander vorbei, so unklug war Imogens Verhalten demnach nicht. Dennoch stimmte es Scheu moros, dass auch sie keinen Sinn für Zwischentöne zeigte, und dass er ausgerechnet zu ihr ins Büro wechseln musste, war schon ein Schlag ins Gesicht. Deutlicher hätte es Meier nicht ausdrücken können. Ich mag dich nicht, ich will dich nicht, ich ekle dich hinaus.
Imogens Büro war dafür bekannt, im Sommer das heißeste und im Winter das kälteste zu sein. Kam hinzu, dass Imogen selber offenbar temperaturunempfindlich war, ihr Fenster stand sommers wie winters offen, Regen oder Sonnenschein. Eine Amphibie eben, an dieser Frau perlte alles ab.
Zurückgelassen hatte Scheu sein eigenes Büro: klein, fein. Und still. Ein Büro, in dem er ungehindert denken, wirken, kombinieren konnte. In dem seinen Worten, die er gerne vor sich hin murmelte, keine Hindernisse im Weg standen, in dem er sich sicher fühlte beim Bilden von Sätzen, sicher und stark, und seine Einvernahmen, das wusste er, waren gerade wegen dieser Sicherheit und Stärke seine Kernkompetenz. Seine Stimme, die stets ruhig blieb, nie Ungehaltenheit oder Gereiztheit zeigte, seine väterlich wirkende Fürsorglichkeit und schließlich die Fähigkeit, sich ganz in die Geschichte seines Gegenübers einzugeben, ohne Werturteil und ohne den Zwang, unbedingt Erfolg haben zu müssen – das alles löste den meisten Tätern die Zunge und befreite sie von einem Gewicht, einem moralischen Dilemma, von dem Scheu nur erahnen konnte, wie schwer es lastete. Aber da hatte er sich unbeobachtet fühlen dürfen in seinem Einerbüro … wie sollte das in einem Zweierbüro funktionieren? Eingekeilt zwischen fremden Möbeln und einer wasserundurchlässigen Berufskollegin mit Fingern, die über den rund sechzig Tasten, die man für den täglichen Gebrauch benötigte, nur so auf und ab sausten. Vorsichtig linste er hinter einer Kiste hervor, sie benutzte tatsächlich alle zehn.
»Bringt René noch mein Holzregal, wie ich es angeordnet habe? René – von der Logistik?« Auch darauf antwortete sie nicht. Vermutlich würden sich seine Befürchtungen bewahrheiten.
Alles hier war elegant und weiß. Ein Sonntagsbüro. Wie die anderen Büros, die mittlerweile mit diesem modernen Modulsystem aufgemöbelt worden waren. Scheu vermisste jetzt schon seinen altgedienten Holzrollladenschrank. Die Beamtengarnitur der 1960er-Jahre. Oder noch älter. Egal wie alt. Alt ist nicht immer schlecht. Alt heißt auch altbewährt.
Scheu stapelte die grauen Bundesordner, einen nach dem anderen, zu einem schiefen Turm. Alterprobt. Einzelne Aktentheks und Mäppchen sichtete er grob und verteilte sie im Schrank, auf dem Boden, auf dem Tisch … von alters her gut … rechts vom Computerbildschirm, altmeisterlich, links vom Computerbildschirm. Altehrwürdig, er seufzte das Wort. Mitte vierzig darf man das. Dann blätterte er gedankenverloren in der obersten Mappe und ließ sie an einer bestimmten Stelle offen liegen. Mit der Handkante fuhr er den Falz entlang, bis sich die Seiten ergaben. Er schaltete seinen Computer ein, blickte prüfend auf die Kabel, schob die Maus ein paar Mal hin und her und stieg mit dem Kopf ins Flimmern des Bildschirms hinein.
»Hm, alles da«, murmelte er. Es beruhigte ihn, die eigene Stimme zu hören. Und er wäre auch nicht im Traum dazu bereit, diese Eigenheit aufzugeben. Seine Idee war es nicht gewesen, das Büro zu wechseln. Ausgerechnet zu Imogen Kant, dieser Streberin, die machte einem doch das Leben schwer. Dabei hätte er gar nicht zu sagen gewusst, womit. Allein, dass sie da war, genügte, diese kleine Person, die immer so viel Kompetenz ausstrahlte, dass es beinahe wie Großmannssucht aussah.
Vermutlich wollte Dienstchef Meier, dass er von ihr lerne. Von ihr, die sie einwandfreie Rapporte verfasste, die sie die besten Zahlen vorzuweisen hatte, die sie auf der internen Statistik – Scheu war überzeugt, dass Meier insgeheim eine führte – seit Jahren Platz eins für sich beanspruchte und deren Qualifikationsgespräche ein Plauderstündchen mit dem Chef waren, weil sie ihre Zielvereinbarungen jedes Mal übersprang wie eine Hochsprungweltrekordhalterin. Ganz im Gegensatz zu ihm. Ermittler Leo Scheu, der nun auf der »Watch list« stand, sich neu bewähren und in sechs Monaten noch einmal antraben musste zwecks Standortbestimmung, weil irgendein idiotischer Nadelstreifenanzugfatzke, Verteidiger oder Richter, Meier rückte mit dieser Auskunft nicht heraus, sich schriftlich darüber beschwert hatte, dass seine Rapporte nicht genügten, dass sie »uneindeutig abgefasst« seien, mit »Wiederholungen«, die »läppisch« wirkten, und in einer »zuweilen fast infantilen Sprache«, so dass man »damit nicht arbeiten« könne. »Vermehrt«, wie es hieß, und Scheu wusste, dass das stimmte.
Die Namen seiner Deutschlehrer konnte er noch immer von der ersten bis zur neunten Klasse verzögerungslos herunterbeten. Sie hatten sich ihm eingraviert mit Feststellungen wie »Das einfache Aneinanderreihen von Wörtern lernt heute doch jedes Kind« oder »Großes schreiben wir groß und Kleines klein«. Alles, was er nach neun Jahren Volksschule in dieser Hinsicht noch besaß, war eine einfache Gebrauchssprache, die er in Anwesenheit derer, die er insgeheim schätzte, lieber für sich behielt. Teambildungsanlässe waren der reinste Horror für ihn. Supervisionen eine Qual. Wann immer er das Wort ergreifen und über sich und seine Gefühle sprechen sollte, wurde ihm brandheiß, und der Hals schnürte eng. Mit Worten etwas darzustellen, ob mündlich oder schriftlich, empfand Scheu als sein größtes Manko, und er verdrängte den Gedanken daran regelmäßig und schnell.
So hatte er denn auch beinahe vergessen, dass ihm Dienstchef Meier durchaus auch Lob entgegenbrachte, für solide Einvernahmen, für seine Fähigkeit, sich innerlich vorzubereiten, und überhaupt für seine Genauigkeit, seine Gründlichkeit, mit der er jedem neuen Fall begegnete. Dranblieb. Nicht aufgab. Und dabei noch nicht einmal verbissen wirkte, sondern »zugänglich und entspannt«, so hatte Meier das genannt. »Dir schlüpft nichts durch die Maschen, Leo, du hast eine phänomenale Kombinationsgabe, kannst Fäden zuordnen, die in der Luft herumschwirren«, alles harte Faktoren, die »zählen in einem Ermittlerleben«. Und erst die weichen! Sein Verhalten gegenüber jedermann, das klar und höflich war, sein Auftreten im Großen und im Kleinen – Scheu wusste nicht, was damit gemeint war, er hatte längst auf Durchzug geschaltet –, »nur die Rapporte, Mensch«. Ja, die Rapporte, »die müssen einwandfrei sein, wie stehen wir denn sonst da als Dienstabteilung«.
Wie stehe ich jetzt da? Dass sein Büro für Theophil Lutz benötigt wurde, weil der nach einer längeren Auszeit wieder zurückgekehrt war, konnte nur ein Vorwand sein.
Wie hatte Imogen noch gleich gesagt? »Dann bist du jetzt also da« – Begrüßungsphrase eines Cerberus.
Mit einem vernehmbaren Seufzer wandte er sich seinen Notizen im Mäppchen zu, den hingekritzelten Worten, aus denen er einen Bericht machen sollte. Was, gemäß Meier und wie ihm das Fräulein gegenüber noch immer rhythmisch tippend bewies, für gewisse Menschen offenbar keine Kunst war.
Ohne dass ein Klopfen vorausgegangen wäre, sprang die Tür auf, und im Rahmen erschien das rosige Gesicht Windlins. Er war der Jüngste im Team und noch nicht allzu lange beim Dienst »Leib und Leben«. Seine Stimme hatte in ihrer Lebendigkeit stets etwas von kindlicher Neugier mitschwingen. »Habt ihr schon gehört, wir sammeln für Meier. Er feiert ja demnächst seinen Sechzigsten.« Windlin wedelte mit einer übergroßen Karte und ließ mit der anderen Hand den Inhalt einer Kartonbox rascheln und klappern.
Imogen war nicht nur Amphibie, sie war offenbar auch Mäuschen: Augenscheinlich besaß sie die Gabe des lautlosen Handelns. Die Tasche auf den Schoß, geöffnet und beide Hände drin, und schon reichte sie Windlin fünfzig Franken. »Genügt, oder?«
»Sicher, klar! Und du? Gibst du Meier auch etwas? Wir sammeln für eine Privatführung im Zoo und dann noch für einen Gutschein vom Transa. Spezialist für Outdoor-Ausrüstungen. Es machen alle mit.«
Scheu zog sein Portemonnaie aus der Hosentasche und griff mit zwei Fingern hinein. Da waren ein Hunderter und zwei Fünfziger. So Großes hatte er nicht geben wollen. Aber Kleingeld zu geben ging auch nicht. »Ich habe grad nichts da. Muss noch auf die Bank heute«, sagte er in den Beutel hinein.
»Macht nichts, ich leih dir was«, sagte Imogen und hielt Windlin einen zweiten Fünfziger hin, »den kannst du mir später zurückgeben, Leo.«
»Ah. Danke vielmals.« Scheu verzog das Gesicht.
»Bist jetzt also hier, Leo? Gut angekommen? Schon eingelebt?«
Scheu schaute Windlin entgeistert an.
»Ich sehe schon, du hast zu tun.« Und als er sich zum Gehen wandte, rief ihm Scheu hinterher: »Wenn du René siehst, sag ihm, ich brauche mein Holzregal!«
Ein Windhauch erfasste Scheus Mantelkragen, als die Tür ins Schloß fiel. Er war noch immer fleckig und nass. Draußen regnete es seit Tagen.
Als sich Scheu wieder seinem Bildschirm zuwandte, blieb sein Blick kurz auf Imogens Gesicht haften, die ihn anstarrte. Er schluckte. Mit einer unsicheren Bewegung versuchte er das wellige schwarze Haar aus seiner gerunzelten Stirn zu streichen.
»Musst noch den Bericht schreiben? Brandschatzung in Binz, ja? Till Schmassmann ist ganz schön sauer, dass der Blick dermaßen übertrieben hat«, sagte sie.
»M-hm.«
»Hast du gut gemacht, übrigens.« Dann, nach einer Fuge der Stille: »Wir haben letzte Woche beim Kegelabend darüber gesprochen. Wirklich beeindruckend. Ich staune jetzt noch, dass der Typ gestanden hat. Und so zügig.« Wieder flüsterte der Hauch eines Lächelns auf ihren Lippen. Ihre Oberlippe war breiter und flacher als die untere. Das wirkte beruhigend.
Er würde schon mit ihr zurechtkommen. Irgendwie. Wenn er Schritt für Schritt vorginge. Wenn er ihre Triumphe ausblendete. Sich all das Weiß im Zimmer braun vorstellte. Den Kunststoff als Holz. Oder diesem Büro überhaupt keine Aufmerksamkeit schenkte. Wenn er, so wie immer, einfach das tat, was als Nächstes anstand.
Diesen Bericht verfassen zum Beispiel. Das Klingeln in seinem Ohr ignorierte er, als er seine Finger auf den Tasten platzierte. Mit vieren kam er ganz gut voran, wer sagt denn, dass es fürs Maschineschreiben zehn braucht. Und durch den Bildschirm hindurchsehen konnte diese Imogen auch nicht.
Sein eigenes kleines Tippkonzert folgte zwar einem deutlich langsameren Rhythmus, aber es klang doch flüssig, es klang sogar gut. Wenn er sich anstrengte, könnte ihm dieser Bericht bis heute Abend gelingen.
Keine zwei Zeilen und es klopfte. Imogen tippte ungerührt weiter. Scheu schnaufte laut auf und rief dann zur Türe hin: »René! Ja, endlich!«
Die Tür öffnete sich zögerlich. Herein trat eine schlanke Frau mit langen Haaren. Verdutzt schaute Scheu. Und brauchte einen Moment. Man ist ja nicht allein im eigenen Büro, vermutlich eine Besucherin für Imogen. Eine Freundin … Ein Pausenschwatz. Die Frau stand da, unschlüssig, weder draußen noch drinnen, eine Damenledertasche mit matt polierten Goldgriffen am Ellenbogengelenk. Und dann passierte alles gleichzeitig: Imogens Telefon klingelte, die Frau sagte irgendetwas an Scheu gerichtet, und schon sprang Imogen von ihrem Stuhl auf mit einem fröhlichen »Komme gleich« in den Hörer hinein und schlängelte sich neben der Fremden zur Tür hinaus.
In all den Jahren, in denen Leo Scheu bei der Kantonspolizei Zürich in Diensten stand, war es noch nie vorgekommen, dass eine Fremde unangemeldet in seinem Büro erschien. Fremde kamen nur, wenn sie vorbestellt waren, und dann wurden sie unten beim Empfang abgeholt und von Scheu selbst nach oben begleitet. Irgendjemand muss diese Frau – ohne mir vorher telefonisch Bescheid zu geben! – hierhergeführt haben. Der junge Windlin vielleicht. Einen kurzen Moment war Scheu in Versuchung, sein neues Telefon auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen, dann aber stand er lieber auf, wie sich das gehörte, und sagte, was er in dieser Situation für angemessen hielt: »Ja, bitte?«
»Sie sind Leandro Scheu, Ermittler bei der Kantonspolizei Zürich?«
»Der bin ich«, antwortete er, irritiert ob des heiseren Timbres, des ungewöhnlichen Akzents. Ein fremder Takt, der in ihrer Sprechweise mitschwang, obwohl ihr Deutsch grammatikalisch einwandfrei schien. Wenigstens für seine Ohren.
»Oh«, machte sie und dann noch einmal: »Oh. Ich bin so froh, dass ich Sie gefunden habe.«
»Wer hat Sie, Entschuldigung, hereingelassen?«
Sie überhörte seine Frage, oder sie wollte sie nicht beantworten. Stattdessen sagte sie den einen Satz, der auf Scheu wie ein Déjà-vu wirkte: »Dann bin ich ja nun angekommen«, und blickte ihn mit ernsten Augen an. »Bitte helfen Sie mir. Ich will meine Mutter wiederfinden.«
Scheu tat langsam einen Schritt hinter seinem Schreibtisch hervor. Das klang nun nicht nach einem Kapitalverbrechen. Das klang viel eher nach einer Vermisstensache. Dennoch, er wusste nicht, weshalb, zog er der Frau einen Stuhl heran und bat sie, sich doch bitte erst einmal hinzusetzen. Erst jetzt bemerkte er, dass sie ein grünes Seidenfoulard in ihren Händen umkrampft hielt. Vermutlich hatte sie es zum Schutz gegen den Regen getragen. Ihr Haar war zimtfarben, und nur an den Spitzen zapften Wassertropfen. Es sah aus wie verkochte Spargeln. Sie hatte lange schmale Hände mit langen schmalen Fingern und konisch zulaufenden Nägeln. Die Ringe, der eine milchig-grün besteint, der andere milchig-gelb, mussten Spezialanfertigungen sein. Wie sonst sollten sie an den beinahe glatten Fingergliedern halten, deren Knöchel keinerlei Verbreiterung bildeten? Er schätzte sie auf Mitte dreißig. Aber vielleicht war sie auch schon etwas älter und wusste ihr Alter zu kaschieren, manche Frauen waren meisterlich darin. Bei genauerem Hinsehen zerfächerten feine Haarrisslinien die blasse Haut um ihre Augen. Und auch um den Mund, der ein schmaler, ungeschminkter war, hatten sich diese Zeichnungen festgesetzt. Sie wirkte sanft und zerbrechlich. Verloren wie eine Elfe. Mit Schrecken merkte Scheu, dass er sie taxierte.
Sie lächelte kurz auf, ein Blitzen in ihren Augen, und Scheu spürte sie, er spürte sie ganz eindeutig: die zitternde Unversehrtheit, die Angst vor der Entdeckung eines Bruches, einer Beschädigung, die das vormalige Ganzsein irreparabel in Stücke sprengen würde. Er hatte diese Empfindung schon öfter gehabt, sie kam mit seinem Beruf. Sie war gefangen in dem Moment, der Nichtwissen von Wissen trennte. Dann zum Beispiel, wenn er einer Familie den gewaltsamen Tod eines Angehörigen beizubringen hatte. Oder dann, wenn er eine Mutter darüber aufklärte, dass ihr Sohn nicht der brave Junge war, den sie sich in ihrer Liebe ausgemalt hatte, sondern ein gemeiner Schläger. Scheu nannte diesen Zustand den Ruhepol des Nichtwissens, und es widerstrebte ihm jedes Mal, wenn er derjenige war, der Aufruhr in diese Ruhe bringen musste. In seinen Blick legte er dabei jeweils so viel Mitgefühl, wie ihm gestattet war, um dem harten Aufprall wenigstens ein bisschen die Wucht zu nehmen. Man musste dabei den Menschen Pausen gewähren. Stille zulassen. Aushalten. Nur ungern erinnerte er sich, wie Lutz in solchen Situationen mit vielen Worten versucht hatte, die Atmosphäre zu dominieren. Worte, die ja doch nie das eine zu sagen vermochten, es würde alles wieder gut, weil es das eben nie wieder werden würde, und nichts anderes aber wollte gehört sein, weil nichts anderes erträglich war. Außer eben Stille.
Diese Stille stand hier wie eine dritte Person im Raum. Nur dass nicht er sie aufgeboten hatte, sondern diese Frau hatte sie mit sich hereingetragen wie einen Schatten. Oder eine Erkältung, die einem im Nacken hockt.
Scheu räusperte sich. »Sie suchen also Ihre Mutter, habe ich das richtig verstanden?«
»Meine Mutter ist seit 1974 verschwunden. Sie war eine Zürcherin, sie stammt aus dem Seefeldquartier – warten Sie!« Das Tuch flatterte zu Boden, als die Frau beide Hände in einer Geste der Beschwichtigung hob. »Ich habe die Adresse im Kopf, sie wohnte damals an der Dufourstrasse …«
1974? Das war ja nun schon einige Jahre her, du meine Güte. Scheu räusperte sich etwas energischer und unterbrach die fremde Frau. »Sie sind aber nicht hier geboren, oder?«
»Doch. Doch doch doch, eben doch. Ich bin zwar adoptiert, aber gebürtige Schweizerin. Ich bin aus Rīga angeflogen. Aber ich stamme aus Schweden. Meine Eltern sind Schweden-Letten. Es ist alles ein bisschen kompliziert.«
Jemand auf dem Flur lachte, ein Zweiter stimmte ein. Scheu fiel auf, wie die Tür einen Spaltbreit geöffnet wurde. Seine Miene verdüsterte sich. Er durchmaß das Zimmer mit wenigen Schritten und schob die Türe sachte mit dem Fuß zu. Da hatte sich wohl einer einen Bubenstreich erlaubt. Eine Verwirrte zu ihm zu führen, das sah ihnen ähnlich. Ein Einstandspräsent. Vermutlich war beim Kegelabend nicht nur sein Binzer Ermittlungserfolg durchgehechelt worden, sondern seine nur knapp genügende Mitarbeiterbeurteilung ebenfalls. Wie nett, dass man ihm seinen ersten Arbeitstag in der Zweierzelle mit einem Klischee versüßen wollte: Polizeibeamter und geheimnisvolle Schöne – also wirklich.
Aber diese Fremde war nun einmal da, saß steif vor ihm, die Hände nun wieder im Schoß in ein Tuch gefaltet, die Augen flehend. Unter ihrem rechten fleckte braune Wimperntusche. Vielleicht, überlegte Scheu, war sie vom Regen in der Schweiz überrascht worden?
Der Binzer Bericht musste noch einmal warten.
Er würde dieses Gespräch schon hinauszuzögern wissen; hatte man sich ein Scherzlein mit ihm erlaubt? Nun, dann sollte man auch die Pointe dazu haben. Aber dann, wenn er sie für gekommen hielt. Sollten die anderen ruhig den Flur auf und ab laufen, bis sie Kamelfüße hatten. So schnell würde er dieses Scherzlein nicht aus der Hand geben. Zumal es für die Frau, die ihm da gegenübersaß, kein Scherzlein war, sondern … Scheu blickte in bittere, kühle Augen.
Aufmunternd probierte er: »Gemäß Klimatabelle regnet es im November in der Schweiz im Durchschnitt zehn Tage. Das heißt, wenn man es genau nimmt, dürfte es jetzt gar nicht mehr regnen.«
Ihre Schultern strafften sich, ihr Rücken wurde steif.
»Aber das Wetter hält sich nicht an Klimatabellen«, fuhr er fort und schloss dabei das Fenster, an dem kleine glitzernde Tropfen klebten.
Dann setzte er sich ihr aus einem plötzlichen Trotz heraus – war es das fehlende Holz, waren es Imogens Stiefelchen, Windlins Pappkarton? – schräg gegenüber auf seinen Stuhl, stützte die Handflächen auf den Oberschenkeln ab und sagte nicht ohne Güte: »Erzählen Sie. Es wird schon nicht die Sintflut sein.«
Kapitel 2
In dieser Nacht schlief Leo Scheu schlecht. Ihm träumte, er schaukle in einem Boot auf weiter See durch eine opake Dunkelheit, ganz ohne Stern. Er wusste, dass er träumte, und beobachtete sich selbst im Traum. Kein Land in Sicht. Nur er, ganz allein. Und als er endlich doch etwas neben sich auszumachen schien, ein fremdes Wesen mit ihm im Boot, und danach griff, schlüpfte es ihm zwischen den Händen durch, versank und verschwand lautlos im Schwarz des Meeres …
Er wachte auf. Langsam, zusammen mit den heimlichen Geräuschen der Nacht, fand das Bewusstsein zu ihm zurück. Draußen nieselte es, was der Dunkelheit einen fahlen Schleier verlieh. Scheu setzte sich in seinem Bett auf. Einer nach dem anderen glitten seine Füße auf den Boden. Er stützte sein Gesicht in beide Hände.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!