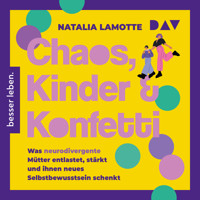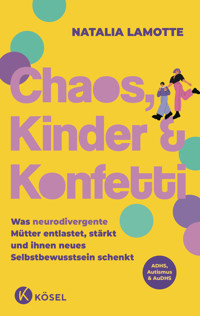
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der erste Ratgeber für neurodivergente Mütter
Erschöpft, gestresst und ständig überreizt: Viele Frauen verzweifeln an ihrer Mutterschaft. Doch manchmal macht ihnen nicht der Alltag das Leben so schwer, sondern eine unerkannte Neurodivergenz. Auch Natalia Lamotte, Doula und vierfache Mutter, erfuhr erst spät von ihrer ADHS. Dann aber fiel es ihr wie Schuppen von den Augen: Haben neurodivergente Menschen schon unter ›normalen Umständen‹ kein einfaches Leben, so stehen neurodivergente Mütter noch einmal vor ganz besonderen Herausforderungen. Ihre Grenzen, ihre Kräfte, ihre Überlebensstrategien: Auf all das nehmen Kinder keine Rücksicht. Vor allem nicht, wenn sie selbst betroffen sind, was häufig der Fall ist. In ihrem ebenso ermutigenden wie unterhaltsamen Ratgeber zeigt die Autorin allen neurodivergenten Müttern:
- die besten Tools, um das tägliche Chaos in den Griff zu bekommen,
- erfolgreiche Stressbewältigung und gutes Bedürfnismanagement,
- wie sie vermeintliche Schwächen zu Stärken machen,
- die relevanten Stellschrauben im Miteinander als Familie.
Ein Buch voller Bestärkungen und Strategien, um als neurodivergente Mutter selbstbewusst, gelassen und gesund zu leben!
Als ich Mutter wurde, brachen bei mir alle Masking-Dämme. Und dann war sie endlich da – die Diagnose. Doch nach dem ersten »Juhu!« kam das »Und nu?«. Eine Frage, die Natalia in diesem so wundervollen wie hilfreichen Buch einfühlsam, ehrlich und alltagsnah beantwortet. Saskia Niechzial, Bestsellerautorin (»Ein Kopf voll Gold«)
Ein liebevoller Blick auf ADHS – jenseits von Modediagnose und Selbstvorwurf. Natalia schreibt warmherzig und alltagsnah über innere Freundlichkeit und praktische Wege zu mehr Flexibilität im Familienleben. Nicola Schmidt, Bestsellerautorin und Gründerin des artgerecht-Projekts
Dieser Tauchgang hat es in sich. Natalia verknüpft Fachwissen mit persönlichen Erfahrungen und schafft es, das Chaos der Neurodivergenz fassbar zu machen. Ich habe mich gesehen, gefordert, gehalten und vor allem: weniger einsam gefühlt. Als neurodivergentes Elternteil ist dieses Buch für mich Pflicht! Yassamin-Sophia Boussaoud, Autor*in
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
MUTTERSCHAFTMEETSNEURODIVERGENZ
Die permanente Gratwanderung zwischen Überforderung und Selbstzweifeln, zwischen Chaos und Perfektionismus kennen viele Frauen aus dem Familienalltag. Doch ADHS hält für Mütter zusätzliche Herausforderungen bereit, zum Beispiel durch Prokrastination, Impulsivität und Reizempfindlichkeit. Aus ihrer eigenen Erfahrung als spätdiagnostizierte ADHSlerin bietet Natalia Lamotte neurodivergenten Müttern flexible Tools und effektive Impulse, um ihre eigenen Stärken zu nutzen und ihren Alltag einfacher zu gestalten.
Ein Buch voller Bestärkungen und Strategien, um als neurodivergente Mutter selbstbewusst, gelassen und gesund zu leben!
Ein liebevoller Blick auf ADHS – jenseits von Modediagnose und Selbstvorwurf. Natalia schreibt warmherzig und alltagsnah über innere Freundlichkeit und praktische Wege zu mehr Flexibilität im Familienleben.
Nicola Schmidt, Bestsellerautorin und Gründerin des artgerecht-Projekts
Ich habe mich gesehen, gefordert, gehalten und vor allem: weniger einsam gefühlt. Als neurodivergentes Elternteil ist dieses Buch für mich Pflicht!
Yassamin-Sophia Boussaoud, Autor*in
Als ich Mutter wurde, brachen bei mir alle Masking-Dämme. Und dann war sie endlich da – die Diagnose. Doch nach dem ersten »Juhu!« kam das »Und nu?«. Eine Frage, die Natalia in diesem so wundervollen wie hilfreichen Buch einfühlsam, ehrlich und alltagsnah beantwortet.
Saskia Niechzial, Bestsellerautorin (»Ein Kopf voll Gold«)
NATALIALAMOTTE hat Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität in München studiert, ist nebenberuflich emotionale Geburtsbegleiterin (Doula) und leitet Kurse für Geburts- und Geschwistervorbereitung. Sie hat mit ihrer Schwester Sarah im deutschsprachigen Raum den Begriff »Muttertät« geprägt, hält Vorträge und gibt Interviews zum Thema. Auf ihrem Instagram-Account klärt sie rund um Geburt und Mutterwerden auf – und darüber, wie ihre eigene, spät diagnostizierte ADHS ihr Familienleben prägt. Natalia Lamotte hat vier Kinder und lebt in München.
NATALIA LAMOTTE
Chaos, Kinder & Konfetti
Was neurodivergente Mütter entlastet, stärkt und ihnen neues Selbstbewusstsein schenkt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Dr. Katharina Theml, Büro Z, Wiesbaden
Umschlaggestaltung: buxdesign | Daniela Hofner unter Verwendung von Motiven von AdobeStock
Innenteilabbildungen: © Good Studio / Adobe Stock.com
Satz: Uhl + Massopust GmbH, Aalen
ISBN 978-3-641-32888-7V004
www.koesel.de
Inhalt
Vorab
Wie schön, dass du da bist!
Was bedeutet Neurodivergenz?
Neurodivergent oder neurodivers? Der kleine, aber wichtige Unterschied
Kapitel 1 Von der Muttertät ins Erkennen – Elternschaft meets Neurodivergenz
Zufallsdiagnose durch Elternschaft
Vom Profi zur Anfängerin: Wie Mutterschaft alte Strategien ins Leere laufen ließ
Alles nur zu viel Stress? Wenn Überforderung keine Phase ist
ADHS und Autismus: Ein Trend oder einfach nur endlich sichtbar?
Angepasst, leistungsorientiert und übersehen: Warum ich so spät zu meiner Diagnose kam
Wie weibliche Hormone neurodivergente Merkmale beeinflussen können
Komorbiditäten als zusätzliche Hürde: Wenn Begleiterkrankungen Diagnosen im Weg stehen
Kapitel 2 Zwischen Wäschebergen und Weltuntergang – Alltagsbewältigung für neurodivergente Mütter
Gesellschaftliche Faktoren: Doppelte Standards, mehr als doppelte Last
Unvorhersehbar, intensiv, herausfordernd: Besondere Umstände und ein neuer Alltag
Masking – eine Bewältigungsstrategie, die auf Dauer schadet
Warum neurodivergente Eltern mit eigenen Regeln besser leben
Kapitel 3 Werkzeugkiste für besonders herausfordernde Phasen
Wie Achtsamkeit das Stresslevel von Eltern nachweislich verändern kann
Kooperation ohne Kämpfe: Wie PANDA Druck rausnimmt – für Eltern und Kinder
Neurodivergentes Familienleben (PDA-Profil) – Interview mit Anna Bamberger
Kapitel 4 Emotionen entwirren – stabil bleiben, wenn alles wackelt
Co-Regulation? Gerne! Aber wer reguliert eigentlich mich?
Was neurodivergente Mütter entlastet und stärkt
Schwierigkeiten mit Ablehnung – Rejection Sensitive Dysphoria (RSD)
Was kann helfen, mit den Herausforderungen der Zurückweisungsempfindlichkeit zurechtzukommen?
Kapitel 5 Vergessen, verzetteln, verzweifeln? Wie dein Gehirn funktioniert (und was ihm hilft)
Veränderung ist machbar – wenn sie zu dir passt
Motivation und Freude statt Selbstdisziplin
Wie regelmäßige Abläufe helfen, Energie zu sparen und den Alltag zu vereinfachen
Gamification – mit Spiel und Spaß Herausforderungen meistern
Die Kraft der Kreativität – langweilige Informationen leichter merken
Hyperfokus – Geschenk oder Gefängnis?
Das »interessensbasierte Gehirn« versus das »prioritätsbasierte Gehirn« – ein Modell zur Erklärung der Motivation bei neurodivergenten Menschen
»Wo ist …?« und andere Suchhelfer
Kapitel 6 Du bist nicht allein – was uns wirklich stärkt
Wie Selbsthilfegruppen dich stärken können
Warum Gleichberechtigung in neurodivergenten Familien eine wichtige Überlebensstrategie ist
Professionelle Hilfen: Therapie und (außer-)familiäre Betreuung
Make a wish: Was neurodivergente Eltern wirklich brauchen
Das Beste zum Schluss: »Anders, aber völlig richtig im Kopf«
Literatur
Empfehlungen
Anmerkungen
Vorab
Ein kurzer, aber wichtiger Einschub, bevor du weiterliest:
Dieses Buch erzählt eine subjektive Geschichte – meine. Ich schreibe aus der Perspektive einer weißen cis Frau in einer hetero Beziehung mit Zugang zu bestimmten Ressourcen. Ich weiß, dass viele das nicht haben – und dass Neurodivergenz unter anderen Bedingungen ganz anders aussehen kann.
Auch wenn ich meine Stimme erhebe, will ich damit keine andere übertönen. Neurodivergenz ist vielfältig. Manche leben damit gut, andere brauchen tägliche Unterstützung. Manche sind sichtbar(er), andere werden systematisch übersehen.
Ich verwende in diesem Buch vor allem den Begriff »Mütter«, weil ich aus dieser Rolle heraus schreibe. Viele Erfahrungen und Impulse gelten jedoch ebenso für andere neurodivergente Eltern, die sich in ähnlichen Dynamiken wiederfinden – unabhängig von Geschlecht, Familienform oder Selbstbezeichnung.
Ich wünsche mir, dass du dich – ganz gleich, wie dein Alltag aussieht oder wie viel Kraft er gerade braucht – in diesem Buch gesehen fühlst. Und falls sich etwas utopisch liest, dann liegt das nicht an dir. Sondern an einer Gesellschaft, die noch immer zu wenig Raum schafft für echte Vielfalt, Fürsorge und Teilhabe.
Dieses Buch ist keine Diagnoseanleitung und kein Allheilmittel. Es ist ein Mutgeber. Ein Mutgeber – voller Ideen, Anekdoten und wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse.
Wie schön, dass du da bist!
Lesezeit: 3 Min.
Herzlich willkommen in meinem Buch! Ich habe es geschrieben, weil ich es selbst so dringend gebraucht hätte – in einer Zeit, in der ich vieles nicht einordnen konnte. Zwischen dem konkreten Verdacht auf ADHS und der späten Diagnose verschlang ich alles, was ich über weibliche Neurodivergenz finden konnte. Ich fand Wissen, Trost und Aha-Momente, doch eins fehlte mir immer: ein Buch wie dieses.
Ein Buch für Mütter, die gleichzeitig sich selbst und andere regulieren müssen. Für Eltern die funktionieren, obwohl sie innerlich besonders schnell auf Reserve laufen. Für die, die sich fragen, wie Selbstfürsorge bitte in einen Alltag passen soll, wenn oft nicht mal ein Klogang ungestört möglich ist.
Ich wünschte mir konkrete Tipps für einen fremdbestimmten Alltag, flexible Wege statt starrer Pläne. Ich suchte nach Antworten – und stieß meist nur auf ein kurzes Unterkapitel zur neurodivergenten Elternschaft. Doch ich wollte mehr. Ich wollte, dass unsere Perspektive nicht nur vorkommt, sondern im Mittelpunkt steht.
Vielleicht fühlst du dich oft »anders«. Denkst schneller, fühlst intensiver, reagierst heftiger und vergisst mehr. Vielleicht fragst du dich, ob das normal ist – und ob es andere gibt, denen es genauso geht.
Die Antwort ist: Ja.
Dieses Buch ist für dich. Es soll dir zeigen: Du bist nicht allein – und du bist goldrichtig, genau so, wie du bist.
Viele von uns entdecken ihre Neurodivergenz erst in der Mutterschaft – manchmal, weil unsere Kinder uns den Spiegel vorhalten. Manchmal, weil der trubelige Familienalltag plötzlich zeigt, was wir vorher gut kompensieren konnten. Eine meiner größten Ängste war die Frage, ob ADHS unsere elterliche Feinfühligkeit so beeinflusst, dass wir unseren Kindern nicht genug geben – oder nicht das, was sie brauchen. Und gleichzeitig geht es auch darum, wie wir lernen können, uns selbst mit mehr Nachsicht zu begegnen, statt uns immer wieder infrage zu stellen.
Dafür wollte ich herausfinden:
Wo liegen die typischen Druckpunkte neurodivergenter Mutterschaft? Welche Situationen bringen uns an unsere Grenzen und warum? Ist es der permanente Geräuschpegel? Das ständige und oft unfreiwillige Switchen zwischen Aufgaben? Oder die unausgesprochenen Erwartungen, wie eine »gute Mutter« zu sein hat?Wie beeinflusst unsere besondere Wahrnehmung die Elternschaft? Viele von uns spüren mehr – schneller, intensiver, unmittelbarer. Das kann Nähe, Freude und Intuition vertiefen, aber auch Überforderung und Reizstress auslösen. Manchmal schweifen wir dadurch auch schneller ab.Welche inneren Schätze übersehen wir oft bei uns selbst? Inmitten von Alltag und Chaos gehen sie oft unter: unsere Kreativität, unsere Empathie, unser Gespür für Ungerechtigkeit oder unsere Fähigkeit, außerhalb der Norm zu denken. Zeit, sie (wieder)zuentdecken.Ich kann dir deinen Struggle nicht wegzaubern, aber ich kann dir Wege und Abkürzungen zeigen, die entlasten. Wissen zur Verfügung stellen, um deine Herausforderungen besser einzuordnen und zu verstehen. Werkzeuge, die in dein echtes Leben passen. Keine Perfektion, kein Druck – nur Ideen, die du ausprobieren und abwandeln kannst.
Du musst hier nichts leisten. Nur atmen, lesen und fühlen, was zu dir passt. Unser Alltag ist selten durchschnittlich – also brauchen wir auch keine durchschnittlichen Lösungen.
Bevor wir loslegen, schaffen wir gemeinsam ein Verständnis für ein paar zentrale Begriffe und starten mit der Frage:
Was bedeutet Neurodivergenz?
Lesezeit: 1 Min.
Der Begriff Neurodivergenz wurde in den 2000ern von der neurodivergenten Aktivistin Kassiane Asasumasu eingeführt. Er ist aus dem Konzept der Neurodiversität entstanden, das die Soziologin Judy Singer in den 1990ern bekannt machte. Während Neurodiversität die gesamte Bandbreite neurologischer Vielfalt beschreibt, meint Neurodivergenz die Menschen, deren neurologische Entwicklung oder Funktionsweise von dem abweicht, was in unserer Kultur und Gesellschaft als »typisch« oder »normal« gilt.
Diese Abweichung kann sowohl angeboren (zum Beispiel Autismus) als auch erworben (zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörung, PTBS) sein. Dazu gehören Menschen mit einer oder mehreren Diagnosen wie zum Beispiel ADHS, Essstörungen, Hochbegabung, Legasthenie oder dem Downsyndrom, aber auch solche ohne formale Diagnose wie Hochsensible und Synästheten. Kurz gesagt: Es geht um die Vielfalt der Gehirne.
Diese zeigt sich in unterschiedlichen Verhaltensmustern, Reizverarbeitungen und Denkweisen und damit in individuellen Stärken, Herausforderungen und Bedürfnissen.
Zwei neurodivergente Menschen können dabei völlig unterschiedliche Erfahrungen machen. Was für eine Person belastend ist, kann für eine andere eine Ressource sein.
Neurodivergent oder neurodivers? Der kleine, aber wichtige Unterschied
Lesezeit: 2 Min.
Immer wieder liest man von einer »neurodiversen Person« – sogar in renommierten Magazinen. Eigentlich müsste es aber »neurodivergent« heißen, denn:
»Neurodivers« meint die neurologische Vielfalt einer Gruppe.»Neurodivergent« beschreibt eine einzelne Person, deren neurobiologische Funktion (Wahrnehmung) von der Norm abweicht.Die Menschheit insgesamt ist also neurodivers, einzelne Menschen dagegen sind entweder neurotypisch oder neurodivergent.
Ein soziopolitischer Begriff mit Licht und Schatten
Neurodivergenz ist kein medizinischer Begriff, sondern ein soziopolitisches Konzept – ein sogenanntes Softlabel. Viele Menschen einer neurologischen Minderheit nutzen es, um sichtbar zu machen: Hey, ich bin anders, und das ist absolut okay.
Dieser Begriff schafft Raum dafür, neurologische Unterschiede nicht als Krankheiten oder Defizite zu verstehen, sondern als Teil einer natürlichen menschlichen Vielfalt. Diese soziale Bewegung (Neurodiversitätsbewegung) setzt sich für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und den Abbau von Diskriminierung ein.
Der Begriff ist offen und inklusiv und hebt hervor, dass neurodivergente sowie neurotypische Menschen gemeinsam das große Bild der Neurodiversität formen – ein Facettenreichtum, der, inspiriert von der Biodiversität der Natur, all unsere individuellen neurologischen Unterschiede anerkennt und wertschätzt.
Gleichzeitig gibt es aber auch Kritik am Konzept Neurodivergenz:
Ein Label ohne konkrete Unterstützung: Das Wort »neurodivergent« macht sichtbar, aber es bietet keine direkte Hilfe für die Herausforderungen. Im Gegensatz zu einer Diagnose, die Türen zu konkreten Hilfsangeboten öffnet, während das Label allein keine Lösungen bietet. Besonders Menschen, die auf intensive Unterstützung angewiesen sind, profitieren zunächst wenig davon.Gefahr der Reduktion: Manche fürchten, dass der Begriff die neurologische Besonderheit zu stark in den Vordergrund rückt, während andere Fähigkeiten, Interessen und Persönlichkeitsmerkmale übersehen werden.Verzerrung durch privilegierte Stimmen: In der öffentlichen Wahrnehmung dominieren meist nur die Stimmen von Menschen, die mit ihrer Neurodivergenz gut leben können. Sie können sich dank Privilegien Gehör verschaffen – und wie ich, sogar ein Buch schreiben. Dadurch entsteht der Eindruck, als könnten alle neurodivergenten Menschen problemlos leben.Doch das entspricht nicht der Realität. Besonders jene, die stärkere Einschränkungen oder intensive Unterstützung benötigen, bleiben oft unsichtbar. Diese Verzerrung sollten wir stets im Hinterkopf behalten, wenn wir über dieses eigentlich inklusive Konzept sprechen. Ich schreibe aus meiner Perspektive, aber auch mit dem Bewusstsein: Nicht alle Eltern haben ein unterstützendes Umfeld, körperliche Gesundheit oder einen Partner oder eine Partnerin an ihrer Seite. Für viele ist der Alltag durch Pflegeverantwortung, Behinderung oder Alleinerziehendsein noch herausfordernder. Wenn dir das, was ich hier beschreibe, manchmal unerreichbar erscheint, dann liegt das nicht an dir – sondern an Strukturen, die nicht für Gleichberechtigung gemacht sind.
In diesem Buch möchte ich die wertschätzende und inklusive Perspektive der Neurodiversitätsbewegung auf die Vielfalt unserer Gehirne nicht nur einnehmen, sondern in den Vordergrund stellen. Deshalb verzichte ich – mit Ausnahme des Abschnitts zur Geschichte der Diagnostik – bewusst auf Begriffe wie »Symptome« und »Betroffene«, die oft mit Krankheit oder negativem Schicksal assoziiert werden. Stattdessen spreche ich von
Menschen mit ADHS oder Autismus,Autist*innen undbevorzuge Begriffe wie »Ausprägungen«, »Merkmale« oder »Besonderheiten«.Gerade in der Mutterschaft, wenn mentale Belastung, soziale Erwartungen und hormonelle Veränderungen aufeinanderprallen, zeigen sich neurodivergente Merkmale oft intensiver als zuvor.
Dieses Buch ist für all jene, die sich fragen: Warum ist vieles für mich so herausfordernd – mache ich etwas falsch?
Spoiler: Es liegt nicht an dir.
Hier geht es nicht darum, etwas »zu heilen«, sondern sich selbst zu verstehen – mit all den Stärken, Schwierigkeiten und Besonderheiten, die neurodivergente Mutterschaft mit sich bringen kann.
Kapitel 1 Von der Muttertät ins Erkennen – Elternschaft meets Neurodivergenz
Als junge Erwachsene hielt ich mich für entspannt und flexibel – Veränderungen machten mir nichts aus, und meine Emotionen waren relativ ausbalanciert. Dann kamen diese winzigen und unglaublich weichen Menschen in mein Leben, die mit ihren Mittagsschläfchen und Stillphasen meinen Tagesrhythmus bestimmten, als hätte ich nie einen eigenen besessen. Plötzlich war mein Leben streng getaktet und gleichzeitig vollkommen chaotisch. Ich fühlte mich so fremdbestimmt und abhängig wie zuletzt in meiner eigenen Kindheit.
Vielleicht kennst du das Gefühl, erschöpft zu sein, obwohl man nichts wirklich Sichtbares geleistet hat. Ich funktionierte in Dauerschleife, wurde ständig unterbrochen und sah am Ende des Tages trotzdem kein greifbares Ergebnis. Neu war auch das Gefühl, »over touched« zu sein – sensorisch komplett überreizt durch die ständige körperliche Nähe meiner Kinder. Einerseits genoss ich sie, andererseits war sie ein unausweichlicher Teil meines Alltags. Denn mit Kleinkindern gibt es keine persönliche Komfortzone, nur eine gemeinsam genutzte Körperfläche.
Am Ende des Tages wollte ich von niemandem mehr berührt werden oder auch nur jemanden in meiner Nähe haben. Und als wäre das nicht schon genug, wurde ich von Emotionen überrollt, die sich so schnell abwechselten, dass sie manchmal gleichzeitig existierten. In einem Moment dachte ich, ich explodiere gleich vor Wut – im nächsten schmolz ich vor überwältigender Liebe dahin. Besonders in der nie enden wollenden Einschlafbegleitung. Irgendwann begann ich ernsthaft zu zweifeln, ob mit mir alles in Ordnung ist. So aufgewühlt und gereizt hatte ich mich noch nie erlebt.
Heute weiß ich: Ich befand mich in einer Übergangsphase – der »Muttertät«[1]. Ähnlich wie die Pubertät, nur dass kaum jemand diesen Begriff kennt, es keine richtige Unterstützung gibt und der absurde Glaube vorherrscht, dass du das Muttersein ganz allein schaffen musst. Am besten instinktiv richtig, souverän und mit einem Dauerlächeln im Gesicht.
Nach meinem turbulenten Studium konnte ich mein angeknackstes Selbstbewusstsein im ersten Job durch Lob und Wertschätzung von Kolleg*innen und Vorgesetzten langsam aufpäppeln. Mein Alltag wirkte die meiste Zeit aufgeräumt, erwachsen und (neurotypisch) unauffällig. Natürlich wollte ich in meiner neuen Rolle als Mutter an diesen Erfolg anknüpfen und auch hier mit Engagement sowie überdurchschnittlicher Leistung glänzen. Fast schon willkommen schien mir da die zusätzliche Herausforderung, nicht nur ein Kind, sondern, Überraschung, bereits elf Monate später gleich ein zweites zu haben.
Mein Plan war klar: Niemand sollte mir das Chaos mit zwei Kindern unter zwei, einem Hund und einem Teilzeitjob anmerken. Auch weil ich fälschlicherweise tief verinnerlicht hatte, dass Überforderung als persönliches Versagen gilt. Immer gut organisiert, entspannt, alles im Griff – und natürlich ohne nennenswerte Hilfe. Genau so wollte ich gesehen werden.
Für die zusätzliche Herausforderung (zwei kleine Kinder unter zwei zu haben) gab es immerhin ab und zu ein »Oh, wow!« von der Gesellschaft – eine Anerkennung, die ich aus der Erwerbsarbeit so sehr vermisste. Außerdem hatte ich mir das alles ja auch selbst ausgesucht, oder? Und wer sich etwas aussucht, der darf sich dann nicht auch noch beschweren.
Doch jedes Mal, wenn die Haustür hinter mir ins Schloss fiel, stürzte mein sorgfältig aufgebautes Kartenhaus in sich zusammen. Ich scheiterte an meinen eigenen, viel zu hohen Ansprüchen – immer wieder, jeden Tag, jede Stunde.
Zufallsdiagnose durch Elternschaft
Lesezeit: 11 Min.
Ich weiß noch, wie erleichtert ich war, als ich es in der Oberstufe endlich geschafft hatte, mich nach Jahren des knappen Durchkommens zu organisieren (auch wenn ich trotzdem immer einen Tag zu spät mit dem Lernen begann). Endlich hatte ich im Sommer vor Notenschluss keinen Stress mehr mit freiwilligen Referaten, extra Hausarbeiten und allem, was mir sonst noch irgendwie ein paar Punkte retten konnte.
Mit einem überraschend guten Abitur und dem Gefühl, unsterblich zu sein, startete ich an der Uni – nur um drei Semester später schmerzhaft zu realisieren, dass man wirklich exmatrikuliert wird, wenn man dreimal in »Investition und Finanzierung« durchfällt. Es dauerte vier weitere Semester, bis ich mit dem Uni-Leben warm wurde, aber dann blieb ich es bis zum Diplom.
Auch der Übergang in die Elternschaft erforderte zunächst eine Unmenge an Anpassung und Organisation – beides Dinge, die viele ADHSler*innen lieben. Gleichzeitig müssen gefühlt jeden Tag lebensverändernde Entscheidungen für mindestens einen weiteren Menschen getroffen werden. Und ständig wird dir suggeriert, dass jede einzelne davon verheerende Folgen für das gesamte Leben oder den Charakter deines Kindes haben könnte.
So habe ich es jedenfalls empfunden: Es gab kein Richtig oder Falsch – nur Falsch. Egal, ob es um Nahrung, Schnuller oder Schlaf ging. Beim ersten Kind hatte ich ein megaschlechtes Gewissen, weil ich dachte, ich hätte mit einem »falschen« Beikostplan seinen Darm nachhaltig geschädigt. Damals ahnte ich noch nicht, dass dieser kleine Darm sich in den nächsten vier Jahren hauptsächlich von »nackten« Nudeln und Butterbroten ernähren würde – und trotzdem erstaunlich gut damit zurechtkäme.
Elternsein ist wirklich ein wildes Abenteuer – es katapultiert dich in höchste Höhen und tiefste Tiefen, ist ständig fordernd, aber auch fördernd. Es krempelt unsere Beziehungen um, verändert, wie wir die Welt sehen, unser Körper(-gefühl) und – nicht zu vergessen – unsere gesamte Identität.
Wenn Mutterschaft neurodivergente Merkmale verstärkt
Funfact: Während Schwangerschaft, Geburt und der ersten Zeit danach wird unser Gehirn (laut Gehirnscans) so stark umgebaut wie sonst nur in der Pubertät. Plötzlich tauchen Seiten an dir auf, die du entweder noch nie wahrgenommen oder geschickt verdrängt hast.
Diese Übergangsphase (Muttertät) braucht Zeit, Geduld und vor allem jede Menge Support – denn sie ist genauso entscheidend und vulnerabel wie die Pubertät. Nicht nur das Kind entwickelt sich ständig weiter, auch seine engen Bezugspersonen wachsen wortwörtlich mit und erlernen ständig neue Fähigkeiten.
Inmitten all der Windeln, Wolle-Seide-Klamotten und tiefschwarzen Augenringe fühlen sich Emotionen oft intensiver an – oder bisher unbekannte Ängste tauchen plötzlich auf. Wenn der neue Alltag keinen Raum mehr für persönliche Bedürfnisse und echte Regeneration lässt – und ich rede hier nicht von Grundbedürfnissen wie Duschen oder Essen –, wird das Nervenkostüm immer dünner. Erschöpfung lässt dann nicht lange auf sich warten, und Überforderung wird zum ständigen Hintergrundrauschen.
Schlechter oder viel zu kurzer Schlaf, unregelmäßige Mahlzeiten und eine Flut an sensorischen Reizen verstärken das Ganze zusätzlich. Die ständige mentale Last und das Gefühl, für alles verantwortlich zu sein, wirken dabei wie eine Lupe auf unsere neurodivergenten Besonderheiten – sie machen alles deutlich sichtbarer und spürbarer.
Elternschaft wirkt oft wie ein Katalysator für vorhandene ADHS-Merkmale: Sensorische Überreizung, Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation, Vergesslichkeit oder Organisationsprobleme können plötzlich stärker hervortreten.
Der Schlüssel zur ADHS-Diagnostik bei Erwachsenen: Neurodivergente Elternschaft
Allgemein sind Lebensphasen mit großen Veränderungen und neuen Strukturen – wie ein Jobwechsel ins Ausland oder der Übergang von der klar strukturierten Schulzeit in das selbstbestimmte, oft chaotische Uni-Leben – für neurodivergente Menschen besonders herausfordernd. Denn sie erfordern radikale Anpassungen bewährter Bewältigungsstrategien an neue Strukturen. Es gibt zurzeit keine spezifischen Statistiken darüber, wie viele Frauen erst während der Mutterschaft mit ADHS oder Autismus diagnostiziert werden. Allerdings wird in der Fachliteratur darauf hingewiesen, dass Frauen häufig erst im Erwachsenenalter (30 bis 40 Jahre), insbesondere in Phasen erhöhter Belastung wie der Mutterschaft, eine Diagnose erhalten.
Nicht selten dauert es sogar so lange, bis ihr eigenes Kind beginnt, Merkmale zu zeigen und damit dann spätestens in der Schule (negativ) aufzufallen. Dadurch setzen sich Eltern erstmalig intensiver mit den Ausprägungen und Merkmalen neurodivergenter Zustände auseinander und entdecken dabei häufig Parallelen zu sich selbst. Sie beginnen, ihre eigene Geschichte neu zu betrachten, und stellen dabei nicht selten fest, dass auch für sie selbst eine Diagnose infrage kommen könnte.
Lange Zeit galt ADHS als eine Störung, die nur Kinder betrifft. Anfangs wurde sie als »Hyperkinetische Reaktion des Kindesalters« oder »Minimal Brain Dysfunction (MBD)« bezeichnet.[2] Paul H. Wender und seine Kollegen begannen ab 1976 mit Studien, die bereits andeuteten, dass ADHS-Symptome nicht nur in der Kindheit, sondern auch im Erwachsenenalter auftreten können. Diese Forschung führte später zur Entwicklung spezifischer Diagnosekriterien für Erwachsene wie der Wender Utah Rating Scale, die auch heute noch in der Diagnostik verwendet wird, um ADHS-Symptome retrospektiv zu bewerten.[3]1980 wurde ADHS erstmals offiziell im DSM-III – der dritten Auflage des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen der American Psychiatric Association (APA) – als »Aufmerksamkeitsdefizitstörung« (ADD) aufgenommen. Dabei unterschied man zwischen einer Form mit und einer ohne Hyperaktivität. Die Diagnose war nur für Kinder gedacht, da weiterhin angenommen wurde, dass sich eine ADHS mit der Pubertät »verwächst«. 1987 wurde der Begriff im DSM-III-R in »Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung« (ADHS/ADHD) geändert, um alle Varianten der Störung besser zu erfassen.[4] Mit steigenden Diagnosen bei Kindern erkannten viele Eltern ihre eigenen ADHS-Ausprägungen. Langzeitstudien und neurologische Forschungen belegten schließlich, dass ADHS eine lebenslange, neurobiologisch verankerte Besonderheit ist.
Ein entscheidender Durchbruch folgte in den 1990er-Jahren mit der Veröffentlichung des DSM-IV: ADHS wurde nun offiziell als lebenslange Störung anerkannt, nicht mehr nur als Kinderkrankheit. Erwachsene konnten erstmals diagnostiziert werden, sofern nachweisbar war, dass die Ausprägungen bereits in der Kindheit bestanden. Die Diagnosekriterien blieben jedoch auf Kinder ausgerichtet, sodass Erwachsene dieselben Symptome nachweisen mussten – obwohl sich ADHS im Erwachsenenalter oft anders äußert. Viele Menschen mit ADHS lernen zum Beispiel, ihre Impulsivität mit der Zeit besser zu kontrollieren. Die Hyperaktivität, die im Kindesalter oft besonders ausgeprägt ist, wandelt sich im Erwachsenenalter häufig in eine innere Unruhe oder Getriebenheit um. Die Aufmerksamkeitsstörung hingegen bleibt bei fast allen – unabhängig vom Alter – bestehen und stellt im Alltag oft die größte Herausforderung dar. Unerkannt steigen mit zunehmendem Alter oft auch Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) wie Angststörungen oder Depressionen an (siehe Abbildung[5]).
Änderung der Leitsymptome und Komorbiditäten mit dem Lebensalter[6]
Erst im DSM-V (2013) wurden die Diagnosekriterien für ADHS bei Erwachsenen endlich angepasst. Die Altersgrenze für das Auftreten erster Symptome wurde von sieben auf zwölf Jahre angehoben. Diese Anpassung erleichtert insbesondere die Diagnose bei Frauen, deren ADHS-Merkmale in der Kindheit häufig übersehen wurden – nicht, weil sie nicht da waren, sondern weil sie weniger auffielen.
Warum Frauen oft erst spät diagnostiziert werden
Frauen erhalten eine ADHS- oder Autismus-Diagnose meist deutlich später als Männer. Während das Verhältnis der ADHS-Diagnosen bei Kindern etwa 4:1 (Jungen zu Mädchen) beträgt, gleicht es sich im Erwachsenenalter auf 1,5:1 (Männer zu Frauen) an.[7] Mögliche Gründe für die späte Diagnose bei Frauen sind:
Weibliche Sozialisierung: Mädchen lernen früh, sich anzupassen. Sie werden für Rücksichtnahme und Selbstkontrolle gelobt – und tun genau das oft so gut, dass ihre neurodivergenten Merkmale kaum sichtbar sind.Masking: Viele Frauen kompensieren ihre Schwierigkeiten durch Überanpassung. Sie beobachten andere, imitieren soziale Codes und investieren enorme Energie, um »normal« zu wirken. Das funktioniert häufig jahrelang – bis die Anforderungen steigen und ihre (unbewussten) Strategien nicht mehr ausreichen.Männlich geprägte Diagnosekriterien: Bis heute sind viele Merkmale, die in Diagnosekatalogen beschrieben werden, an Jungen und Männer angepasst. Mädchen im Autismus-Spektrum werden eher als »sensibel« oder »schüchtern« wahrgenommen, nicht als autistisch. Mädchen mit ADHS gelten vermehrt als »verträumt« und »schusselig«.Da sich die Merkmale über die Lebensspanne verändern, werden nun zunehmend altersgerechtere Ausdrucksformen berücksichtigt – etwa Probleme mit Selbstorganisation, emotionale Dysregulation oder chronische Überforderung. Außerdem wurde die Anzahl der für eine Diagnose erforderlichen Kriterien bei Erwachsenen im DSM-V von sechs auf fünf gesenkt, um abzubilden, dass sich manche Merkmale im Laufe des Lebens ganz abschwächen oder anders äußern können.[8]
Diese Anpassungen waren längst überfällig. Denn viel zu lange galt ADHS als etwas, das nur »kleine Jungs, die nicht still sitzen können« betrifft. Dass es sich um eine lebenslange neurologische Variante handelt, die je nach Alter, Geschlecht und Umgebung völlig unterschiedlich aussehen kann, wurde systematisch ignoriert. Dieser Mythos hält sich leider bis heute.
Bei mir hat es vier Jahre gedauert, bis ich eine Diagnose erhielt – gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem ich zum ersten Mal eine Therapie begann. Im Vergleich zu Männern oder Jungen, die oft schon mit sechs oder sieben Jahren diagnostiziert werden, war meine Diagnose also um fast 32 Jahre verspätet.
Die meisten Frauen erhalten ihre Diagnose erst im Erwachsenenalter, wenn ihr Leben sie vor Herausforderungen stellt, auf die ihre alten Bewältigungsstrategien nicht mehr passen. Rückblickend erinnern sie sich an auffällig viele vergessene Termine, verlorene Gegenstände oder die Überforderung in sozialen Situationen. All das hielten sie lange für persönliche Makel. Eltern bemerken oft schon früh, dass ihrer Töchter in bestimmten Bereichen Schwierigkeiten haben, lange bevor sie außerhalb der Familie auffallen. Im sicheren, vertrauten Umfeld zeigen sich neurodivergente Merkmale oft deutlicher, weil Verstellen seltener nötig ist. Plötzlich wird sichtbar, wie viel Kraft das tägliche Funktionieren kostet. Zum Beispiel reagieren Kinder oft schneller auf emotionale Überforderung mit Meltdowns – unkontrollierbaren Reaktionen auf Reizüberflutung, die sich durch Weinen, Schreien oder Wut äußern. Auch Schwierigkeiten mit Struktur und Organisation sind oft ausgeprägter als bei Gleichaltrigen – ein Punkt, der sich in meinen Grundschulzeugnissen besonders häufig wiederfindet.
ADHS und Autismus bei Frauen – geschlechtsspezifische Merkmale im Überblick
Aisha Zafar ist approbierte Ärztin, die sich besonders für die Aufklärung und Unterstützung neurodivergenter Frauen einsetzt. Auf ihrem Instagram-Kanal @adhs_doc klärt sie über geschlechtsspezifische Unterschiede auf, thematisiert Herausforderungen im Alltag und zeigt praxisnahe Strategien zur Bewältigung. In ihrer Online-Praxis neuroviva bietet sie neben einer digitalen Sprechstunde auch ADHS-Coachings und Workshops an. Ihre Arbeit hilft vielen Menschen, sich selbst besser zu verstehen und individuelle Wege im Umgang mit ihrer Neurodivergenz zu finden.
Die folgende Liste hat sie erstellt, um Orientierung zu bieten. Sie basiert auf aktuellen Leitlinien, neuesten Studien sowie praktischen Erfahrungswerten, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht alle Merkmale treffen auf jede Person zu, sie bewegen sich auf einem Spektrum und können individuell unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Denn wer eine Person mit ADHS oder Autismus kennt, kennt genau das – eine einzelne Person.
Typische Merkmale von ADHS bei Frauen
Merkmal
Beschreibung
Unaufmerksamkeit und Vergesslichkeit
Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, Informationen zu behalten, Aufgaben zu organisieren und Termine einzuhalten
innere Unruhe und Hyperaktivität
Gefühl innerer Getriebenheit, ein ständiges Bedürfnis nach Aktivität und Probleme, Ruhephasen einzuhalten
Impulsivität
Neigung zu spontanen, unüberlegten Entscheidungen, impulsiven Käufen und abrupten Planänderungen
Probleme mit Zeitmanagement und Priorisierung
unrealistische Zeiteinschätzungen, Schwierigkeiten bei der Priorisierung und Pünktlichkeit
Prokrastination und Motivationsprobleme
Tendenz, unangenehme oder uninteressante Aufgaben zu verschieben oder nicht abzuschließen
Hyperfokus
Phasen intensiver Konzentration auf einzelne Themen, oft mit Vernachlässigung alltäglicher Routinen wie Essen und Trinken
emotionale Dysregulation und Selbstzweifel
Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Selbstzweifel und Schuldgefühle; gleichzeitig starkes Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägte Empathie
Unordnung und Probleme mit Routinen
Schwierigkeiten, Haushalt und Alltag zu strukturieren sowie häufiges Verlegen von Gegenständen wie Schlüsseln oder Dokumenten
Perfektionismus und Überkompensation
überhöhte Ansprüche an die eigene Leistung zur Kompensation wahrgenommener Schwächen, starkes Durchhaltevermögen und der Wunsch nach Weiterentwicklung
sensorische Überempfindlichkeit
Reizfilterschwäche, hohe Empfindlichkeit gegenüber Lärm, Berührungen oder Gerüchen, häufig verbunden mit detaillierter Wahrnehmung
mentale Überlastung durch Masking
hoher Energieaufwand, um sich an äußere Erwartungen anzupassen, was oft zu Erschöpfung und Überforderung führt
Kreativität und unkonventionelles Denken
Fähigkeit, originelle Ideen und innovative Lösungen zu entwickeln, besonders in neuen oder schwierigen Situationen
Typische Ausprägungen für Autismus bei Frauen
Diagnostische Kernmerkmale
Beschreibung
eingeschränkte soziale Interaktion und Kommunikation
Schwierigkeiten bei sozialen Kontakten, nonverbaler Kommunikation und dem Aufbau von Beziehungen; oft mit ausgeprägter Ehrlichkeit und Direktheit
sensorische Besonderheiten
Überempfindlichkeit oder Hyposensibilität gegenüber Reizen (zum Beispiel Geräusche, Licht, Berührungen); oft mit feiner Wahrnehmung für Details in der Umwelt
repetitive Verhaltensmuster
wiederholte Bewegungen (zum Beispiel Wippen, Streicheln von Textilien) dienen der Selbstregulation, besonders in stressigen Situationen
Routinen und Struktur
klare Abläufe schaffen Sicherheit; Abweichungen verursachen oft Stress
intensive Spezialinteressen
Tiefes Fachwissen und Ausdauer bei Themen von besonderem Interesse
Häufige Begleiterscheinungen
Herausforderungen in der Emotionsregulation
intensives Erleben von Emotionen kann zu Rückzug oder Überforderung führen
Masking
Anpassung an gesellschaftliche Normen durch Analyse sozialer Muster, oft mit hoher kognitiver Belastung
mentale Erschöpfung
soziale Interaktionen erfordern viel Energie und führen häufig zu Überlastung
Detailorientierung
hohe Genauigkeit und Präzision, die jedoch in unstrukturierten Situationen überfordern kann
Empathie
Schwierigkeiten bei intuitiver Empathie (spontan und automatisch zu erfassen, was eine andere Person fühlt oder braucht, ohne dass dies explizit kommuniziert wird), aber feinfühlige Wahrnehmung emotionaler Nuancen oder Stimmungen
unkonventionelles Denken
kreative Problemlösungen durch das Erkennen von Mustern und neuen Zusammenhängen
Vom Profi zur Anfängerin: Wie Mutterschaft alte Strategien ins Leere laufen ließ
Lesezeit: 3 Min.
Als frischgebackene Mutter fühlte ich mich unbewusst gezwungen, eine Maske aufzusetzen – eine (neuro-)typische Mutter zu spielen, also das zu tun, was die Gesellschaft von Müttern erwartete. Ich verstand nicht, warum mir das nicht gelingen wollte oder weshalb es sich so anstrengend anfühlte. Ich fand die Anforderungen an mich so hoch, aber meine Leistung reichte nie und war unsichtbar.
Rückblickend hat mich dieses ständige Verstellen enorm viel Kraft gekostet, und eigentlich hätte ich dringend Phasen der Regeneration gebraucht – die mit einem Säugling und Kleinkind jedoch kaum möglich waren. Mein Nervensystem stand permanent unter Stress, ich war chronisch überreizt. Aus Scham, es nicht so wie »die anderen« allein zu schaffen, bat ich auch nicht um Hilfe – und gab dem Ganzen dadurch noch mehr Zündstoff.
Wie bereits erwähnt, haben weiblich sozialisierte Personen oft – bewusst oder unbewusst – gelernt, sich an gesellschaftliche Normen und Erwartungen anzupassen. Durch genaue Beobachtung und ständiges Angleichen schaffen viele es irgendwann, eine Balance zwischen ihren neurodivergenten Eigenschaften und den Anforderungen des Alltags herzustellen, sodass diese nach außen kaum auffallen. Wenn sie dann noch gesellschaftlich anerkannte Erfolge erzielen, etwa einen Hochschulabschluss, bleibt ihre Neurodivergenz oft unsichtbar – sowohl für andere als auch für sie selbst.
Diese Strategie hilft, sich über Wasser zu halten – zumindest so lange, wie keine großen Wellen neuer Anforderungen oder Anpassungen hereinbrechen und genügend Raum für Erholung bleibt. Doch mit der Mutterschaft gerät dieses fragile Gleichgewicht schnell ins Wanken. Ohne Pausen und ohne echte Entlastung wird das ständige »Masking« (mehr dazu in Kapitel 2) – das Verbergen eigener Bedürfnisse und Eigenarten – zur tickenden Zeitbombe und kann auf Dauer zu chronischer Erschöpfung führen.
Ein Gefühl, das in dieser Zeit besonders stark auftauchen kann, ist eine alte, tief sitzende Unsicherheit aus der Kindheit und Jugend: der quälende Gedanke, dass etwas mit einem »nicht stimmt« oder man »nicht gut genug« ist – egal wie sehr man sich anstrengt.
Dieses Gefühl begleitet viele neurodivergente Menschen ihr Leben lang. Wie du dir sicher denken kannst, kehrt es in der neuen Rolle als Mutter oft mit besonders starker Wucht zurück. Befeuert von unerreichbaren Erwartungen an Mütter, verstärkt durch eine Gesellschaft, die jede Handlung, jede Entscheidung beobachtet und bewertet.
Die Vorstellung, jede Mutter habe einen natürlichen Instinkt, der sie mühelos – und besser als alle anderen – dazu befähigt, sich um ihr Kind zu kümmern, hält sich hartnäckig. Doch die Realität sieht nicht selten anders aus: Mutterschaft bringt von Anfang an ebenso viel Unsicherheit wie Freude mit sich, und genau darüber wird viel zu selten gesprochen. Stattdessen schweigen die meisten, was das Gefühl der Isolation verstärkt und die ohnehin schon vorhandenen Selbstzweifel weiter nährt.