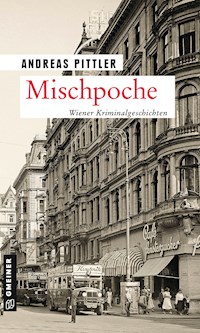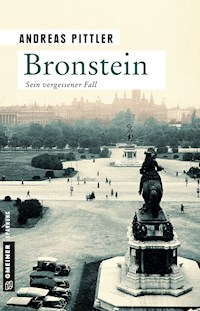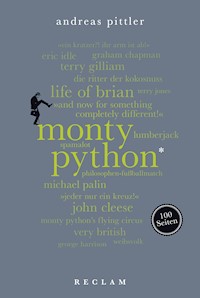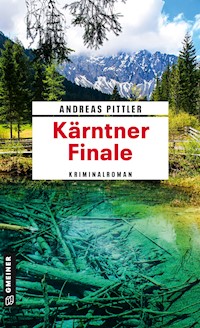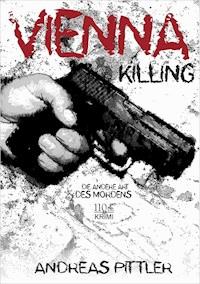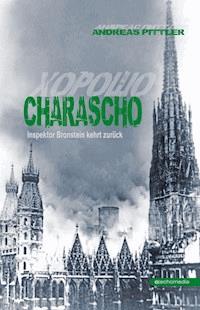
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: echomedia buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wien 1945. Die Rote Armee kämpft in zerbombten Straßen den letzten Widerstand fanatischer Nazis nieder. Der ehemalige Polizeioberst David Bronstein, dem es gelang, den Krieg in Frankreich zu überleben, schließt sich derweilen einem tschechischen Heimkehrer-Treck an, um auf diese Weise über die Tschechoslowakei nach Wien zu gelangen. Endlich dort angekommen, besinnt er sich wieder seines ureigensten Metiers und begibt sich ohne Umschweife auf Verbrecherjagd, denn Verbrecher gibt es nach sieben Jahren Nationalsozialismus mehr als genug. Und die gehen, bloß um unerkannt entkommen zu können, auch im neuen Österreich über Leichen. Wieder einmal beginnt für Bronstein ein Wettlauf gegen die Zeit.Nach seinem Ausflug in die Gegenwart mit „Der Fluch der Sirte“ kehrt Pittler zu seiner erfolgreichen Kultfigur David Bronstein zurück. Auch im neuen Band legt er seinen Finger wieder in die Wunden österreichischer Zeitgeschichte. Dennoch kommt der Wiener Schmäh – wie üblich – nicht zu kurz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Wien - Donnerstag, 12. April 1945
ERSTER TEIL: Frühjahr 1945
Besançon - Drei Tage zuvor
Wien - 12. April 1945, ein paar Stunden zuvor
Besançon - Freitag, 27. April 1945
Wien - Donnerstag, 12. April 1945
Bayern - Montag, 30. April 1945
Wien - Donnerstag, 12. April 1945
Landsberg - Dienstag, 1. Mai 1945
Prag - 15. März 1939
Landsberg - Dienstag, 1. Mai 1945
Wien - Samstag, 14. April 1945
Landsberg - Mittwoch, 2. Mai 1945
Wien - Sonntag, 15. April 1945
Dachau - Mittwoch, 2. Mai 1945
Wien - Montag, 16. April 1945
Landshut - Donnerstag, 3. Mai 1945
Wien - Immer noch Montag, 16. April 1945
Landshut - Freitag, 4. Mai 1945
Wien - Dienstag, 17. April 1945
Philippsreut - Samstag, 5. Mai 1945
Wien - Mittwoch, 18. April 1945
Třeboň - Sonntag, 6. Mai 1945
Wien - Freitag, 20. April 1945
Brno - Montag, 7. Mai 1945
Enzersdorf - Samstag, 21. April 1945
Drasenhofen - Dienstag, 8. Mai 1945
ZWEITER TEIL: Sommer 1945
Wien - Mittwoch, 30. Mai 1945
Wien - Donnerstag, 31. Mai 1945
Wien - Freitag, 1. Juni 1945
Wien - Samstag, 2. Juni 1945
Wien - Sonntag, 3. Juni 1945
Wien - Montag, 4. Juni 1945
Wien - Dienstag, 5. Juni 1945
Wien - Donnerstag, 7. Juni 1945
Wien - Sonntag, 10. Juni 1945
Wien - Montag, 18. Juni 1945
Wien - Dienstag, 19. Juni 1945
Wien - Freitag, 29. Juni 1945
Wien - Sonntag, 22. Juli 1945
Wien - Montag, 30. Juli 1945
Wien - Mittwoch, 1. August 1945
Wien - Samstag, 4. August 1945
DRITTER TEIL: Herbst 1945
Wien - Sonntag, 25. November 1945
Wien - Dienstag, 27. November 1945
Wien - Freitag, 30. November 1945
Wien - Samstag, 15. Dezember 1945
Wien - Sonntag, 23. Dezember 1945
Glossar
CHARASCHO
Andreas Pittler
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Eventuelle Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Menschen und wirklichen Ereignissen sind, soweit diese nicht historisch belegt sind, rein zufällig und nicht beabsichtigt.
eISBN: 978-3-902900-53-1
E-Book-Ausgabe: 2014
2014 echomedia buchverlag ges.m.b.h.
Media Quarter Marx 3.2
A-1030 Wien, Maria-Jacobi-Gasse 1
Alle Rechte vorbehalten
Produktion: Ilse Helmreich
Layout: Brigitte Lang
Coverbild: VGA E3/1047 (Klomfar)
Lektorat: Thomas Hazdra
Herstellungsort: Wien
E-Book-Produktion: Drusala, s.r.o., Frýdek-Místek
Besuchen Sie uns im Internet:
www.echomedia-buch.at
Prolog
Wien - Donnerstag, 12. April 1945
Der erste Schuss war völlig unerwartet gekommen. Die Überraschung schien so umfassend, dass seitens des potenziellen Opfers nicht die geringste Reaktion erfolgte. Es stand ruhig und unbeweglich da und schien nur auf den nächsten Schritt des Angreifers zu warten.
Der fluchte wohl undeutlich und überprüfte seine Waffe. Sorgsam nahm er das Opfer erneut ins Visier und wirkte dabei ungemein entschlossen. Er war sichtlich nicht gewillt, noch einmal danebenzuschießen.
Der nächste Schuss riss ein klaffendes Loch in die rechte Seite und hatte ein unüberhörbares Ächzen und Stöhnen zur Folge. Doch immer noch bestand eine vage Hoffnung, dass es nicht zum Äußersten kommen würde, denn es waren keine vitalen Bereiche getroffen worden. Allerdings war da diese unerträgliche Wehrlosigkeit. In aller Seelenruhe konnte der Angreifer nachladen, seine Waffe neu ausrichten. Quälende Augenblicke vergingen, in denen der Gegner zum dritten Mal sein Ziel anvisierte. Dem ohrenbetäubenden Knall folgte spornstreichs ein weiterer Einschlag, der neuerliches Brüllen und Tosen hervorrief. Nun waren die Wunden, die das gnadenlose Metall geschlagen hatte, bereits unübersehbar.
Das Opfer wankte. Und seine Lage war hoffnungslos. Keine Chance, dem Schicksal zu entrinnen. Niemand war da, der ihm zu Hilfe kommen konnte. Wie auch? Seit Tagen tobte in der ganzen Stadt eine unerbittliche Schlacht, in der jeder auf sich allein gestellt war. Die Verluste waren gigantisch, und sie nahmen kein Ende. Viel Bedeutendere hatten nicht gerettet werden können, waren einfach niedergemäht worden. Weshalb sollte es da gerade in diesem einen Fall ein gutes Ende geben? Nein, da half kein Beten und kein Fluchen. Es blieb nur, sich in das Unvermeidliche zu fügen. Klappernd fiel die leere Hülse zu Boden, während ein weiteres Geschoß in den Lauf geschoben wurde. Ein kurzes Heben der Hand, und ein viertes Mal belferte die Waffe laut auf. Auch dieser Treffer saß. Nun endlich konnte das Opfer nicht länger widerstehen. In unendlicher Langsamkeit löste es sich aus der Reihe, in der es eben noch gestanden war. Es neigte sich bedenklich, und kein Mensch hätte zu sagen vermocht, was es noch davon abhielt, krachend zu Boden zu fallen. Trotz des allgemeinen Lärms war ein merkwürdiges Knarren zu hören, so wie man es vielleicht in alten Schiffen vernehmen mochte. Dann ertönte ein Schnalzen. Ganz oben. Gleich danach etwas weiter unten, und schließlich setzte sich dieses Geräusch bis hinunter zum Boden fort. Dem Klanggemälde gesellte sich ein Zischen bei, untermalt von einem Bersten und einem Klirren. Nach und nach versagten alle Elemente dem Opfer ihren Dienst, und noch ehe die gegnerische Kanone ein weiteres Mal infernalisch aufheulen konnte, war ihr Ziel gefällt. Die ganze Vorderfront brach in sich zusammen, begrub Fensterrahmen, Glassplitter, Stuck und Wandschmuck unter sich. Das Dach, von dem sich schon zuvor etliche Ziegel gelöst hatten, gab nun auch nach und fiel auf den Fußboden des obersten Stockwerks. Dieser konnte dem so entstandenen Druck nicht standhalten und sackte in Richtung Erdgeschoß durch. Schränke, Betten und Sitzmöbel kullerten in seltsamen Pirouetten auf die Straße, wo sie augenblicklich von einer markanten Staubwolke eingehüllt wurden. Brände flammten auf, die zwar teilweise von den aus ihren Halterungen gerissenen Wasserleitungen bekämpft, gleichzeitig aber von austretendem Gas angefacht wurden. Endlich implodierte der Rauchfang und stürzte in sich zusammen. Das Haus in der Walfischgasse war einen namenlosen Tod gestorben, über den keine Zeitung berichten würde. Die Artilleristen der Roten Armee aber nickten einander zufrieden zu. Ihre Genossen von der Infanterie stürmten vor und erwarteten, auf den Trümmern des Gebäudes stehend, die hustenden und taumelnden SS-Männer, die sich in den Mauern verschanzt hatten und nun, ohne weitere Deckung, ihr Heil in ihrer Kapitulation suchten.
Eine Stunde später war auf diesem Kampfplatz Ruhe eingekehrt. Die Gefechte verlagerten sich in Richtung Stephansplatz, zurück blieben nur Trümmer und Schutt, die von jenen, die – zumindest vorerst – überlebt hatten, vorsichtig begutachtet wurden. Das ganze Ensemble bot einen bemitleidenswerten Anblick. Fast die gesamte Vorderfront war dem Beschuss zum Opfer gefallen. Nur der linke Gebäudeteil hatte den Angriff unbeschadet überstanden. Man konnte einen Teil des Flurs erkennen, an dessen Ende sich die Tür zur einzig intakten Wohnung der Beletage befand. Mit einem Feldstecher hätte man vielleicht die Schrift auf dem braunen Karton lesen können, der an den linken Türflügel geklebt war, doch die Bewohner des Hauses in der Walfischgasse wussten auch so, was darauf stand. „Schmied“. Daneben hatte jemand mit krakeliger Schrift „Schulz“ hinzugefügt, und erst vor kurzem war mit Bleistift der Name „Schneider“ ergänzt worden.
Doch die Kanonade war auch an diesem Stück Karton nicht völlig spurlos vorübergegangen. Er war ein klein wenig verrutscht und hing nur mit leichter Schlagseite nach unten. Dadurch gab er den Blick auf ein Messingschild frei, das wohl einst mit dem Karton überklebt worden war. Zwei oder drei altdeutsche Lettern erblickten erstmals seit langem wieder das Tageslicht, und auch ohne Fernglas hätten etliche Bewohner des Hauses gewusst, dass es sich dabei um ein „B“, ein „r“ und ein „o“ handelte.
Doch darum kümmerte sich in diesem Augenblick niemand. Während einige Luftschutzwarte versuchten, die entstandenen Brandherde einzudämmen, stöberten andere in den Trümmern nach ihrer persönlichen Habe. Hundert Meter weiter freilich dauerten die Kämpfe mit unverminderter Heftigkeit an.
ERSTER TEIL: Frühjahr 1945
Besançon - Drei Tage zuvor
„What’s your name?“
Unsicher blickte Bronstein auf den Mann, der ihm als Übersetzer avisiert worden war.
„Wie du heißt, will er wissen“, gab dieser schließlich gelangweilt von sich.
„Bronstein. David Bronstein.“
„Jew?“
Wieder sah Bronstein zum Übersetzer hin.
„Ob du ein Jud bist.“
„Nein. Protestant. Und Österreicher“, setzte Bronstein hinzu.
Der amerikanische Offizier hob den Kopf. „Austrian? But your name is Bronstein, ain’t it?“
Bronstein trat einen Schritt näher an den Mann heran, um sein Namensschild lesen zu können. „You Vianello“, sagte er dann, „America. Not Italia.“
Gegen seinen Willen musste der Yankee grinsen. „You’ve got a point, man.“ Doch sofort wurde Vianello wieder ernst. „Okay, so what shall we do with you? Do you want to stay here and wait, or do you like to have an Affidavit?“
Bronstein wusste nicht, was er auf diese Frage antworten sollte. Wollte er wirklich nach Hause? War Wien überhaupt noch sein Zuhause? Er spürte, wie seine Beine zu zittern begannen, und er bat um einen Sessel. Die besorgte Miene Vianellos nahm er ebenso wenig wahr wie den angewiderten Gesichtsausdruck des Dolmetschers.
Bronstein versuchte, sich auf die Frage zu konzentrieren, doch unwillkürlich schweiften seine Gedanken ab. Er erinnerte sich mit einem Mal wieder an jenen Märztag vor sieben Jahren, da er die tschechische Grenze passiert hatte, weil Freund wie Feind in ihm einen Tschechen namens Tauber vermutete. Und unweigerlich kamen ihm die Tränen.
Deutlich hatte er das Bild vor Augen. Apathisch und doch zähneklappernd saß er in dem überfüllten Waggon nach Břeclav, memorierte ein ums andere Mal den Satz „Jsem občan Československé Republiky.“ An den Fenstern zogen die Felder des Weinviertels an ihm vorbei. Ein malerischer Anblick unter anderen Umständen, doch er hatte kein Animo dafür. Er versuchte, nicht aufzufallen, was ihm jedoch sofort absurd vorkam. In dem Zug saßen nur Leute, die nicht auffallen wollten. Alle suchten um jeden Preis dem sicheren Untergang zu entfliehen, und alle quälte nur die eine Frage: Werde ich es schaffen?
„Jsem Josef Tauber. Jsem občan Československé Republiky“, wiederholte er erneut für sich, als am anderen Ende des Waggons die Tür derb aufgestoßen wurde. Zwei Männer in langen braunen Ledermänteln traten ein. Ihre kahlrasierten Schädel wirkten brutal, ihr Blick verschlagen. Bronstein hielt den Atem an. Die beiden sahen sich kurz um, ehe sie einander zunickten. Mit einem zynischen Lächeln auf den Lippen bewegten sie sich auf die Mitte des Waggons zu. Genau bei Bronstein blieben sie stehen.
„Steh auf, mach keine Umständ’. Gemma, Jud!“
Bronsteins Herz setzte aus. Sie waren höchstens noch fünf, sechs Kilometer von der Grenze entfernt. Doch die beiden Gestapo-Männer verwehrten ihm jedweden Fluchtweg. Er musste es einsehen, er hatte verloren.
„Jetzt komm schon! Oder müssen wir dich erst durch den ganzen Zug prügeln, du Judensau!“
Bronstein betete um einen Herzinfarkt. Sterben! Genau jetzt! Dann konnten sie ihm nichts mehr anhaben. Doch diese Gnade blieb ihm verwehrt. Sein Blut floss weiter durch seine Adern, seine Lunge füllte sich regelmäßig mit Luft, sein Körper versah die vorgesehenen Funktionen. Bronsteins Hände krampften sich um die Lehnen, eben wollte er Schwung nehmen, um sich zu erheben, als der Mann neben ihm laut seufzte.
Bislang hatte Bronstein nicht auf ihn geachtet, da er sich hinter einer großformatigen Zeitung, den „Wiener neuesten Nachrichten“, verschanzt hatte. Doch nun faltete er diese umständlich zusammen, sodass Bronstein das Gesicht des Mannes wahrnehmen konnte. Sofort fielen ihm die Schläfenlocken auf, die unter den Bügeln der Nickelbrille nach unten hingen. Dann sah er die Kippa am Hinterkopf. Der Mann seufzte abermals, steckte die Zeitung in den Mantel und erhob sich.
„Warum nicht gleich, Itzig“, knurrte nun der zweite Polizist. „Also, gemma. Abmarsch!“ Umständlich zwängte sich der Verhaftete an Bronstein vorbei, woraufhin er sofort von den beiden Mantelträgern in die Mitte genommen wurde. Ehe sie ihn hinauseskortierten, wandte sich der erste Agent noch einmal an Bronstein und entschuldigte sich für allfällige Unannehmlichkeiten. „Aber Sie müssen schon verstehen, Volksgenosse! Mit diesem Judenpack kann man gar nicht vorsichtig genug sein.“
Bronstein zwang sich zu einer Art Nicken, dann wurde ihm schwarz vor den Augen.
„Are you okay? We can continue later, if you like“, riss ihn Vianello aus seinen Gedanken.
Soweit Bronstein die Anweisungen des Amerikaners verstand, sollte ihn der Dolmetscher zurück ins Krankenrevier bringen. Dort angekommen, legte sich Bronstein hin und schlief umgehend ein.
Wien - 12. April 1945, ein paar Stunden zuvor
„Was machen Sie da?“
Die Stimme drang für den Mann in der Mitte des Raumes unerwartet an sein Ohr. Doch er fing sich rasch.
„Wonach sieht es denn aus?“, gab er über seine Schulter zurück.
„Es schaut so aus, als wollten Sie unser Haus in Brand setzen.“
Die junge Frau hatte so unrecht nicht. Der Mann mit dem abgetragenen Soldatenmantel war tatsächlich gerade dabei, einen aufgeschichteten Papierstapel anzuzünden. Und da er nichts sagte, trat die Blondine neugierig näher. Deutlich erkannte sie den Reichsadler mit dem Hakenkreuz in seinen Klauen. Der Mann vernichtete offenkundig kompromittierende Dokumente.
„Warum verheizen Sie das Zeug nicht im Ofen? Dann hätten wir es schön warm, und gefährlich wäre es auch nicht.“
„Siehst du da irgendwo einen Ofen?“
Die Frau sah sich um. „Nein. Aber bei uns drüben, da gibt es einen.“
Erstmals sah der Mann sie direkt an. Und sein Blick wirkte alles andere als beruhigend auf sie. „Ich hab ja nur g’meint“, murmelte sie.
Abrupt erhob sich ihr Gegenüber. „Du wärst besser nicht so neugierig gewesen“, knurrte er, während er ein Streichholz entzündete und es auf das Papier fallen ließ.
„Aber ich verrat Sie doch eh nicht, Herr …“
Er legte den Zeigefinger seiner Linken auf ihre Lippen. „Sch…!“ Zu ihren Füßen begann es zu qualmen. Unwillkürlich trat sie einen Schritt zurück, doch der Mann folgte ihr augenblicklich. Die ersten Flammen züngelten in gelblichem Orange auf. Die Frau wich weiter zurück und kam durch die Zimmerwand jäh zu einem Halt.
„Ich schwör’s“, flüsterte sie, „ich sag wirklich nichts. Wem sollte ich auch etwas sagen?“
„Den Russen zum Beispiel“, entgegnete er mit einem schiefen Grinsen, „die sind nämlich spätestens in ein paar Stunden da.“
„Aber was hätt ich davon? Wir stecken da doch alle mit drinnen“, widersprach sie leise. Ihr Gegenüber lachte trocken auf.
„Gut, Sie haben die Mareks vernadert. Ich aber war Blockwart. Für mich heißt es Sibirien. Wenn ich Glück hab. Und ich hab keine Lust auf Birkenrinde bei minus 35 Grad.“
Trotz des Feuers, das mittlerweile einen halben Meter emporzüngelte, begann die Frau zu frösteln. Zwischen sie und die Wand passte nun kein Stück Papier mehr, und der Mann kam ihr so nahe, dass sie seinen Atem ganz deutlich spürte. Er roch faulig und zudem nach Alkohol. Sie drehte ihren Kopf nach links, um die Entfernung zur Tür abschätzen zu können, doch die Rechte des Mannes versperrte ihr die Sicht.
„Sie haben mich nie leiden können, gell“, sagte er tonlos, während er ihr mit den Fingern über die Wange fuhr. Instinktiv wich sie aus.
„Sie täten denen alles sagen. Wie ich die Reibpartien im 38er Jahr organisiert hab. Wie ich den g’schissenen Finkelstein, diesen arroganten Quacksalber, endlich Mores g’lehrt hab. Und dass ich mir seine Wohnung unter den Nagel g’rissen hab, das täten S’ auch sagen, gell.“
Ängstlich schüttelte sie den Kopf.
„Aber sicher täten S’ das sagen. Das und noch mehr. Und dabei täten S’ die Wahrheit ganz verdrehen. Sie täten sagen, ich hätt mir das G’schäft vom alten Feldberg zug’schanzt. Dabei hab ich das ganz offiziell von der Partei übertragen bekommen! Und dass ich den Sagmeister an die Gestapo ausgeliefert hab, das täten S’ den Russen auch sagen. Dabei hat das Schwein Feindsender g’hört. Obwohl ich ihn verwarnt hab. Zweimal sogar! Aber er hat ja ned hören wollen, der alte Trottel. Also hat er sich nicht wundern brauchen, wie er auf einmal in Dachau aufg’wacht ist. Na bitte, ist das vielleicht meine Schuld?“ Der Mann legte fragend seinen Kopf schief.
„Eh nicht“, entgegnete sie hastig. „Bitte“, fuhr sie flehend fort, „lassen S’ mich gehen. Ich sag bestimmt nichts. Bei meiner Ehr.“
„Ja, ja“, seufzte er nun, „Ihre Ehre! Die war Ihnen ja immer so wichtig, was?! So ein einfacher Volksgenosse wie ich, der war Ihnen ja nicht gut genug, gell.“ Die Frau wollte etwas erwidern, doch abermals hielt ihr der Mann den Finger auf den Mund. „Genug geredet. Ich muss schauen, dass ich fortkomm. Irgendwohin in den Westen. Die Amis sind vielleicht nicht ganz so grausam wie der Iwan.“
Deutlich spürte sie, wie sich seine rechte Hand um ihren Hals schloss. Augenblicklich wurde es schwer für sie, Atem zu bekommen. „Aber mir ist doch“, krächzte sie, „das alles völlig gleichgültig. Bitte …“
Doch der Griff schloss sich nur fester, schnürte ihr gnadenlos die Luft ab. „Hättest halt nicht immer so hochnäsig sein dürfen, blöder Trampel. Dann könnt ich dir vielleicht vertrauen. So aber hängst mir wahrscheinlich die Marek-G’schicht auch noch an, nur damit du selber besser dastehst.“
Ihre Augen weiteten sich angstvoll. Instinktiv riss sie ihre Arme hoch, um die Hand ihres Peinigers von ihrem Hals zu bekommen. Der aber schüttelte nur langsam den Kopf und packte noch kräftiger zu. Die Frau begann zu röcheln.
„Unser schönes Deutschland geht unter. Und du mit ihm!“
Der Mann nahm nun, während er sich mit seinem ganzen Körpergewicht gegen die zierliche Gestalt drückte, auch die linke Hand zu Hilfe. Gemeinsam mit ihrem Pendant schloss sie sich wie ein Schraubstock um den Hals der jungen Frau, die schreckensstarr ihren Mund in der verzweifelten Anstrengung aufriss, doch noch irgendwie Luft schnappen zu können. Sie bemühte sich, auf den Mann einzuschlagen, doch sein massiger Oberkörper ließ ihren Armen keinen Platz für eine ansprechende Bewegung. In nackter Panik krampften sich ihre Finger sodann in seine Handgelenke, doch ihre Kräfte ließen rapide nach. Ihre Beine knickten ein, wodurch sein Würgegriff nur noch mehr Heftigkeit entfaltete. Ihr Körper hing in seinen Armen wie eine Gehenkte. Ein mühseliges Aufbäumen noch, ihr Blick brach aus, und ein kaum hörbares Röcheln zeugte als Letztes von einer Existenz, die eben aufgehört hatte zu sein.
Dennoch hielt der Mann noch eine gute Weile seine Hände um ihren Hals geschlossen, und erst als er sich sicher war, dass die Frau nicht nur bewusstlos war, ließ er aus und trat einen Schritt zurück. Der leblose Körper sank die Wand abwärts und kippte schließlich zur Seite. Nachdenklich betrachtete er sein Werk, versetzte der Leiche noch einen untersuchenden Tritt, um sich, als keine Reaktion mehr erfolgte, achtlos umzudrehen. Er öffnete die Schublade zu seiner Linken, holte die Bündel mit den Reichsmark heraus und ging dann zurück in die Mitte des Raumes, wo die Dokumente bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren. Der Mann trat die Glutnester aus, sah sich noch einmal um und verließ dann die Wohnung.
Besançon - Freitag, 27. April 1945
Bronstein hatte mit wachsender Unruhe registriert, wie laufend Armeelaster in dem Lager eintrafen. Abordnungen italienischer Kommunisten waren bereits in der ersten Woche seiner Anwesenheit im Camp eingetroffen und hatten alle Italiener, egal, ob sie nun Kommunisten, Sozialisten oder Anhänger einer konstitutionellen Monarchie waren, auf Rot-Kreuz-Wägen aufgeladen, um sie zurück in die Heimat zu eskortieren. Aus dem Norden waren belgische und holländische Delegationen eingetroffen, um ihre Leute abzuholen, und aus der Schweiz bewegten sich tschechoslowakische und jugoslawische Gruppen auf das Lager zu. Nur aus Österreich kam niemand.
Dabei waren sie ihrer gar nicht so wenige, wie Bronstein in den ersten Tagen hatte feststellen können. Nach seinem Gespräch mit Vianello war er einer Baracke zugewiesen worden, in der ein knappes Dutzend „Spaniaken“ hauste, wie sich die ehemaligen Mitglieder der Internationalen Brigaden, die gegen den Diktator Franco gekämpft hatten, selbst nannten. Nach der Niederlage der Republikaner waren sie ins demokratische Frankreich ausgewichen, das sie allerdings in Sammellagern wie Saint-Cyprien oder Gurs eingesperrt hatte, wo sie kaum zu essen bekamen und auf dem nackten Erdboden schlafen mussten. Die meisten von ihnen waren 1940 vom besiegten Frankreich an die Nazis ausgeliefert worden, worauf ein fünf Jahre währender Leidensweg durch diverse Konzentrationslager gefolgt war, aber einige von ihnen hatten sich, Bronstein gleich, in Vichy-Frankreich verstecken können. Sie warteten nun wie er auf ihre Repatriierung. Doch es war offenkundig, dass die neue österreichische Verwaltung keine Eile hatte, sie heimzuholen.
Bronstein verlor die Geduld. Mehr als sieben Jahre waren vergangen, seit er Wien hatte verlassen müssen, und er war an einem Punkt angelangt, an dem ihm jeder weitere Tag in der Fremde zur Hölle wurde. Von morgens bis abends lungerte er am Sammelplatz herum und hielt sehnsuchtsvoll Ausschau nach den LKW, die dort pausenlos Menschen aufnahmen, um sie nach Hause zu bringen. Und wieder fuhren drei riesige Laster durch das Tor.
Sofort erkannte Bronstein ihr Herkunftsland, denn unverkennbar prangte die tschechoslowakische Trikolore an der Fahrertür. Bronstein fasste einen Entschluss. Ruckartig erhob er sich von seinem Sitz und ging auf den Fahrer zu.
„Dobrý den. Jmenuji se Josef Tauber. Jsem obyvatel Československé Republiky. Ale problém je, nemám občansky prukaz, nemám vubec papir.“
Der Fahrer lachte und klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. Das sei doch kein Problem. Nach dieser Höllenzeit könne von niemandem erwartet werden, dass er Papiere habe, von gültigen Ausweisen ganz zu schweigen. Die tschechoslowakische Republik kümmere sich um ihre Bürger, und wenn er erst einmal zu Hause sei, dann werde man sicherlich einen Weg finden, ihm die nötigen Dokumente auszuhändigen. Er solle einfach aufsteigen. Bronstein zögerte nicht lange und kletterte auf die Ladefläche. Wohin er überhaupt wolle, fragte der Fahrer noch. „Mikulov“, gab Bronstein zurück.
„Jedeme do Brne“, erklärte der Fahrer. Von dort müsse er selbst sehen, wie er weiterkomme. Vor allem aber müsse er sich in Acht nehmen, denn dort gebe es immer noch vereinzelt Gefechte. Bronstein nickte nur.
Zwei Stunden später setzte sich der Konvoi in Bewegung. Bronstein hatte in der Zwischenzeit erfahren, dass die Tschechoslowaken einfach den amerikanischen Truppen folgten, die bereits weite Teile Bayerns befreit hatten. Bis Mühlhausen schien es ihm, als nähme er einfach an einer Landpartie teil, doch kaum überquerten sie die Grenze zu jenem Land, das einst das Deutsche Reich gewesen war, wähnte sich Bronstein auf dem Mond. Links und rechts der Fahrspur dehnten sich weite Felder aus. Doch niemand war da, sie zu bestellen. Alles wirkte öd und leer, lag brach und verwüstet da. Und immer wieder passierten sie kleine Orte, Dörfer und Weiler, wo nur rauchende Trümmer daran erinnerten, dass hier Menschen gelebt, gearbeitet und gelitten hatten. Immer wieder schüttelte Bronstein den Kopf. Er hatte im Ersten Krieg genug Zerstörung und Verwüstung gesehen, dass es für mehrere Leben gereicht hätte. Doch was er nun erblickte, ließ ihn in stummem Entsetzen erstarren. Zwischen ausgebombten Mauerresten hingen zerfetzte Leiber, die niemand zu bestatten vermochte. Raben, die allein noch von Leben zeugten, taten sich an verwesenden Leichen gütlich.
Wien - Donnerstag, 12. April 1945
Als er auf die Straße trat, blickte er sich links und rechts um. Die Walfischgasse lag völlig verwaist vor ihm, in einiger Entfernung sah er das traurige Gerippe der Staatsoper stehen, die rund drei Wochen zuvor nach einigen Bombentreffern nahezu vollkommen ausgebrannt war. Weit und breit war kein Vehikel zu erspähen, sodass ihm bewusst wurde, dass er sein Heil nur auf Schusters Rappen finden würde.
„Obacht, Mensch!“, hörte er plötzlich einen schnarrenden Ruf, „det is Kampfjebiet hier. Hau bloß ab!“