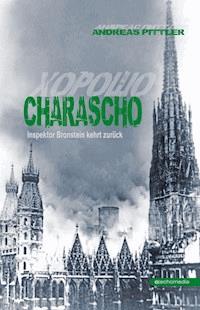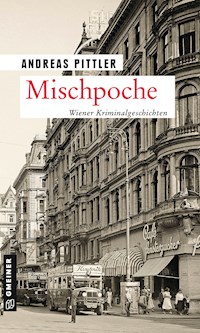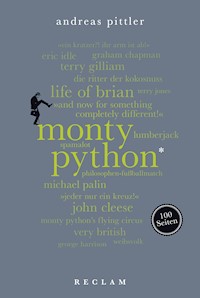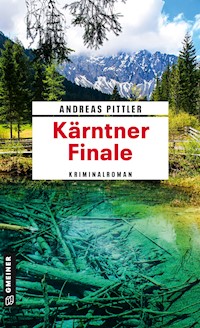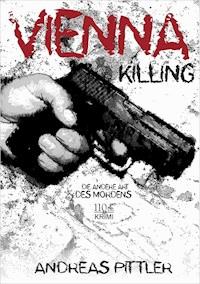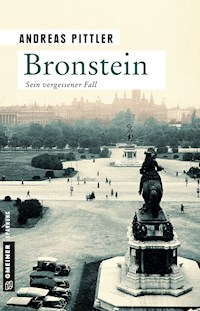
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Während Oberst Bronstein den Mord an einem Arbeiter aufklären will, wird er auf Weisung von oben als vermeintliches „Publikum“ zum Politprozess gegen führende Oppositionelle abkommandiert. Gegenüber dem Ausland will das herrschende Regime einen Zustand der Normalität vortäuschen. Das mutige Verhalten der Oppositionellen veranlasst Bronstein, mit anderen Augen auf seinen Fall zu blicken. Er setzt alles daran, die Mordsache, anders als von der Diktatur gewünscht, wahrheitsgemäß zu lösen. Die Spur führt direkt zu den im Untergrund tätigen Nazis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Pittler
Bronstein
Sein vergessener Fall
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Die Spur der Ikonen (2017); Der göttliche Plan (2016); Wiener Bagage (2014); Mischpoche (2011)
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
2. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6030-2
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
TEIL EINS: FRÜHLING
Mittwoch, 11. März 1936
»Bronstein! Du wirst alt!«
David Bronstein stand vor dem großen Spiegel, der die Garderobe seines Vorzimmers abschloss, und konnte nicht umhin, aus tiefster Brust zu seufzen. Für einen Moment mühte er sich, seinen Bauch einzuziehen, ganz so, als stehe er »Habtacht«, doch nur allzu schnell zwang ihn seine Konstitution, wieder in seine eigentliche Form zurückzukehren. Die Leibesmitte wölbte sich formatfüllend im geschliffenen Glas, während Bronstein angestrengt Luft ausblies. Kurz überlegte er, den Schwimmreifen unterhalb seines Brustkorbs mit groben Händen anzupacken, doch sogleich nahm er von diesem Ansinnen mit aufsteigendem Widerwillen Abstand. Es war ja doch zwecklos, er näherte sich körperlich mehr und mehr der Erscheinung des Volksschauspielers Oskar Sima an. Doch der, so versuchte Bronstein sich zu trösten, war gute zehn Jahre jünger als er. Immerhin.
Doch halt. Was war das? Bronstein trat einen Schritt näher an den Spiegel und positionierte sein Gesicht ganz nah an dessen Oberfläche. Sein Bart! Der war grau! Und zwar ganz unzweifelhaft. Nicht ein paar Strähnen. Nein, das ganze Kinn war von dieser trostlosen Farbe geprägt. »Bronstein, du wirst nicht alt, du bist alt«, sagte er leise zu sich, während er Gefahr lief, von einer nachhaltigen Melancholie überwältigt zu werden.
Nach einem Augenblick des nackten Schreckens versuchte Bronstein, Ordnung in seine Gedanken zu bekommen. Es war wohl zu spät, um durch Leibesübungen die Körperfülle einzudämmen. Also musste er es der Regierung gleichtun und die traurige Realität mit irgendeiner Tünche behübschen. Er wandte sich nach links und öffnete die Schranktür. Aus dem obersten Fach holte er ein weißes Hemd hervor, das er anlegte, ehe er seine untere Körperhälfte in eine schwarze Flanellhose verstaute. Deren Bund zog er bis über den Bauchnabel hoch, sodass die ärgerliche Kugel in die tieferen Regionen hinabgedrückt war. Bronstein riskierte wieder einen Blick in den Spiegel und musste sich eingestehen, damit wenig erreicht zu haben. Diese Variante sah trostlos aus. Er wirkte endgültig wie ein alter Tattergreis.
Aber was unansehnlich war, das musste eben kaschiert werden. Mit einer Weste zum Beispiel. Ja, sagte er sich, nachdem er selbige über das Hemd gezogen hatte. So wirkte er nicht mehr unförmig, so erschien er stattlich. Und wenn er jetzt noch seine Taschenuhr samt ihrer goldenen Kette anlegte und das Ensemble mit seinem Rock abschloss, dann mochte er durchaus als soignierter Herr durchgehen.
Halbwegs zufrieden mit der Lösung, die er gefunden hatte, zog er die Weste wieder aus, um sich seinen Schuhen zu widmen. Passend zur restlichen Kleidung wählte er schwarze Budapester, die er neben dem beim Spiegel befindlichen Schemel abstellte. Er kramte in der untersten Schublade seines Kastens und förderte Schuhcreme und ein altes Sacktuch zutage. Mit diesen Utensilien bewaffnet, ließ er sich schwer auf dem Schemel nieder, fuhr mit seiner linken Hand in den ersten Schuh, trug mit der Rechten die schwarze Paste auf, um sodann mittels des Tuchs selbige gleichmäßig auf dem gesamten Oberleder zu verteilen. Als er mit seinem Werk zufrieden war, wiederholte er die Verrichtung mit dem zweiten Schuh, ehe er sich endlich anschickte, das Paar über seine Füße zu stülpen. Er verdrängte den Gedanken, dass ihm das Binden der Schnürsenkel mehr Mühe bereitete, als es ziemlich war, und brachte sich mit einem leisen Ächzen wieder in eine stehende Position. Im Alter wurden auch die alltäglichen Dinge zu einer Frage von Sieg und Niederlage. Und wenigstens im Hinblick auf sein Schuhwerk konnte er nun »Nenikekamen« sagen.
Gravitätisch bewegte sich Bronstein in sein Wohnzimmer, wo sein Blick auf dem großen Tisch herumwanderte. Wo hatte er seine Uhr abgelegt? Mit aufsteigender Unruhe begann er, zwischen der Zigarettenschachtel, den Streichhölzern und der »Wiener Zeitung« vom Vortag herumzukramen, ehe er sich abrupt mit der flachen Hand auf die Stirn klatschte. Er hatte die Uhr ja tags zuvor gar nicht getragen! Also lag sie wahrscheinlich am Nachttisch. Flott wechselte er die Räumlichkeiten und fand tatsächlich, was er suchte, direkt neben der kleinen Lampe liegen. Er trug den Chronometer beinahe vorsichtig ins Vorzimmer, wo er das Gehäuse in der kleinen Westentasche verstaute, um sich anschließend damit abzumühen, die Uhrkette formgerecht im Knopfloch zu fixieren. Er prüfte die Festigkeit des eben ins Werk gesetzten Unterfangens und setzte eine zufriedene Miene auf. Nachdem er noch seine sonstigen Utensilien wie Portemonnaie, Zigaretten, Feuerzeug und Stift an sich genommen hatte, befand er, er war nun endlich ausgehfertig.
Als er auf die Straße trat, registrierte er augenblicklich ein Frösteln. Die frühlingshafte Märzsonne war offenbar doch noch nicht so wärmend, wie man es nach dem langen Winter erhoffen mochte. Bronstein dachte darüber nach, noch einmal in seine Wohnung zurückzukehren, um sich einen Mantel zu holen, beschied dann aber, ohne selbigen das Auslangen zu finden, wenn er nur forsch genug ausschritt. Also wandte er sich nach rechts und überquerte rasch die Kreuzung zwischen Oper und Hotel Sacher, um dann an der Albertina vorbei auf den Michaelerplatz zuzuhalten. Bronstein hatte dabei ein beachtliches Tempo an den Tag gelegt, sodass ihm die Kälte weiter nicht zusetzte. Dennoch war er froh, die Pforte seines Stammcafés auszumachen. Dort gedachte er, noch ein Petit Dejeuner einzunehmen, ehe er seinen Dienst in der Polizeidirektion antreten würde.
Oberkellner Alfons begrüßte den eintretenden Gast beinahe ehrfürchtig und entschwand sofort in Richtung Schank, während sich Bronstein erhaben auf seinem Platz niederließ. Er hatte noch nicht einmal seine Zigaretten aus der Tasche zutage gefördert, als Alfons ihm auch schon die »Wiener Zeitung« auf den Sessel legte und ihm elegant eine Schale Gold auf den Tisch stellte. »Darf es heute sonst noch etwas sein, Herr Kriminalrat? Eine Brioche vielleicht? Oder ein Buttersemmerl?« Bronstein sinnierte kurz und sah dann den Ober direkt an: »Wissen S’ was, Herr Alfons, ein weiches Ei mit einer Buttersemmel, das wär’ mir heut’ g’rade recht.« Alfons nickte ergeben. »Sehr wohl, Herr Oberst, kommt sofort.« Bronstein zündete endlich eine Zigarette an und warf einen ersten Blick auf die Titelseite der Zeitung. Offenbar hatten sich Kanzler Schuschnigg, Vizekanzler Starhemberg und Außenminister Berger-Waldenegg mit dem tschechischen Premierminister Milan Hodža getroffen. Ein Thema, das der »Wiener Zeitung« glatt einen Leitartikel wert war. Bronstein aber dachte nicht daran, sich in diese Materie zu vertiefen. Was war von solchen Zeilen auch Großes zu erwarten? Beide Staaten fürchteten sich, und das mit Recht, vor dem Schreihals aus Braunau, da mochte man gerne ein wenig enger zusammenrücken, ungeachtet der problematischen Vergangenheit, die Tschechoslowaken und Österreicher dazu veranlasste, einander für gewöhnlich eher argwöhnisch zu beäugen.
Bronstein blätterte also um und stellte konsterniert fest, dass auch die zweite Seite dem Treffen der beiden Regierungschefs gewidmet war. Und da ihn die Änderungen im jugoslawischen Generalstab gleichfalls nur mäßig zu interessieren vermochten, wanderten seine Augen nur allzubald auf Seite drei. Aber Besserung trat nicht ein. Was sollte ihn die Pariser Konferenz kümmern – oder der Locarno-Pakt? War denn gar nichts für ihn ins Blatt gerückt? Der Krieg in Äthiopien. Bronstein seufzte. Der italienische Glatzkopf wollte partout in die Fußstapfen Julius Caesars treten und Rom ein neues Imperium schenken, weshalb sein Marschall Badoglio sich jetzt in irgendeiner Savannensteppe mit schlecht bewaffneten und ausgemergelten Negern herumschlug, die offenbar zäh genug waren, den Europäern die Stirn zu bieten. Bronstein klopfte Asche ab und wandte sich dem Chronikteil zu. Die Überschrift »Särge und Wiegen« erweckte sein Interesse. Doch erlosch dieses schnell, als er herausfand, dass lediglich ein vorwitziger Redakteur eine pfiffige Formulierung für die Zahl der neu Geborenen und der frisch Dahingegangenen gewählt hatte. Und Gevatter Tod war nun wahrlich kein ansprechender Tischgast beim morgendlichen Mahl.
Umso mehr überraschte es Bronstein, dass Bürgermeister Schmitz eine Lanze für die Frauenarbeit brach: Es gäbe nun einmal viel mehr Frauen als Männer in diesem Lande, weshalb es unmöglich sei, dass jede Frau einen Ehemann abbekomme, ließ der Stadtvater verlauten. Und wie man es der Witwe oder der Tochter eines Gewerbetreibenden kaum verarge, an dessen statt die Geschäfte fortzuführen, so dürfe man auch anderen Frauen die Erwerbsarbeit nicht versagen, zumal es Berufe gebe, in denen Frauen bessere Leistungen erzielten als Männer. Bronstein ertappte sich dabei, wie er durch die Zähne pfiff. Der Mann redete ja wie seinerzeit eine sozialdemokratische Funktionärin. Ob das seine christlich-sozialen Standesgenossen goutierten? Ah, endlich kam das Frühstück.
Flink köpfte Bronstein das dargereichte Ei, um es sodann genüsslich auszulöffeln. Den Artikel über die Frauenarbeit vergaß er darob gänzlich. Erst als er sein Mahl beendet hatte und sich behaglich eine zweite Zigarette anzündete, nahm er die Zeitung noch einmal zur Hand und blätterte achtlos weiter. In Leoben waren neuerlich sechs Nazis abgeurteilt worden, und im Wiener Polizeigefangenenhaus war der Schließer Anton Mayer plötzlich und unerwartet im Dienst verschieden. Bronstein schluckte. Er kannte Mayer flüchtig von diversen früheren Fällen und wähnte den Mann in seinem Alter. Und da war sie wieder, diese beklemmende Unruhe, die ihn schon am Morgen in ihren Klauen gehalten hatte. Bronstein nahm einen großen Schluck aus dem Wasserglas, das dem Kaffee beigegeben war, und suchte nachgerade hektisch nach dem Kultur- oder wenigstens dem Sportteil.
Ah! Eine Jules Verne-Verfilmung, die in die Kinos kam! Michael Strogoff. Dunkel erinnerte sich Bronstein an den Stoff. Es ging um einen wagemutigen Kavalleristen, der eine wichtige Botschaft des Zaren durch die feindlichen Linien brachte, um so den von den finsteren Tartaren bedrängten Russen in Sibirien die heiß ersehnte Rettung anzukündigen. Dass ausgerechnet Adolf Wohlbrück den Strogoff spielte, irritierte Bronstein ein wenig, kannte er diesen doch eher als Repräsentant der sehr seichten Muse. Und Maria Andergast als Nadja kam ihm gleichfalls seltsam vor, da die doch bislang eher als Partnerin von Luis Trenker in diversen Bergdramen aufgefallen war. Aber nach der Lektüre der Filmkritik ahnte Bronstein, dass seine Skepsis wohl begründet war. Die Zeilen waren ein eindeutiger Verriss. Also würde Bronstein den Weg ins Kino wohl nicht anzutreten haben. Dafür aber jenen ins Büro. Ein Blick auf seine Taschenuhr überzeugte Bronstein davon, dass es höchst an der Zeit war, sich wieder in Bewegung zu setzen, wollte er sich tadelnde Worte seines Vorgesetzten ersparen. Er signalisierte Alfons mit einer nachlässigen Handbewegung, dass er zu zahlen wünsche, legte dann die Zeitung beiseite, erstattete den geforderten Betrag samt Trinkgeld und verließ daraufhin eilig die Lokalität.
Fünf Minuten nach 9 Uhr betrat Bronstein das Gebäude der Polizeidirektion, grüßte jovial den Portier und begab sich die Treppe hinauf zu seinem Amtszimmer, wo er bereits von Cerny ungeduldig erwartet wurde.
»Wozu hast du eigentlich Telefon, wenn du nicht abhebst?«, empfing ihn dieser mit einem vorwurfsvollen Ton, »ich hab’ schon dreimal angeläutet. Wir haben nämlich …«
Bronstein zuckte mit den Schultern. »Ich war am Weg hierher«, replizierte er knapp.
»45 Minuten? Kaum. Gib’s zu, du warst noch im Kaffeehaus!« Cerny schnitt eine Grimasse. »Hätte ich mir eigentlich denken können. Warum hab’ ich nicht dort angerufen?«
Bronstein grinste: »Weilst ein Mensch bist und mir mein Frühstück gegönnt hast.« Um danach förmlich zu werden: »Also. Was hamma?«
»Einen Mord«, kam es prompt. Bronstein zog die Augenbrauen hoch. »Aha! Und wo?«
»In Simmering draußen.«
Bronstein verdrehte die Augen. »Des a no!«
Ohne sich erst auf seinem Schreibtisch niederzulassen, machte Bronstein kehrt und bedeutete Cerny, ihm zu folgen. Sie gingen zur Fahrbereitschaft und orderten einen Wagen, der sie zum Tatort bringen sollte. Alsbald stand ein schwarzer Steyr samt Fahrer vor ihnen, und beide kletterten in den Fond. Bronstein nutzte die zu erwartende Zeitspanne, um sich eine weitere Zigarette zu gönnen. Beinahe automatisch bot er Cerny auch eine an, der diese ebenso automatisch ablehnte. Bronstein nahm einen tiefen Zug und blies den Rauch dann entspannt aus. Das Automobil hatte den Innenhof zwischenzeitlich verlassen und war auf den Ring eingebogen. Eine Weile fuhr man am Quai entlang, ehe man in die Lände einbog.
Bronstein registrierte, dass außer ihnen kaum Wagen auf der Straße waren, und fragte sich instinktiv nach dem Warum. Noch vor zwei, drei Jahren war der Verkehr an dieser neuralgischen Stelle beinahe unüberschaubar gewesen, der Versuch, zu Fuß vom Schwedenplatz zum Donaukanal zu gelangen, glich damals einem tollkühnen Akt. Nun aber herrschten andere Zeiten, und selbst eine fußmarode Oma wäre ohne Probleme auf die andere Straßenseite gekommen. »Hab ich was verpasst?«, fragte er scheinbar unmotiviert in Cernys Richtung, »ist heute ein Feiertag? Oder warum ist kaum jemand unterwegs?«
»Wer kann sich in solchen Tagen noch ein Automobil leisten, frag ich dich?«, kam es zur Antwort, »die vielen Arbeitslosen vielleicht?« Bronstein verzog seinen Mund: »Ach, ich hab’ geglaubt, uns geht’s so gut wie nie zuvor. Sagt das die Regierung nicht andauernd?« Cerny nickte kaum merklich in die Richtung des Fahrers und sah dann Bronstein mit unzweideutigem Blick an. Offensichtlich war er sich nicht sicher, ob der Fahrer dem Regime nicht in ergebener Treue verbunden war. Just in diesem Augenblick ließ dieser sich vernehmen: »Wenn’s wegen mir ist, die Herrschaften, dann brauchen S’ keine Hemmungen an den Tag zu legen. Mir sind diese Ständestaatler genauso z’wider wie Ihnen.«
»Aber Sie sind doch Mitglied in der Vaterländischen Front, Kollege. Oder etwa nicht?« Der Chauffeur zuckte mit den Schultern. »Ja eh. Und? Wenn morgen der Hitler einmarschiert, dann geh’ ich halt zu den Nazis. Aa schon was! Deswegen bleiben die für mich trotzdem alles Oaschlöcher. Waren s’ immer, sind s’ immer, werden s’ immer bleiben.« Bronstein fand, es war wieder einmal Zeit für gehobene Augenbrauen. Der Fahrer wiederum schien zu der Auffassung gekommen zu sein, seinen politologischen Ausflug mit einem deftigen Schlussakkord ausklingen zu lassen: »So ist das mit den Großkopferten. So, und nicht anders.«
Sie passierten Erdberg. Die Gegend wirkte gespenstisch ausgestorben. Wo vor einigen Jahren noch hektische Betriebsamkeit geherrscht hatte, dominierten nun leere Werkstätten und verlassene Geschäfte, deren Türen und Fenster mit Brettern verbarrikadiert waren. Der Anblick schlug sich Bronstein aufs Gemüt, und so wandte er sich wieder an Cerny: »Wo ist die Leiche überhaupt g’funden worden? Das hast du mir noch gar nicht g’sagt. Und was wissen wir bisher überhaupt über die ganze Sache?«
Cerny lächelte: »Ich hab’ geglaubt, du fragst gar nicht mehr! In der Dommesgasse. Auf Nummer 10. Ecke Lorystraße …« Bronstein dämpfte den Rest seiner Zigarette aus. »Dort sind lauter Bauten aus dem roten Wien. Lass mich raten. Das Opfer ist ein Sozi.« Cerny lächelte schmal. »Wegen dieser schnellen Auffassungsgabe bist du der Ober und ich der Unter.« Und nach einer kurzen Pause, um den kleinen Seitenhieb wirken zu lassen. »Ja, ein ehemaliger Vertrauensmann der Simmeringer Sozialdemokraten ist das Opfer. Schon zweifelsfrei identifiziert. Hans Binder. 44. War bis vor zwei Jahren Bezirksrat für die Roten in Simmering. Dann eine Weile in Wöllersdorf. Und dann in Kaiser-Ebersdorf. Ist erst zu Weihnachten voriges Jahr wieder freigekommen. Gilt … galt als Unterstützer der RS.«
»Der Revolutionären Sozialisten?«, fragte Bronstein sicherheitshalber nach, da er sich mit den diversen illegalen Gruppen für gewöhnlich nicht beschäftigte. »Genau die. Von denen stehen demnächst etliche vor dem Strafrichter. Weißt eh, Hochverrat und so.«
Bronstein nickte anerkennend. »Und das hast du alles heute schon eruiert, oder wie?« Cerny bestätigte diese Annahme und fügte hinzu, er sei ja schon seit 8 Uhr im Büro gewesen und habe die Zeit bis zu Bronsteins Eintreffen zu einem Studium der einschlägigen Akten über Binder genützt. »Alle Achtung, Cerny. Das war gute Arbeit.«
Der Wagen hatte nun endlich den Enkplatz erreicht und bog in die Simmeringer Hauptstraße ein. Einige Gassen weiter lenkte der Chauffeur das Automobil nach rechts und brachte es vor dem Haus Dommesgasse Nummer 10 zum Stehen. Bronstein klopfte sich auf die Oberschenkel. »Na, dann pack mas!«
Vor dem Haustor hatte sich eine ansehnliche Menschentraube gebildet, die von zwei Uniformierten nur mühsam im Zaum gehalten werden konnte. Kaum wurden Bronstein und Cerny von der Menge wahrgenommen, waren die beiden auch schon Adressaten unterschiedlichster Kommentare, die von »da sind s’ ja endlich, die Kieberer« bis zu »wird aber auch Zeit« reichten. Bronstein machte eine begütigende Geste mit seinen Händen. »Herrschaften, jetzt simma ja da, also lasst’s uns bitte unsere Arbeit machen, umso schneller ist die ganze Sache aufgeklärt.«
»Aufgeklärt? Was heißt da aufgeklärt?«, belferte ihn ein blasser Jüngling an, der kaum noch einen Bartflaum unter der Nase aufwies. »Die G’schicht’ ist ja eh völlig klar. Den Hans, den haben die Faschisten g’macht.« Dafür gab es eifrige Zustimmung seitens der übrigen Anwesenden. »Ich danke für den Hinweis. Wir werden ihm selbstverständlich nachgehen. Jetzt müssen wir aber erst einmal den Tatort besichtigen. Wenn Sie also bitte beiseitetreten würden.« Bronstein war selbst überrascht, wie konziliant er auftrat. Auch Cerny entging die kalmante Art seines Chefs nicht. An anderen Tagen mochte er in solchen Augenblicken die Fassung verlieren und die Leute anbrüllen, sie sollten die Amtshandlung nicht behindern, widrigenfalls er ihre Arretierung verfüge. Doch nun zeigte sich sein Vorgesetzter von einer beinahe noblen Höflichkeit, die auch die ursprünglich gegen sie gerichtete Feindseligkeit rasch zum Abebben brachte. Schweigend wurde ihnen Platz gemacht, und endlich standen die beiden Ermittler im Gang des Erdgeschosses. Bronstein sah Cerny an: »Was sagst du? Erst Tatort, dann Hausmeisterin oder umgekehrt?«
Cerny musste unwillkürlich lächeln. Er wusste um Bronsteins langjährige Erfahrungen mit den diversen Concierges. »Schauen wir uns einmal die Binder-Wohnung an, dann darfst dich wieder mit einem Wiener Original abgeben.« Bronstein beugte sich leicht nach vorn und streckte den linken Arm aus: »Nach Ihnen, der Herr.«
Die Wohnung Binders befand sich im zweiten Stock und war ebenfalls durch einen uniformierten Kollegen gesichert. Bronstein hob kurz seine Kokarde hoch und trat dann in den kleinen Raum, der offenbar als Küche und Aufenthaltsraum diente. Da sich nur eine einzige weitere Tür in dem Gelass fand, schloss Bronstein, dass sich dahinter ein Kabinett verbarg, mutmaßlich Binders Schlafgemach. Bronstein machte einen Herd, einen wackeligen Tisch, eine Eckbank und zwei Sessel aus, dazu noch eine Kredenz, aber keine Leiche. Binder musste dementsprechend im Kabinett liegen. Er machte einen Schritt auf die Tür zu und öffnete sie. In dem kargen Zimmer standen lediglich ein schmales Bett und ein klobiger Schrank, und mitten auf den Holzbrettern, die den Boden bildeten, lag in merkwürdiger Verrenkung eine dürre Gestalt, in deren Gesicht ein Ausdruck unendlichen Erstaunens eingegraben war.
Bronstein ließ seinen Blick eine gute Weile auf dem Toten ruhen. Was, so fragte er sich selbst, war auffällig? Binder war mit einer abgetragenen Hose bekleidet, die fraglos schon bessere Tage gesehen hatte. Dazu ein leinernes Hemd, dessen Ellbogen durch aufgenähte Lederecken geflickt waren. Die Hosenträger hatten offenbar die Aufgabe gehabt, das viel zu weite Beinkleid daran zu hindern, einfach nach unten zu rutschen. Und, so resümierte Bronstein, Binders rechter Schuh hatte in der Sohle ein Loch.
Ein solches hatte auch das Hemd. Mitten über der linken Brust. Genau in der Herzgegend. Und selbiges war blutumrandet. Bronstein brauchte keinen Pathologen, um die Todesursache zu erfragen. Der Mann war erschossen worden. Der Menge des Blutaustritts nach zu schließen mit einer kleinkalibrigen Waffe. »Hat jemand den Schuss g’hört?«, wandte er sich an den Beamten, der immer noch in der Wohnungstür stand. »Bitte, Herr Oberst, das weiß ich nicht. Aber die Partei aus der Wohnung unterhalb, die hat bei der Hausmeisterin g’meldet, dass einen Pumperer g’hört hat. Und dann soll jemand in einem Höllentempo die Stiegen runterg’rennt sein, hat’s g’sagt.«
»So. Hat’s das g’sagt, die Partei«, echote Bronstein. »Na, dann werden wir uns die Partei einmal näher anschauen. Gemma, Cerny.« Und an den Polizisten gerichtet: »Sie passen mir da weiter auf, dass niemand außer uns da reingeht, ja?« Der Uniformierte stieß die Hacken zusammen und salutierte.
Eine Etage tiefer pochte Bronstein gebieterisch an die entsprechende Wohnungstür und war gleich darauf erstaunt, wie prompt selbige geöffnet wurde. »Na, da sind S’ ja endlich. Wenn man die Polizei einmal braucht, dann kommt s’ ewig nicht daher.«
Bronstein hätte vollkommen taub sein können, allein an der erbosten Miene der Frau wäre abzulesen gewesen, wie empört sie war. »Gnädigste, wir sind so schnell gekommen, wie es uns möglich war.«
»Ja, ja, um Ausreden seid ihr Mannsbilder ja nie verlegen. Aber gleichviel. Sie wollen sicher wissen, was ich g’hört und g’sehen hab. Hab ich recht?«
»So ist es, Gnädigste.« Bronstein bemühte sich um sein gewinnendstes Lächeln.
»Na, dann kommen Sie erst einmal herein, die Herren. Muss ja nicht das ganze Haus hören, was ich Ihnen zu sagen habe.« Die Frau trat einen Schritt zurück und bot Bronstein und Cerny so Gelegenheit, in die Küche zu kommen. Bronstein fiel sofort auf, dass diese beinahe ident mit jener Binders war, doch viel Spielraum besaß man in diesen kleinen Räumen wohl auch nicht. Herd, Kredenz, Esstisch, Bank und Sessel, damit war der Platz auch schon zur Gänze ausgefüllt. Eine ausladende Geste der rechten Hand hieß die beiden auf der Bank Platz nehmen. Bronstein ließ Cerny den Vortritt und ersparte sich so, sich mühsam hinter den Tisch zu zwängen. Komfortabler saß er dadurch freilich auch nicht, da die Bank sich als so schmal erwies, dass Bronsteins linke Hinterbacke zur Hälfte über das Ende der Sitzfläche hinausragte. Unwillkürlich drängte er nach rechts und fühlte sich wie in einer überfüllten Tramway.
»Einen Eichelkaffee kann ich Ihnen anbieten. Mehr kann ich mir von meiner Rente nicht leisten«, kam es schneidend von der Tatzeugin.
Bronstein winkte ab: »Tun S’ Ihnen nix an. Wir sind nicht heikel.« Er kramte nach seinen Zigaretten. »Aber rauchen werden wir doch dürfen, oder?«
Die Alte lachte. »Also wenn S’ das nicht mehr dürfen, dann ist’s endgültig aus mit der Menschenwürde. Also nur zu!«
Er steckte sich eine »Donau« an und kam dann auf das eigentliche Thema seines Hierseins zurück. »Der Binder. Was können S’ mir über den erzählen?«
»Eigentlich nur das Beste«, kam es prompt. »Der hat sich, seit er aus dem Krieg z’rückkommen ist, stets für die Allgemeinheit engagiert. Ich mein’«, und dabei drehte sich die Frau zu den beiden Ermittlern um, »nicht, dass glauben, ich wär’ ein Sozi oder so, aber was wahr ist, das muss auch wahr bleiben. Er war ein feiner Mensch, der Herr Binder. Ned so wie die Affen, die da jetzt herumrennen und auf wichtig machen.«
Sie beugte sich über den Herd und prüfte den Zustand ihres Gebräus. »Ich mein, der hat sich selber immer am wenigsten gegönnt. D’rum hat er auch immer noch in dem Loch da gehaust, obwohl er sich seinerzeit sicher was Besseres hätte leisten können. Und ich sag’ Ihnen noch eines.« Wieder drehte sie sich um. »Mir ist das wurscht, was diese Wastln da beim Gericht über ihn g’sagt haben. Es war nicht recht, dass der Herr Binder ins Elend gekommen ist.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich weiß schon, mit wem ich red’, aber Recht muss Recht bleiben. Der Herr Binder hat sich nie was zuschulden kommen lassen, auch wenn die Hahnenschwanzler hundertmal was anderes erzählt haben. Haben S’ vielleicht für mich auch eine?«
Für einen Moment war Bronstein ob des letzten Satzes verwirrt, ehe er verstand, dass die Frau eine Zigarette wollte. Er griff nach der Schachtel und hielt sie in die Luft. Sein Gegenüber trat näher und fingerte einen Glimmstängel aus dem Karton. Reflexartig gab er ihr Feuer. Sie saugte den Rauch gierig in die Lungen und machte dabei ein verzücktes Gesicht. »Ah, das tut gut. Und beruhigt die Nerven, wissen S’! Ich wollt’, ich könnt’ mir öfter Tschik leisten. Aber bei meiner …«
»… Rente, ich weiß«, vollendete Bronstein den Satz, »ja, es sind harte Zeiten.«
Das Gesicht der Frau verfinsterte sich. »Für uns sind’s immer harte Zeiten. Eine Katastrophe jagt die nächste. Wir kleinen Leute können machen, was wir wollen, wir kommen unser Lebtag nicht auf einen grünen Zweig. Und heutzutage schon gar nicht.«
Sie drehte sich abrupt um, kramte in ihrer Kredenz nach ein paar Tassen, schenkte den Kaffee ein und reichte sie sodann den Polizisten. »Milch hab’ ich keine, aber irgendwo müsste noch ein Wengerl Zucker sein, wenn S’ wollen.« Bronstein winkte ab. »Ah, das passt schon so.« Und nach einer kurzen Pause, in der er vorsichtig an dem Porzellan genippt hatte: »Es heißt, Sie haben einen Pumperer g’hört.«
Eifrig nickte die Frau. »Ja, gegen halb sechs wird’s gewesen sein. Ich war g’rad mit der Morgenwäsch’ fertig und hab’ mich da drinnen in meinem Kabinett anzogen, als es ober mir einen richtigen Tuscher g’macht hat. Ich hab’ mir noch denkt, jetzt ist der Binder aus dem Bett g’fallen. Wissen S’«, sie trat wieder einen Schritt näher an den Tisch heran, »er war ja sehr schlecht beinander, seit s’ ihm das letzte Mal aus dem Häfen auslassen haben. Auf der Lunge hat er’s g’habt, der Binder.« Sie zog noch einmal an ihrer Zigarette, ehe sie sie im Aschenbecher ausdämpfte. »Den Tuberer hat er sich sicher im Tschumpas g’holt, der Arme. Na ja, jedenfalls denk’ ich mir, es könnt’ nicht schaden, einmal nachzuschauen. Vielleicht ist ihm ja was, und er braucht Hilfe, ned wahr. Also ich zur Tür, mach’ sie auf, und da rennt ein junger Kerl mit einem Mordskaracho die Stiegen runter, als wär’ die wilde Jagd hinter ihm her.«
»Ein junger Kerl? Wie sah der aus?« Cerny war offenbar zu dem Schluss gekommen, auch einmal etwas sagen zu müssen.
»Na, das kann ich Ihnen nicht sagen«, entgegnete sie, »das ist so schnell gegangen, ich hab’ grad noch g’sehen, dass er kurze blonde Haare g’habt hat, einen grauen Wolljanker und solche halblangen Hosen. Und weiße Kniestrümpf’, die in Haferlschuhen g’steckt sind.«
»Na, Gnädigste, das ist doch schon eine ganze Menge«, kam es anerkennend von Bronstein. »Sie wissen aber schon, welche Art Zeitgenossen Sie uns da beschrieben haben, oder?« Bronstein lächelte schmal.
»Ja«, kam es prompt zurück, »einen von diese Nazis. Aber glauben S’ mir, genau so hat er ausg’schaut. So und ned anders.«
Bronstein und Cerny wechselten einen schnellen Blick. Die Sache drohte heikel zu werden. Nun galt es, jeden Schritt sorgsam abzuwägen. »War das üblich, dass der Herr Binder Besuch g’habt hat? Um so eine Zeit, mein’ ich.«
Die Frau schien einen Augenblick lang nachzudenken. »Eigentlich ned. Der Herr Binder hat zuletzt ja recht zurückgezogen gelebt, wissen S’. Der hat sich nicht einmal mehr mit seine alten Spezi von der Partei getroffen. Weil er die nicht in Gefahr bringen wollt’, nehm’ ich einmal an. Immerhin ist er ja regelmäßig von der Heh… von der Polizei überwacht worden.«
Das kam Bronstein sehr plausibel vor. Die Sicherheitsdirektion verwendete unendliche Mühe darauf, irgendwelche vermeintlichen oder tatsächlichen Oppositionellen auf Schritt und Tritt zu verfolgen, sodass für die eigentliche Polizeiarbeit kaum noch Ressourcen übrig blieben.
»Außerdem war er ja schon lange ausg’steuert. Der hat vom Fensterkitt leben müssen, der Herr Binder«, fuhr die Frau zwischenzeitlich fort, »das hat ihm natürlich auch nicht g’rade gut getan.«
»Verheiratet war er ja nicht, der Herr Binder, oder?« Er erntete ein Kopfschütteln. »Sonst irgendeine Familie? Einen Bruder, eine Schwester, entferntere Verwandtschaft?«
»Bitte, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Herr Binder eigentlich nie Besuch gekriegt hat. Und, dass er auch sehr selten außer Haus gegangen ist. Ja, hie und da zur Milchfrau, vielleicht auch einmal in die Trafik, aber das war’s dann auch schon wieder.«
»Das klingt ziemlich trostlos. Was hat er denn dann g’macht die ganze Zeit? Wissen S’ das vielleicht?«
»G’lesen. Den ganzen Tag hat er g’lesen. Bücher ohne Unterlass.«
Bronstein vergegenwärtigte sich Binders Bleibe. Ein Bücherschrank war ihm nicht aufgefallen. Ob der Mann Kunde in einer Bücherei gewesen war?
»Also die, die s’ ihm g’lassen haben«, fuhr die Frau derweilen fort und erntete dafür zwei fragende Blicke.
»Na ja, die Spinaterer. Die haben ja fast alles konfisziert, was der Herr Binder an Büchern g’habt hat. Umstürzlerische Schriften, haben s’ das g’nennt.« Die Frau lachte glucksend auf. »Ja mei, was für so einen Schurl mit der Blechhauben halt ein Giftl ist, gelt.« Sie beugte sich nach vor und kam ganz nahe an die beiden Männer heran. »Da waren ein Schiller dabei, ein Nestroy, sogar ein Grillparzer. Die haben einfach alles mitg’nommen, was s’ nicht gekannt haben. Und glauben S’ mir’s, solche Gablitzer, die kennen nicht viel.«
»War er dann in einer Bücherei eing’schrieben?«, griff Bronstein seinen ursprünglichen Gedanken wieder auf. »Bücherei, pff«, machte sie eine abfällige Geste, »da kriegen S’ ja heutzutage nichts G’scheites mehr. Dort haben die Hahnenschwanzler ja auch alles aussortiert, was irgendwie spannend wär’. Nein, der Herr Binder hat die Schmier sauber ang’schmiert.« Wieder kam ihr Gesicht ganz nahe an das von Bronstein heran. »Unter die Bohlenbretter, da hat er seinen Schatz versteckt. Unterm Boden liegt seine ganze Bibliothek. Die hat er dann immer einzeln rausg’holt und g’lesen. Den ganzen Tag über. Und, was ich weiß, Notizen hat er sich g’macht in einer Tour. Die müssten auch da drunten liegen.«
Bronstein kam zu dem Schluss, es konnte nicht schaden, nach dem Gespräch noch einmal in der Binderschen Wohnung Nachschau zu halten.
Er sah Cerny fragend an und wollte unausgesprochen wissen, ob es noch etwas gab, das thematisiert werden sollte. Da dieser aber stumm blieb, sah Bronstein wieder die Gastgeberin an. »Ich danke vielmals für die Auskünfte und den Kaffee. Sollten wir noch etwas brauchen, wissen wir ja, wo wir Sie finden.« Die Frau lächelte schmal: »Genau. Wo sollt’ ich auch anders hin auf meine alten Tag’. Das Einzige, was unsereins hat, ist die Zeit. Ganz viel sogar. So viel, dass man meinen möcht’, man weiß gar nicht, wohin damit. Aber andererseits wird die Zeit einem auch mit jeden Tag knapper, weil so oder so kommt irgendwann der Quiqui, und dann wär’s einem recht, man hätt’ doch ein Wengerl mehr von dieser Zeit.«
»Das haben S’ jetzt schön g’sagt, Gnädigste.« Bronstein erhob sich schwerfällig. »Wir dürfen uns empfehlen, Frau …«
»Gattinger. Gertrude Gattinger. Blöder Nam’, ich weiß. Dabei bin ich gar nicht verheiratet.« Sie lächelte verlegen. Bronstein überlegte kurz, ob er an dieser Stelle einen schalen Scherz anbringen sollte – dass sie auf diese Weise wenigstens nicht Unter-Gattinger geworden war, womit er auf einen allgemeinen Terminus für Unterwäsche angespielt hätte –, doch kam er zu dem Schluss, dass die Pointe zu flach war, um sie tatsächlich vorzutragen. Er nickte daher nur kurz und begab sich dann, Cerny hinter sich wissend, wieder auf den Gang. Am Stiegenabsatz angekommen, holte er seine Uhr aus der Tasche. »Halber elfe vorbei. Ich denk’, wir können uns ein Bier genehmigen.«
Cerny legte ein gewisses Maß an Skepsis an den Tag: »Wir sind im Dienst. Meinst wirklich, dass das angebracht ist?«
»Ach was. In einem Beisl erfährt man mehr als in zahllosen Befragungen. Nützen wir die Gelegenheit und horchen die hiesigen Eingeborenen ein wenig aus.« Cernys Widerstand war schnell gebrochen, und so verließen sie das Haus und wandten sich nach rechts, wo sie bei der Herfahrt eine Gastwirtschaft ausgemacht hatten.
Kaum hatten sie das Innere des Lokals betreten, erstarb augenblicklich jede Unterhaltung. Dutzende Augenpaare musterten die neu Eintretenden argwöhnisch. Bronstein ignorierte dieses Verhalten, schlenderte gemächlich zur Schank und orderte zwei große Gemischte, ehe er sich an einem der hinteren Tische niederließ. Cerny tat es ihm gleich und beobachtete, wie Bronstein sich eine weitere »Donau« ansteckte. Die anderen Gäste kamen zwischenzeitlich zu dem Schluss, dass von den beiden keine Gefahr ausging, und setzten ihre Gespräche fort. Der Wirt spachtelte das Übermaß an Schaum von den Gläsern, ließ noch ein wenig mehr Gerstensaft in die selbigen laufen, ehe er hinter seiner Budel hervorkam und die beiden Biere direkt vor Bronstein und Cerny abstellte. Ohne ein Wort ließ er die beiden wieder allein.
Bronstein prostete Cerny zu und nahm einen kräftigen Schluck. Er stellte sein Glas ab und strich sich über den Bart. »Bis jetzt«, begann er, »wissen wir nicht wirklich viel – und doch auch alles.«
Cerny sah ihn von der Seite an. »Mir deucht, du sprichst in Rätseln.« Bronstein lächelte.
»Die Sache ist doch sonnenklar. Der Binder ist von irgendeinem Nazi ermordet worden. Das passt in unsere Zeit. Was wir nicht wissen, ist, warum es gerade den Binder erwischt hat.«
»Und wir wissen schon überhaupt nicht, wie das überhaupt passieren hat können«, hielt Cerny dem entgegen. Um sogleich nachzusetzen: »Du weißt selbst, wie solche Auseinandersetzungen üblicherweise ablaufen. Die geschehen auf offener Straße, und da überfallen meist mehrere Hitler-Buben einen politischen Gegner, den sie dann zu Tode prügeln. Ganz selten kommt dabei eine wirkliche Waffe ins Spiel, und selbst dann handelt es sich in der Regel nicht um eine Pistole. Und schon gar nicht sucht ein Attentäter sein Opfer zu Hause auf und richtet ihn dort regelrecht hin.«
Bronstein fuhr sich weiter über den Bart. »Da ist was dran. Das ist tatsächlich unüblich.« Er räusperte sich. »Gut, so wie die Szenerie aussieht, hat der Binder seinen Mörder gekannt. Sehr gut sogar offenbar, denn sonst hätte er ihn nicht in sein Kabinett gelassen.«
»Oder«, gab Cerny zu bedenken, »Binder wollte etwas aus dem Raum holen, und der Mörder ging ihm nach. Vielleicht auch daher Binders überraschter Gesichtsausdruck.«
»Der kann aber auch daher stammen, dass er nicht damit rechnete, dass der andere Mann plötzlich eine Waffe in der Hand haben würde.« Cerny schluckte kurz. »Stimmt«, pflichtete er seinem Chef tonlos bei.
Bronstein trank einen weiteren Schluck. »Jedenfalls eine vertrackte G’schicht’. Das Verdikt unserer sauberen Vorgesetzten höre ich jetzt schon. Ein Lump hat einen anderen Lumpen meia g’macht, das geht uns nix an, werden die sagen. Und gar nicht erfreut sein, wenn wir da weiter herumstiereln. Die Sache wird uns noch ganz schön Scherereien einbringen.«
»Da magst recht haben. Aber jedes Opfer verdient es sich, dass es gesühnt wird. Und so ein armes Würschtl wie der Binder erst recht.«
»Eh wahr«, bekräftigte Bronstein Cernys Worte, »ich hab’ ja auch nicht g’sagt, dass wir uns von den Großkopferten was vorschreiben lassen. Ich mein’ nur, dass wir es geschickt angehen müssen. Dem Skubl müssen wir die ganze Sache so präsentieren, dass er nicht sofort den Braten riecht und uns zurückpfeift. Weißt eh, wie der ist.«
»Das heißt, wir sagen vorerst einmal nichts von unserem naheliegenden Verdacht?«
»Genau. Wir berichten nur von einem jungen Mann, der laut Zeugen aus der Wohnung geflüchtet ist und nach dem wir nun suchen. Dann wird der Skubl uns keine Knüppel zwischen die Beine …« Bronstein erstarb mitten im Satz, denn ein neu ins das Lokal eintretender Mann sorgte für eine abrupte Änderung der Atmosphäre. Wie schon bei ihrem eigenen Erscheinen verebbte augenblicklich jede Unterhaltung. Und doch war diesmal etwas anders. Fast zeitgleich kam es von allen Tischen »Bitte zahlen!« Und noch ehe Bronstein und Cerny auch nur einen Blick hatten wechseln können, traten die übrigen Männer an die Theke und beglichen dort ihre Zeche. Der Mann aber, dem diese einheitliche Reaktion geschuldet war, stand verlegen neben der Tür und wusste sichtlich nicht wohin mit sich.
Der Wirt würdigte ihn keines Blickes. Auch nicht, nachdem sich die Stube praktisch gänzlich geleert hatte. Zurückgeblieben waren nur Bronstein und Cerny an ihrem Tisch sowie der fremde Eindringling, der sich nun doch niedergesetzt hatte und darauf zu warten schien, vom Gastwirt bedient zu werden. Der aber wienerte scheinbar gedankenverloren an einem Glas herum und verspürte sichtlich nicht die geringste Lust, mit dem Mann ins Geschäft zu kommen.
»Ein Bier hätt’ ich gern«, kam es schließlich mit überraschend dünner Stimme aus dessen Munde. Eine Reaktion unterblieb gleichwohl. »Ein Bier, hab’ ich g’sagt«, versuchte er es nach einer kurzen Weile erneut. Abermals gingen seine Worte ins Leere. »Ich hab’ ein Bier best…«
Endlich schleuderte der Wirt sein Tuch in die Spüle. »Ich hab’ g’hört, was du g’sagt hast«, kam es tief und grollend zurück, »aber bei mir kriegst du nix, du Lump.«
»Ich hab’ aber gutes Geld«, beharrte der verschmähte Gast.
»Was du hast, ist Blutgeld. 30 Silberlinge hast du, nicht mehr und nicht weniger. Also scher dich raus da, bevor ich rabiat werde.«
Bronstein fixierte den verhinderten Zecher, dem deutlich anzusehen war, wie Wut, Enttäuschung und Demütigung in ihm um die Vorherrschaft rangen. »Na, was ist? Bist noch nicht weg?« Der Wirt begann demonstrativ, seine Hemdsärmel hochzurollen. »Wenn ich bei dir am Tisch bin, dann servier ich dir meine Rechte. Mitten in dein Verrätergfries. Also freu dich.«
Nun endlich kam Bewegung in den Mann. Er erhob sich langsam und schlich träge Richtung Ausgang. Dort erst, direkt in der Tür, wagte er es, die Faust zu ballen und sie in Richtung des Wirts zu schütteln. »Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Du wirst es auch noch billiger geben!« Der Wirt winkte nur ab und schickte deutlich hörbar das Götz-Zitat hinterher.
Bronstein kam zu dem Schluss, dass die Szene zu einem Ende gekommen war. »Wir würden dann auch gern zahlen, wenn’s recht ist«, erklärte er aufgeräumt. Der Wirt kam an ihren Tisch und nannte den erforderlichen Betrag. »Verzeihen Sie, wenn wir neugierig sind«, begann Bronstein, nachdem er einige Münzen, die auch ein ansprechendes Trinkgeld beinhalteten, auf die Platte gelegt hatte, »aber es war ja nicht zu übersehen, was da eben vorgefallen ist. Dürften wir vielleicht den Grund für diese … nun, Begebenheit erfahren.«
»Das Arschloch hat sich von den Hahnenschwanzlern kaufen lassen. Verdreht jetzt das Schmierblattl von der Heimwehr. Na, und das kommt ned gut in einem Wirtshaus, wo wir alle Sozis sind. Und wenn’s hundertmal verboten ist. Eine Gesinnung wechselt man nicht wie ein Unterhemd. Da ist kein Platz für Verräter.«
Die Miene des Wirts ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, dass er genau wusste, mit wem er sprach. Doch anscheinend war es ihm gleichgültig, dass er sich solcherart gegenüber Polizisten äußerte. In seinen Augen loderte etwas Bedrohliches, das darauf hindeutete, er würde auch bei Staatsbeamten zum Faustschlag ausholen, wenn es ihm geboten erschien.
»Wenn Sie hier alle Sozis sind, dann kennen Sie sicher auch den Binder Hans, oder?«
Der Wirt straffte sich und wirkte dadurch noch furchteinflößender. »Natürlich hab’ ich den Hans gekannt. Und ich weiß auch, dass er tot ist. D’rum seid ja jetzt ihr von der Schmier da herinnen.«
»Auch wenn Sie es vielleicht nicht glauben, aber wir haben die unerschütterliche Absicht, die Umstände, die zum Tod des Herrn Binder geführt haben, zu erhellen und den Täter zu überführen.« Bei diesen Worten bemühte sich Bronstein um ein sympathieheischendes Lächeln.
Tatsächlich hellte sich die Miene des Wirts ein wenig auf. »Das glaub’ ich euch sogar. Aber man wird euch nicht lassen. Und wenn ihr stur bleiben solltet, dann könnt ihr euch gleich meinen sonstigen Gästen anschließen. Als Arbeitslose.«
»Das mag sein. Aber so schnell gibt ein David Bronstein nicht auf. Und daher wäre Ihre Hilfe höchst erwünscht.« Der Schankwirt legte die Stirn kraus. »Haben S’ grad Bronstein g’sagt?« Der Oberst nickte langsam und blieb dabei abwartend. »Sind Sie der, der was vor acht, neun Jahr’ in der Guschelbauer-G’schicht’ ermittelt hat?« Bronstein war ehrlich überrascht, auf diesen alten Fall angesprochen zu werden, der sich allerdings tatsächlich auch in Simmering ereignet hatte. »Ja. Das war ich«, bekannte er.
»Da haben S’ sich echt nobel verhalten, hat man mir berichtet. Also helf’ ich Ihnen auch.« Er griff sich den freien Stuhl und setzte sich. »Was wollen S’ wissen?«