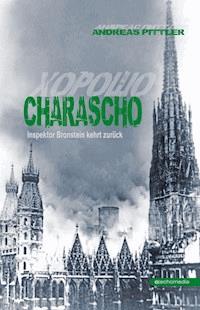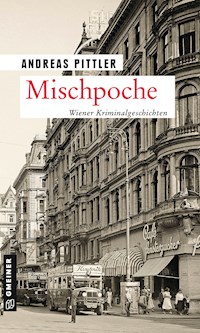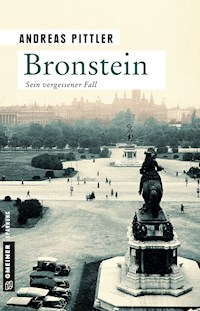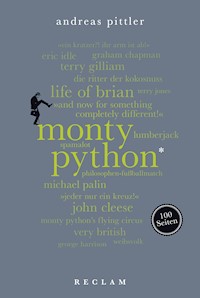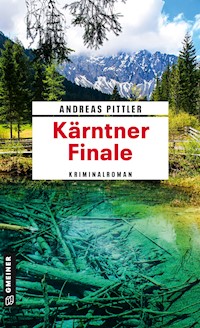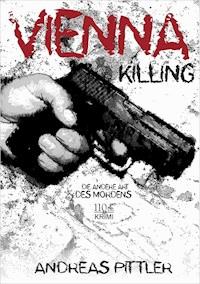9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: echomedia buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wien 1955. Ein eiskalter Jännerabend. In der Schwarzenberg-Allee liegt eine Leiche. Und der Tote ist nicht irgendwer, sondern ein hochrangiger Polizeioffizier, der im Verhältnis der alliierten Besatzungsmächte eine besondere Rolle spielte. Schnell wird klar, dass der Fall – so kurz vor dem lange erhofften Abschluss des Staatsvertrags – mehr als heikel ist. Die Exekutive will sich die Finger nicht verbrennen und untersagt dem zuständigen Beamten jedwede Ermittlung. Der aber wendet sich vertrauensvoll an den pensionierten Polizeioberst David Bronstein, dem im Ruhestand ohnehin schon viel zu langweilig war. Wie in seinen besten Tagen begibt er sich auf Mörderjagd und sticht dabei in ein wahres Wespennest aus Spionen, Schmugglern und anderen zwielichtigen Figuren. Dabei freilich erhält er von unerwarteter Seite Hilfe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Prolog
ERSTER TEIL - Winter 1955
Samstag, 29. Jänner 1955
Sonntag, 30. Jänner 1955
Montag, 31. Jänner 1955
Dienstag, 1. Februar 1955
Mittwoch, 2. Februar 1955
Donnerstag, 3. Februar 1955
Freitag, 4. Februar 1955
Montag, 7. Februar 1955
Dienstag, 8. Februar 1955
Mittwoch, 9. Februar 1955
Donnerstag, 10. Februar 1955
ZWEITER TEIL - Frühling 1955
Sonntag, 10. April 1955
Montag, 11. April 1955
Dienstag, 12. April 1955
Freitag, 15. April 1955
Montag, 9. Mai 1955
Dienstag, 10. Mai 1955
Donnerstag, 12. Mai 1955
Samstag, 14. Mai 1955
Sonntag, 15. Mai 1955
Epilog
Glossar
GOODBYE
Inspektor Bronsteins Abschied
Andreas Pittler
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Eventuelle Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Menschen und wirklichen Ereignissen sind, soweit diese nicht historisch belegt sind, rein zufällig und nicht beabsichtigt.
eISBN: 978-3-902900-92-0
E-Book-Ausgabe: 2015
2014 echomedia buchverlag ges.m.b.h.
Media Quarter Marx 3.2
A-1030 Wien, Maria-Jacobi-Gasse 1
Alle Rechte vorbehalten
Produktion: Ilse Helmreich
Layout: Brigitte Lang
Umschlagbild: „Die Unterzeichnung des Staatsvertrags“ von Robert Fuchs, 1955 (BKA), Reproduktion: Kunstdruck der Österreichischen Staatsdruckerei, 1957, Druckdaten: ÖNB/Wien PLA16550248
Lektorat: Thomas Hazdra
E-Book-Produktion: Drusala, s.r.o., Frýdek-Místek
Besuchen Sie uns im Internet
www.echomedia-buch.at
Prolog
So oft schon habe ich in den Lauf einer Waffe geblickt. Damals im Februar zum Beispiel. Als ich mit einem unbrauchbaren Mannlicher gegen die MG-Nester des Bundesheeres kämpfte. Oder drei Jahre danach, in den heißen Ebenen Kastiliens. Und fast jeden Tag zwischen 41 und 45. Da wurde die tödliche Bedrohung eine derartige Routine, dass man sich beinahe daran gewöhnte. Ja, man stumpft irgendwie sogar ab dabei. Viele meiner Mitgefangenen sagten mir später, sie hätten die Angst verloren, es sei ihnen egal geworden, ob sie lebten oder starben.
Nun, ich kann das eigentlich nicht sagen. Weil ich immer davon überzeugt war, mir würde nichts passieren. Mir nicht. Selbst als mich in Spanien diese Kugel traf, wusste ich, während ich rücklings nach hinten fiel, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte. Eine Verwundung, mehr nicht. Ein paar Wochen im Lazarett, und dann wäre ich wieder auf dem Damm. Ich war immer davon überzeugt, dass ich im Bett sterben würde. Irgendwann einmal, wenn ich uralt sein und mein ganzen Leben gelebt haben würde. Und manches Mal beschlich mich der Gedanke, ich könnte tatsächlich unsterblich sein.
Aber ehrlich: Wer würde das nicht glauben, wenn er so oft davongekommen, so oft dem Tod von der Schaufel gesprungen ist. Ich habe hunderte Kameraden sterben gesehen, links und rechts von mir niedergemäht von Maschinengewehren, Granaten und Fliegerbomben. Ich kann die Häftlinge nicht zählen, die vor meinen Augen verreckt sind, gestorben an Unterernährung, an Erschöpfung, an den verschiedensten Krankheiten, vor allem aber am Sadismus der SS-Männer, die uns bis auf den Tod quälten. Einfach so. Weil ihnen langweilig war. Mehr als einmal schien es, als käme die Reihe nun an mich, doch ich fürchtete mich nicht. Ich war so überzeugt davon, dass noch große Aufgaben auf mich warteten, dass es auch an mir sein würde, nach all diesem Wahnsinn eine neue Gesellschaft aufzubauen, dass es mir gar nicht in den Sinn kam, ich könnte in diesem trostlosen Dachau mein Leben verlieren.
Und so war es ja auch. Ich erlebte unsere Befreiung, ich half mit, die Welt ein klein wenig gerechter zu machen. Jeden Tag, jede Stunde. Der Faschismus war auf dem Misthaufen der Geschichte gelandet, was sollte mir also noch passieren. Wenn ich all diesen Horror überstanden hatte, dann hatte ich es verdient, in ferner Zukunft als Greis auf einer Bank zu sitzen und die Tauben zu füttern. Ich hatte mein Leben nicht verloren, also hatte ich eine Welt zu gewinnen.
Das hier, das war nicht vorgesehen. Das war auch ganz und gar nicht vorherzusehen. Ja, selbst jetzt, in diesem Moment, bin ich eigentlich noch felsenfest davon überzeugt, eigentlich zu träumen. Ich bin gar nicht hier, ich liege in meinem Bett und werde einfach nur von den Schatten meines Unterbewusstseins gequält. Bald, sehr bald schon, werde ich endlich erwachen. Ich werde mich schütteln, werde aufatmen und in meine Küche gehen, um mir einen Kaffee zu machen. Und dann wird all das nichts mehr sein als eine ferne Erinnerung. Wie der Februar, wie der Ebro, wie das KZ.
Doch merkwürdig. Dieser Alptraum, er endet nicht. Aber ich ängstige mich nicht, denn ich weiß, man träumt seinen eigenen Tod nicht. Irgend so ein Selbstschutzmechanismus ist dafür verantwortlich. Ehe man stirbt, erwacht man, egal, wie realistisch der jeweilige Nachtmahr auch immer wirkt. Wenn ich doch endlich, endlich aufwachen könnte!
Realistisch. Das ist das Wort. Das hier ist einfach zu wahr, um nicht die Wirklichkeit sein zu können. Ich höre die Stimmen, ich sehe die Männer, ich erblicke den kalten Stahl in ihren Händen. Und ich weiß, was sie mit mir vorhaben. All das ist mir nur zu bekannt. Doch dieses Mal ist es anders. Dieses Mal halte ich mich nicht für unverwundbar. Und sosehr ich mich auch bemühe, diese unerbittliche Erkenntnis aus meinem Gehirn zu verbannen, dieses Mal werde ich sterben.
Die ganze Szenerie hat etwas Seltsames. Mir ist, als existierte ich zweifach. Ich gehe neben mir her und beobachte mich. Interessiert, aber teilnahmslos. Ich sehe, wie ich aus dem Wagen steige, wie ich in den Himmel blicke. Diese traurigen, kahlen Bäume, die in das unendliche Grau des Firmaments ragen. Ich weiß, ich wünschte mir, ich sähe sattes, grünes Laub, das sich vom strahlenden Blau des Himmels abhebt. Doch da ist nichts. Kein Farbtupfer, kein Hoffnungsschimmer, nur stahlgraue Trostlosigkeit. Und während ich mir denke, dass mir eben diese Gedanken durch den Kopf gehen, ist mir, als vereinten sich gegen meinen Willen die zwei Existenzen wieder zu einer. Ich bin es, der sich all das denkt. Ich bin es, der vom Grau über mir in das Grau vor mir blickt. Und mit einem Mal weiß ich, dass ich nicht träume, dass ich nicht fantasiere. All das ist Wirklichkeit. Ich sehe die Waffe vor mir, und ich weiß, diesmal werde ich ihr nicht entrinnen.
So sinnlos. Da hat man dem Tod zigfach ins Auge geblickt, und dann endet alles auf diese unnötige Weise! Nicht, dass …
ERSTER TEIL - Winter 1955
Samstag, 29. Jänner 1955
Es war kurz vor 18 Uhr abends, als Gruppeninspektor Alois Zedlnitzky ein Anruf aus seinem bislang beschaulichen Wochenenddienst riss. Automatisch hob er ab und meldete sich.
„Was sagen S’? In der Schwarzenbergallee haben S’ eine Leich’ g’funden? Was S’ net sagen!“ Zedlnitzky verdrehte die Augen. Das konnte nichts Gutes bedeuten. Bei der Eiseskälte an die Peripherie zu müssen, war eine alles andere als einladende Perspektive. „Erschossen, sagen S’? Woher wollen S’ denn das wissen? … Aha, die Waffe liegt neben der Leiche, und die Leich’ hat ein Loch.“ Zedlnitzky seufzte. „Na gut, wir kommen. Greifen S’ nix an, gelt. Wir sind unterwegs.“
Zedlnitzky hängte den Hörer wieder in die Gabel und rief nach Pirkner und Habermann, die gleich ihm Journaldienst hatten. „Hans, du bleibst da und hältst die Stellung. Toni, du kommst mit.“ Habermann folgte ihm auf dem Fuß, und die beiden eilten die Treppen abwärts zu ihrem Einsatzwagen. „Du fahrst“, knurrte Zedlnitzky nur und klemmte sich in den Beifahrersitz. Habermann lenkte das Auto mühsam aus der Garage und bog dann rechts und gleich darauf nach links ab, um sich in der Kolingasse auf die Währinger Straße zuzubewegen. Um die Uhrzeit war der Verkehr mehr als überschaubar, und so kamen sie in wenigen Minuten an den Gürtel. Sie visierten die Jörgerstraße an und fuhren von dort nur noch stur geradeaus, bis sie in der Ferne den Wienerwald erblickten.
„Hat der Anrufer g’sagt, wo die Leich’ genau liegt?“, fragte Habermann. Zedlnitzky zuckte nur mit den Schultern.
„Hat er nicht. Aber so lang is die Allee ja ned, des werma scho finden.“ Direkt an der Querstraße hielt Habermann den Wagen an, und Zedlnitzky kletterte aus dem Fond. Er blickte Richtung Hameau und sah auch schon einen bulligen Mann heftig winken. „Dort wird’s sein, nehm ich einmal an“, statuierte er und unterstrich seine Worte mit einem ausgestreckten Zeigefinger.
Die beiden Polizisten setzten sich in Bewegung und hatten nach wenigen Schritten den Fundort der Leiche erreicht. Zedlnitzky wollte eben seine erste Frage an den Finder der Leiche stellen, als er abrupt innehielt. „Na servas“, entfuhr es ihm.
Habermann sah ihn irritiert an.
Zedlnitzky nickte nur nach unten auf den Toten. „Der Seiser. Na des hamma braucht.“
Habermann schien nicht zu wissen, wer Seiser war, und so setzte er zu einer entsprechenden Frage an, doch Zedlnitzky gebot ihm mit erhobener Hand Einhalt. „Des erklär i da später. Jetzt einmal zu Ihnen, Herr …“
„Domaschl. Wilhelm Domaschl. Ja, ich hab ihn g’funden. Vor etwa einer halben Stund. Ich bin gleich runterg’fahren zur Resi-Tant’, weil die hat ein Telefon. Dort hab ich’s g’meldet. Und dann bin ich wieder her.“
„Aha. Und was haben S’ da überhaupt zum Tun g’habt? Um die Zeit, mein ich?“, fragte Zedlnitzky, der sich die Nachfrage nach der Resi-Tant’ ersparte, da er sich sicher war, dass Domaschl nicht eine Verwandte, sondern das so heißende Heurigenlokal in Neuwaldegg meinte.
„Streu’n“, brachte Domaschl heraus. „Den Weg da. Is ja kalt, ned? Da g’friert ja alles. Daher tun mir streu’n.“
Das leuchtete Zedlnitzky ein. „Gut, Sie sind also mit Ihrem LKW da entlang gefahren und …?“
„Na nix und. I bin grad von der Höhenstraßen da einbogen, wia i a scho siech, dass da was liegt. Z’erst hob i ma no denkt, des is a B’soffener, und ma g’sagt, hoffentlich is der ned dafror’n, weu des gibt nur Scherereien, aber dann hab i g’seh’n, dass da no was liegt, na, und dann hab i eh scho ollas g’wusst.“
Zedlnitzky signalisierte durch eine einschlägige Kopfbewegung, dass er verstanden hatte. Er drehte sich zu der Leiche und ging, um sie besser in Augenschein nehmen zu können, in die Knie. Ein glatter Herzschuss. Offenbar aus nächster Nähe abgefeuert, denn das Hemd des Toten wies Schmauchspuren auf, wie Zedlnitzky bei genauerem Hinsehen erkannte. Er blickte sich um. Wenn Seiser wirklich Selbstmord begangen hatte, dann musste die Patronenhülse irgendwo im unmittelbaren Umkreis zu liegen gekommen sein. Doch er konnte sie nirgendwo entdecken. Als er schon aufgeben wollte, sah er am Rand des Weges etwas aufblitzen. Zedlnitzky stand auf und ging zur entsprechenden Stelle. Tatsächlich. Da lag sie. Etwa zwei bis drei Meter von der Waffe entfernt.
Nun, es war schon möglich, dass eine Beretta die Hülse so weit auswarf, wenn sie nur hoch genug abgefeuert wurde. Die Geschossummantelung knallte dann auf den Boden und rollte noch ein Stück. Allerdings, so befand Zedlnitzky, lag sie auf der falschen Seite, denn sie befand sich rechts von Seiser. Wenn der seinen Mantel und seinen Rock geöffnet hatte, um dann die Pistole an seinem Herzen anzusetzen, dann hätte die Kugel konsequenterweise nach links ausgeworfen werden müssen. Und der Weg hier war eben wie ein Brett. Keine Chance also, dass sie von links nach rechts hätte kullern können.
Gut, es war natürlich auch möglich, dass Seiser Linkshänder gewesen war. Dann wäre die Hülse tatsächlich nach rechts geflogen. Doch in diesem Fall müsste die Beretta links von Seiser gelandet sein. Die lag aber auch rechts von ihm. Zedlnitzky kratzte sich am Kinn. Er sah auf die Patronenhülse, dann auf die Waffe und schließlich wieder auf die Leiche. Irgendetwas, so fand er, passte hier nicht. Er vermochte nur nicht zu sagen, was.
Die anderen beiden schienen auf eine Reaktion von ihm zu warten.
„Aufg’fallen is Ihnen da ja sonst nix? Ich mein’, irgendwer, der weggrennt is, oder a anderes Auto oder so?“, wandte er sich daher wieder an Domaschl.
„Na, überhaupt ned. Alles war ganz ruhig und friedlich. Eh kloa, i maan, wer verirrt si um die Zeit doher, ned? Der muass jo an echten Klescher hom!“
Zedlnitzky vermochte nicht zu sagen, was an dieser Feststellung falsch sein sollte. Die Frage, die sich daran knüpfte, war nun, ob Seiser zu Fuß hierhergekommen, ob er allein oder in Begleitung gewesen war.
Sicherlich, die gesamte Szenerie drängte eine Antwort förmlich auf: Selbstmord. Immerhin lag die Leiche mitten auf dem Gehweg, und keinen Meter von ihr entfernt befand sich eine Waffe, aus der, daran hegte Zedlnitzky keinen Zweifel, der tödliche Schuss abgegeben worden war. Dementsprechend war Seiser wohl hierhergekommen, hatte geseufzt, der Welt ade gesagt und sich die Kugel in den Körper gejagt. Wäre es anders gewesen, dann läge an dieser Stelle nur seine Leiche, nicht aber auch das Tatwerkzeug. Allerdings mochte es auch denkbar sein, dass Seiser einer spontanen Auseinandersetzung zum Opfer gefallen war, kam es Zedlnitzky in den Sinn. Dieser Version zufolge war Seiser mit einer Begleitung durch die Allee spaziert und aus irgendeinem Grund mit dieser in Streit geraten. Ein Wort gab das andere, plötzlich zog einer der beiden die Pistole. Der entscheidende Schuss fällt, und die andere Person gerät darob so in Panik, dass sie einfach davonläuft und ganz auf die Waffe vergisst. Wenn auch die Selbstmordversion wesentlich wahrscheinlicher klang, so durfte man auch diese Variante nicht gänzlich außer Acht lassen.
„Herr Inspektor? Hallo?“
Zedlnitzky blickte auf. Ihm wurde bewusst, dass ihn die anderen beiden immer noch anstarrten. Kein Wunder. Er war seinen Gedanken nachgehangen und hatte auf seine Umgebung völlig vergessen. Etwas verlegen räusperte er sich. „Tschuldigung. Was haben S’ g’sagt?“
„Ob S’ mich noch brauchen, Herr Inspektor, hab ich g’fragt.“
„Ehrlich g’sagt, ja. Wir müssen unsere Kollegen informieren, daher brauch ma da wen, der noch ein bisserl aufpasst. Aber in zehn Minuten simma eh wieder da. Da können S’ dann gehen.“
Domaschl machte ein schnaubendes Geräusch. Es war ihm anzusehen, dass er nicht gerade begeistert war. Zedlnitzky fischte reflexartig seine Zigaretten aus der Brusttasche. „Wollen S’ eine? Zur Überbrückung quasi.“
Domaschl sah die Marke und verzog sein Gesicht. „Na, danke. I hob meine eigenen.“ Eine Packung „Chesterfield“ kam zum Vorschein. Zedlnitzky zog instinktiv die Augenbrauen zusammen. „Ned, wos Sie jetzt denken“, wehrte Domaschl ab, „die san ned vom Schleich …“, stotterte er. Woher sonst?, dachte sich Zedlnitzky, doch verzichtete erdarauf, die Thematik zu vertiefen. Sie hatten wahrlich andere Probleme als illegal erworbene Rauchwaren.
„Alsdern, Herr Domaschl. Rühren S’ auch weiter nix an und passen S’ auf, dass keiner kommt oder was verändert wird. Wir sind so schnell wie möglich wieder da.“
Zedlnitzky drehte ab und war froh, dass Domaschl nicht die naheliegendste aller Fragen gestellt hatte. Warum nicht einer von ihnen den Anruf tätigte, während der andere den Tatort beaufsichtigte. Dann nämlich hätte Zedlnitzky indirekt zugeben müssen, dass er keinen Führerschein besaß, ein Umstand, der ihm immer noch peinlich war. Und dass er zurückgeblieben wäre, während Habermann den Anruf tätigte, das hätte seine Befehlskompetenz in Frage gestellt. Wie man es also auch drehte und wendete, es war ein Glück, dass Domaschl offensichtlich kein Blitzgneißer war.
Auf dem Weg zurück zum Streifenwagen entging Zedlnitzky natürlich nicht Habermanns gespannte Miene. Es war offenkundig, dass dieser endlich wissen wollte, wer nun der Tote war. Doch Zedlnitzky genoss seinen Wissensvorsprung und beschloss, sich mit der Aufklärung des Kollegen Zeit zu lassen. Scheinbar in Gedanken versunken strebte er dem Auto zu, dabei Habermann im Augenwinkel beobachtend.
Dieser hielt die Spannung erwartungsgemäß nicht mehr aus, und kaum dass er sie außer Hörweite von Domaschl wusste, platzte es aus ihm heraus: „Wer is des jetzt, der Seiser? A Strizzi?“
Zedlnitzky reagierte mit einem grinsenden Nicken. Dann drehte er den Kopf in die Richtung des Kollegen: „Ja. Des is nämlich ana von uns.“
Habermann blieb der Mund offen: „A Kollege?“
Abermaliges Nicken Zedlnitzkys.
„Und da bleibst du so ruhig und gelassen? Da müss’ ma doch sofort …“
Zedlnitzky hob die Hand. „Gar nix müss ma. Der Seiser is eine … eine Cause célèbre.“
Habermann kam einfach nicht dazu, seinen Mund dauerhaft zu schließen. „A wos is der? A Kos Sele … sog, Loisl, wüst mi pflanzen?“
„Mitnichten, lieber Freund. Was ich dir zu verstehen geben will, ist, dass der Seiser bis vor Kurzem der Gottsöberste in Favoriten war. Volle Rückendeckung von den Sowjets. Deren Mann, verstehst du? Und vor zwei Jahren hat es einen ziemlichen Skandal um ihn gegeben, Spionage und so. Das hat ihm nicht gerade genützt. Na, und jetzt, siehst eh selber.“ Sie waren beim Wagen angekommen.
„Für uns is des jedenfalls eine Nummer zu groß. Des is ein Fall für die Staatspolizei.“
„Das heißt, wir holen den Peterlunger …?“
„Wir benachrichtigen den Peterlunger“, verbesserte Zedlnitzky. „Soll der sich um das alles hier kümmern.“ Er hieß Habermann, den Wagen zu wenden, und so fuhren sie die Neuwaldegger Straße wieder stadteinwärts, bis sie besagtes Heurigenlokal erreichten. „Bleib stehen und wart da auf mich.“ Ohne eine Frage Habermanns abzuwarten, stieg Zedlnitzky aus und verschwand in der „Resi Tant’“.
„Tag“, sagte er gedehnt, als er die Budel erreicht hatte. „Sie ham a Telefon.“
Der Mann hinter der Schank nickte. „Des kostet aber an Schilling“, ergänzte er verbal, während er Zedlnitzky den Apparat zeigte, der an der Wand montiert war.
„Für mi ned“, replizierte der Inspektor, indem er seine Kokarde hochhielt.
Nachdem sich das Fräulein vom Amt gemeldet hatte,gab Zedlnitzky seinen gewünschten Gesprächspartner an. Es knackste ein paar Mal in der Leitung, dann hörte Zedlnitzky eine Frauenstimme. „Begrüße Sie, Gnädigste. Ist der Herr Gemahl zugegen?“, übte er sich in Unterwürfigkeit. „Es wäre dienstlich.“ Gleich danach vernahm er ein „Ossie, für dich. Dienstlich, heißt’s“, ehe eine grollende Stimme „Na geh, jetzt, wo ich grad beim Essen bin“ replizierte. Diese wurde nur einen Augenblick später spürbar lauter. „Wehe, wenn des ned wichtig ist. Endlich einmal einen Schweinsbraten, und dann kommen Sie daher! Also was is?“
Zedlnitzky musste sich eingestehen, dass Peterlungers Unmut einschüchternd wirkte. „Verzeihen Sie die Störung, Herr Doktor. Aber wir haben einen Toten in Hernals, der, wie soll ich sagen, ein wenig heikel ist.“
„Heikel? Drücken Sie sich gefälligst deutlicher aus. Mein Bratl wird kalt!“
„Der Seiser. Sie wissen schon, der aus Favoriten. Der liegt tot in der Schwarzenbergallee. Mit einer Kugel im Leib. Und da hab ich mir gedacht …“
„Der Kommunist?“, polterte Peterlunger, „hinich? Und des bei die Amis?“
„Genau, Herr Doktor. Das hab ich mir eben auch gedacht.“
Sogar durch das Telefon war zu bemerken, dass Peterlunger mit sich rang. Einerseits war er immer noch wütend, dass er beim Essen gestört worden war, andererseits musste er dem Beamten Respekt zollen, dass dieser mitgedacht und gleich den Chef der Staatspolizei kontaktiert hatte, ehe der Fall vielleicht in eine Richtung abdriftete, die den Interessen des Staates möglicherweise zuwiderlief.
Peterlunger schmatzte kurz in die Leitung, dann modulierte er seine Stimme zu einem moderateren Ton. „Gut. Sie haben richtig gehandelt. Ich veranlasse alles Weitere. Schwarzenbergallee, sagen Sie?“ Zedlnitzky bestätigte. „Gut. Bleiben S’ dort, bis wir da sind, haben Sie das verstanden?“ Zedlnitzky bejahte. Ohne weiteren Gruß trennte Peterlunger die Verbindung.
Zedlnitzky stand noch einen Augenblick ratlos vor dem Apparat, dann dankte er dem Wirten und begab sich mit einem müden „Habe d’ Ehre“ wieder zu Habermann.
Typisch, dachte er. So ein Großkopferter wie der Chef derStapo, der konnte sich natürlich auch an einem Samstag einen Braten leisten. Für ihn gab es den allerhöchstens am Sonntag, und auch das war mehr als unsicher. Zwar war die Rationierung seit geraumer Zeit endgültig Geschichte, aber die Preise standen in keiner vernünftigen Relation zu den Gehältern. Und das schon seit einer Ewigkeit. Unwillkürlich musste Zedlnitzky an die Lohn-Preis-Abkommen denken, die nicht nur einmal für Unmut gesorgt hatten. Vor einigen Jahren hatten die Arbeiter sogar in Massen gegen diese Ungerechtigkeit demonstriert, aber die Sozis hatten ihnen erklärt, das Abkommen sei schon in Ordnung, und es seien nur die Kommunisten, welche die Arbeiter dazu missbrauchen wollten, aus Österreich eine weitere Volksrepublik zu machen. Dabei waren es gar nicht die Leute von der KPÖ gewesen, die den Streik entfacht hatten, sondern die vom VdU, einer obskuren Versammlung weltfremder Liberaler und ehemaliger Nazis. Aber darüber, so befand Zedlnitzky, dachte er besser gar nicht nach. Ein Bratl! Das wäre was, bilanzierte er das Gespräch noch einmal, als er den Einsatzwagen endlich erreicht hatte.
Er öffnete den Verschlag und ließ sich in den Sitz fallen. „Alsdern, z’ruck mit uns.“ Keine fünf Minuten später befanden sie sich wieder in der Allee, wo ihnen ein „Is ja auch Zeit worden“ aus Domaschls Mund entgegenschlug. „Kann ich jetzt endlich geh’n? I bin schon halbert erfroren!“
Zedlnitzky entließ den Mann, der sich daraufhin zum Gehen wandte. „Einen Moment noch“, rief ihm der Inspektor nach. „Wo erreichen wir Sie, wenn wir noch etwas von Ihnen brauchen?“
Domaschl drehte sich gar nicht mehr um und rief stattdessen nur noch über die Schulter: „Na bei de 48er …“ Zedlnitzky genügte die Antwort. Nun, so fand er, konnte auch er sich eine Zigarette genehmigen. Und wohl auch noch eine zweite, denn wie er den Chef der Staatspolizei einschätzte, würde dem die Wahl zwischen Schweinsbraten und Pflichterfüllung nicht schwer fallen. Genauso gut hätten sie zu Fuß in die Allee schlendern können, denn so bald würde Peterlunger nicht an Ort und Stelle erscheinen.
Er verspürte keine Lust, mit Habermann ein Gespräch zu führen, und so wandte er sich, während er einen weiteren Zug aus seiner Zigarette nahm, von seinem Kollegen ab. Er ging ein paar Schritte Richtung Hameau und hing dabei seinen Gedanken nach. Ihm ging der Schweinsbraten nach wie vor nicht aus dem Kopf. Gott allein wusste, wann er sich so etwas wieder würde leisten können. Jetzt schon überhaupt. Anna war im fünften Monat schwanger, da musste man jeden Groschen zweimal umdrehen, ehe man ihn ausgeben durfte. Die Miete in der Hasengasse war zwar halbwegs erschwinglich, doch mit seinem Gehalt konnte man trotzdem keine großen Sprünge machen. Und das Kabinett mussten sie auch noch herrichten. Gut, das konnte warten, denn zunächst würde das Kleine ohnehin bei ihnen im Schlafzimmer sein. Aber der Traum von einer größeren Wohnung mit eigenem Klo und Bad, der war vorerst ausgeträumt. Und Urlaub konnte er sich auf Sicht auch abschminken. Der würde auch weiterhin tageweise im Böhmischen Prater stattfinden. Und statt Schinken gab es wie bisher bestenfalls Braunschweiger. Und …, ach was, am besten, er hörte mit dem Denken auf, sonst wurde er noch schwermütig.
„So a Schas!“, fluchte er, als er Habermann wieder erreicht hatte, „der Mistkübler hat echt recht g’habt. An Zapf’n hat’s da, des is ma nimma wurscht. Wenn ma wenigstens an Flachmann mithätten. Aber so!“ Er schüttelte sich demonstrativ.
Habermann aber gab sich gelassen: „A wos, es kann sich ja nur mehr um Stunden handeln.“
Sein Vorgesetzter schickte ihm einen wütenden Blick: „Sehr witzig, Toni!“
Der beschwichtigte seinen Chef: „Reg dich nicht auf, Loisl. Seinerzeit vor Stalingrad. Dort war’s kalt.“
„Trottel. Als ob du dabeig’wesen wärst!“
„Des ned. Aber der Heschel. Der hat ma des derzählt. Der war dabei. Is grod no außekommen. Mit dem letzten Flug.“
Unwillkürlich musste Zedlnitzky schmunzeln. Der alte versoffene Heschel war allgemein als erbärmlicher Aufschneider bekannt. Ein ehemaliger Nazi, der durch die Partie um den Innenminister in der Polizei gehalten wurde, obwohl er die schlechteste Personalakte von allen Aktiven aufwies. Niemand, der länger als ein paar Wochen bei der Exekutive war, nahm diesen Wurschtl ernst, weshalb er sich stets an die Frischg’fangten heranmachte, die er mit seinen Münchhausen-Geschichten zu beeindrucken hoffte.
„Weißt was“, sagte Zedlnitzky daher, „der Heschel is ein besonderer Trottel. Der war wahrscheinlich nicht einmal im Krieg, sondern ein Goldfasan und Hinterlandstachinierer. Deralte Pfeifenstierer hat sicher z’erst groß auf Blockwart g’macht und im 45er Jahr ganz schnell sei patriotisch-demokratisches Herz entdeckt. Hör mir auf mit dem Blaser, sonst wird ma schlecht a no.“
Habermanns Kiefer mahlten merklich, doch noch ehe er in die Lage versetzt war, eine passende Antwort zu geben, tauchte am Ende der Allee ein schwerer, dunkler Wagen auf. Zedlnitzky hob die Hand: „Schau, sie kommen.“
Tatsächlich stiegen nur eine knappe Minute später vier Männer aus dem Wagen, die Zedlnitzky nicht alle namentlich bekannt waren. Es konnte jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass jeder von ihnen von seiner jeweiligen Wichtigkeit zutiefst überzeugt war. Der Gruß aus den Mündern von Zedlnitzky und Habermann blieb unerwidert. Peterlunger trat auf die Leiche zu, besah sie sich, nickte dann und meinte in die Richtung seiner Begleitung: „Kein Zweifel, das ist der Seiser. Meine Herren, jetzt heißt’s aufpassen.“
Die drei anderen Beamten nahmen gleichsam Haltung an, während Peterlunger so tat, als würde er jetzt erst der Präsenz von Zedlnitzky und Habermann gewahr: „Für euch zwei“, statuierte er, „ist die G’schicht’ erledigt. Von da an übernimmt die Staatspolizei. Wiederschau’n.“
Zedlnitzky überlegte, ob er noch irgendetwas erwidern oder anmerken konnte, doch Peterlunger hatte sich schon wieder abgewandt. Nach einem kurzen Blickkontakt mit Habermann entschied sich Zedlnitzky, das Feld ohne weiteres Wort zu räumen. Die beiden hatten sich schon ein paar Meter entfernt, als ihnen einer von Peterlungers Begleitern nachrief: „Strengste Geheimhaltung versteht sich von selbst. Kein Wort zu niemandem.“ Zedlnitzky und Habermann nickten nur, dann verließen sie endgültig die Szene.
Als sie wieder in ihrem Wagen Platz genommen hatten, wandte sich Habermann, während er das Auto wendete, an seinen Vorgesetzten: „Übertreiben die ned ein bisserl?“ Zedlnitzky zuckte mit den Schultern: „Ein kommunistischer Kieberer aus dem russischen Sektor im amerikanischen Sektor. Ich weiß nicht, das kann schon zu Gerüchten führen. Und wer weiß, vielleicht sogar zu politischen Verwicklungen. Ich denke, der Peterlunger weiß schon, was er tut.“
Tatsächlich befand sich Österreich fast zehn Jahre nach Ende des Krieges in einer heiklen politischen Lage. Seit dem Tod des Generalissimus Stalin signalisierte die Sowjetunion Kompromissbereitschaft, sodass die österreichische Politik eine Chance sah, endlich die vierfache Besetzung des Landes zu überwinden. Vor allem Bundespräsident Körner und der junge Staatssekretär Kreisky wurden nicht müde, Österreich als dauerhaft neutralen Staat nach dem Vorbild der Schweiz anzupreisen, was beide Blöcke saturieren mochte. Dennoch beäugten einander Amerikaner und Russen ungebrochen skeptisch, sodass der kleinste Zwischenfall das mühsam aufgebaute Vertrauen gleich wieder zerstören mochte.
Zedlnitzky sah auf die Uhr. „Weißt was, unser Dienst ist fast um. Schau’n wir, dass wir den Hansl irgendwie erreichen, dann sagen wir ihm, dass wir gleich direkt heimfahren.“ Habermann fand die Idee großartig, und so telefonierten sie Pirkner unterwegs kurz an, um sodann den Heimweg anzutreten. Habermann erklärte sich bereit, Zedlnitzky in der Hasengasse abzusetzen, ehe er selbst mit dem Wagen in sein heimatliches Margareten fahren würde.
Vor seinem Wohnhaus angekommen, hielt Zedlnitzky noch einen Moment inne. „Natürlich“, begann er vorsichtig, „sagen wir vorerst nix. Aber wir sollten die G’schicht im Aug behalten. Wer weiß, was diese Politikaster sonst machen.“
Habermann sah ihn fragend an.
„Ehrlich, Toni, ich glaub nicht, dass das ein Selbstmord war. Und ich würd nicht wollen, dass ein Kollege, und wenn er hundertmal ein Kommunist war, umbracht wird, ohne dass wir die Sache aufklären. Und so gesehen tät es nicht schaden, wenn wir, sagen wir, aufmerksam bleiben.“
Habermann nickte: „Hast recht, Loisl. Aber jetzt schau’n wir einmal, was die Elitetruppe aus der ganzen Sache macht.“ Damit war alles gesagt, und Zedlnitzky wünschte Habermann noch einen schönen Sonntag, ehe er im Inneren seines Hauses verschwand. Im Stiegenhaus kam ihm der cholerische Elektriker entgegen, der offenbar auf dem Weg zum wöchentlichen Wettbewerb in seinem Stemmerverein war, und wie üblich kam von ihm als Antwort auf Zedlnitzkys Gruß nur ein unwirsches Grunzen. Zedlnitzky kümmerte sich nicht weiter darum und sah zu, dass er endlich zu seiner Anna kam. Er öffnete die Wohnungstür und ging durch das kleine Vorzimmer in den Wohnraum, an dessen Ende sich die Kochzeile befand. Dort stand Anna und rührte in einem Topf. „Aber Annerl“, sagte er zärtlich, während er sie in den Nacken küsste, „du sollst dich doch in deinem Zustand ned so anstrengen.“
Anna lachte nur. „Erstens sind’s noch über drei Monate, bis es so weit ist, und zweitens wärst du der Erste, der protestieren tät, wenn ich statt ein Abendessen auf Schonung machen tät.“ Zedlnitzky grinste: „Ja eh. Aber g’sagt hat’s g’hört.“ Anna griff nach dem Geschirrtuch und machte Anstalten, es wütend in Zedlnitzkys Richtung zu werfen. Doch ihr Lächeln verriet sie. Zedlnitzky meinte dennoch, seine freche Bemerkung kompensieren zu müssen, und so schlug er vor, in der Zwischenzeit den Tisch zu decken.
Eine gute Stunde später saßen beide satt und zufrieden am Tisch. Zedlnitzky war in sein Bären-Buch vertieft, ein Bandaus einer billigen Romanreihe, in der vor allem Krimis vertrieben wurden, während Anna eifrig weiter an ihrem Strampelhöschen häkelte. Im Hintergrund säuselte klassische Musik, mit welcher die Radio Verkehrs-AG ihr Abendprogramm bestritt. Zwar überlegte Zedlnitzky kurz, ob er am Apparat herumdrehen und herausfinden sollte, was bei der Konkurrenz, dem Sender „Rot-Weiß-Rot“, geboten wurde, doch irgendwie, so fand er, hatte die getragene Melodie der Symphonie etwas Beruhigendes. Tatsächlich erklärte Anna bald, sie sei müde, und nach einem Blick auf die Uhr befand auch Zedlnitzky, dass es nichts schaden konnte, ins Bett zu gehen. Kurz dachte er noch an Seiser und fragte sich, wieso der arme Mann zu Tode gekommen war, doch noch ehe er über eine Antwort nachsinnen konnte, war er auch schon eingeschlafen.
Sonntag, 30. Jänner 1955
„Jössas! Jetzt hätt ich fast den Sittich vergessen!“
Bronstein dämpfte schnell und nachlässig die „Dreier“ in seinem tönernen Aschenbecher aus, die daher noch leicht nachglühte. Er achtete jedoch nicht auf die dünne Rauchfahne, die immer noch aufstieg, sondern schlurfte, so flink er es vermochte, von der Küche ins Wohnzimmer, wo er keuchend ankam.
Er atmete tief durch, unterdrückte den dadurch entstehenden Hustenreiz und hob dann vorsichtig die dunkle Decke vom Käfig ab. Tatsächlich sah ihn der grüne Wellensittich mit seinem gelben Kopf neugierig an und entschied sich nach kurzem Zögern zu einem vorwurfsvoll klingenden Zwitschern. „Ja“, nickte Bronstein, „gell, garstig ist er, der alte Bronstein! Da ist es schon fast Mittag, und er kümmert sich gar nicht um den Burli. So was, da darf man schon meckern, gell.“
Burli schien exakt dieser Ansicht zu sein, denn er gab eine schrille Lautfolge von sich und plusterte seine Federn, ehe er sich schüttelte. Bronstein achtete weiter nicht darauf, sondern kontrollierte, ob sich im Wasserbehälter noch genügend Flüssigkeit befand. Dann öffnete er die Lade der Kommode, auf welcher sich der Käfig befand, und entnahm ihr zwei astähnliche Futterstangen, die er von oben in den Käfig einführte. Sofort vergaß Burli seinen Groll und machte sich gierig über die Nahrung her, Bronstein weiter keines Blickes mehr würdigend. Dieser seufzte nur, streckte sodann seinen Rücken durch, was einen ächzenden Laut in ihm evozierte, ehe er seinen Oberkörper in sich zusammensacken ließ. „Ja, ja, Burli. Iss du nur! Hast eh recht. Viel anderes haben wir zwei ned zum Tun, gell.“ Bronstein wartete noch eine kleine Weile auf eine Reaktion des Vogels, doch da diese unterblieb, schlurfte er langsam wieder zurück in die Küche, wo ihm merkwürdig brandiger Geruch in die Nase stach. Er sah sich um und erkannte, dass die nur halb ausgedämpfte Zigarette neu aufgeflammt und vom Rand des Aschenbechers gefallen war, Sie lag nun auf dem Tisch und brannte langsam, aber unerbittlich ein Loch in das Plastiktischtuch. Eilig nahm Bronstein den Glimmstängel auf und besah sich den Schaden. „Na ja, ned so schlimm“, bilanzierte er.
Seufzend warf er einen Blick aus dem Fenster. Das würde kein schöner Tag werden. Allein die Perspektive, am Abend ins Theater zu gehen, hielt Bronstein aufrecht. Und als ein leichter Sonnenstrahl seine Gardinen streifte, da riskierte er es, das Fenster zu öffnen. Kalte Winterluft schlug ihm ins Gesicht, und instinktiv fröstelte ihn. Wenigstens würde er nicht wie die alte Woprschalek von gegenüber den ganzen Vormittag über auf dem Fensterpolster lehnen und das Geschehen auf der Straße wie einen Kinofilm mitverfolgen, dachte er sich, während er automatisch nach rechts zur Oper sah. An der Ecke stand ein Jeep mit dem weißen Stern der Amerikaner darauf. Im Wagen saßen die berühmten vier – ein Yankee, ein Iwan, ein Tommy und ein Franzmann –, und sie sahen alles andere als glücklich aus. Kein Wunder bei diesen Temperaturen. Bronstein schloss das Fenster wieder und ging zu seinem Tisch, wo er nach einer „C“ griff, die er sich mit einem Streichholz anzündete. Unmittelbar nachdem er den Rauch eingesaugt hatte, unterdrückte er den spontan auftretenden Hustenreiz. Die „Austria C“ waren mit nichts aus der guten alten Zeit zu vergleichen, egal, ob es nun „Sport“, „Donau“ oder „Egyptische Sorte“ gewesen waren. Die „C“, so fand er, bestanden wohl weit eher aus Holz- und Sägespänen als aus Tabak. Aber in der Not, sagte er sich, ohne den Gedanken zu vollenden.
Das rote Päckchen mit der gestelzten Lateinschrift war leer. Er wollte es eben zerknüllen, als ihm der Text auf der Rückseite auffiel, dem er bislang noch nie Beachtung geschenkt hatte. „Austria Tabakwerke AG“ stand da zu lesen, und als Erklärung „vormals Österreichische Tabakregie“. Ja, das waren noch Zeiten gewesen, als die heimischen Zigaretten noch einer Regie unterlegen waren. Bloß nicht sentimental werden, sagte er sich und erhob sich umständlich, was Burli mit einem schrillen Gezwitscher kommentieren zu müssen meinte. Vielleicht, so überlegte Bronstein, sollte er wenigstens einen kleinen Spaziergang wagen. Zu Hause würde ihm ja doch nur die Decke auf den Kopf fallen.
Er beschloss, sich bis zur Wollzeile durchzuschlagen. Dort würde er in die „Aida“ auf eine Melange und ein süßes Backwerk einkehren. Was heißt eine Melange? Wo die dort doch eine so großartige italienische Espressomaschine hatten! Ein Espresso also. Mit dem würde sogar die „C“ erträglich schmecken. Bronstein begab sich ins Vorzimmer, griff nach seinem Mantel und überprüfte, ob er alles Wesentliche darin vorfand. Von der Kommode schnappte er sich seine Schlüssel und seinen viersprachigen Identitätsausweis, blickte sich noch einmal um und verließ dann kurz entschlossen seine Wohnung. Ein scharfer Wind fegte durch die Gasse, und Bronstein überlegte, ob er noch einmal nach oben gehen und einen Schal holen sollte. Schließlich schalt er sich einen Weichling und schritt ohne schützendes Textil aus.
Erwartungsgemäß lag die Kärntner Straße leer vor ihm. An Sonntagen tat sich nie etwas in diesem Bereich, nur das eine oder andere Taxi irrte auf der Suche nach Kundschaft über das Pflaster. Auch die Annagasse war vollkommen verwaist. Kein Wunder. Die dort tätigen Damen würden frühestens eine Stunde nach Einbruch der Nacht auftauchen, und mitten im Winter mutmaßlich nicht einmal das. Bronstein passierte die Malteserkirche, aus der Orgelspiel drang. Er wandte den Kopf nach rechts und warf einen Blick durch die offene Tür, konnte jedoch dabei nicht feststellen, ob eine Messe im Gang war oder ob da nur jemand an dem Instrument übte.
Einige Zeit später lagen auch die Johannes-, die Himmelpfort- und die Weihburggasse hinter ihm, und endlich kam der Stock im Eisen auf der linken Seite in Sicht. Dort nun nahm der Verkehr merkbar zu. Ein Jeep der Alliierten bog auf den Graben ein und entschwand Richtung Kohlmarkt, von dem sich ein wackliger Gräf & Stift näherte. Bronstein musste grinsen. Der Wagen war möglicherweise noch älter als er selbst. Er tuckerte mühsam um die Kurve, was den hinter ihm fahrenden Pullman-Daimler zu heftigem Hupen veranlasste. Direkt vor dem Heidentor konnte der Daimler endlich überholen. Dabei erreichte er jedoch eine bemerkenswert hohe Geschwindigkeit. Bronstein war sich sicher, dass der Fahrer einer Abmahnung bedurfte, doch derlei war ihn auch in seiner aktiven Zeit nichts angegangen, also zuckte er nur kurzmit den Schultern und ging weiter am Dom vorbei, um nun endlich die Wollzeile zu erreichen, in die er rechts einbog.
Nur noch wenige Meter trennten ihn von seinem Ziel, als ihm linker Hand die Buchhandlung „Morawa“ auffiel. Bronstein kannte sie noch aus der Zeit, als sie unter dem alten Herrn Goldschmiedt ein reines Zeitungsgeschäft gewesen war, in dem man die verschiedensten Presseerzeugnisse in Einzelausgaben oder aber gleich im Abonnement erstehen konnte. In den 20er Jahren hatte dann Emmerich Morawa das Geschäft übernommen, dessen Zeitungsimperium durch die Politik der Dollfuß-Regierung empfindliche Gewinneinbußen hatte hinnehmen müssen. Das Ausweichen auf den Buchhandel war ein geschäftlicher Kunstgriff gewesen, der nun, zehn Jahre nach dem Ende des Krieges, mehr und mehr zum Haupterwerb von „Morawa und Co.“ geworden war. Bronstein hätte gern einen Sprung vorbeigeschaut, um sich vielleicht ein gutes Buch für den Aufenthalt in der „Aida“ zu besorgen. Doch es war Sonntag, und da hatten alle Geschäfte ihre Pforten geschlossen zu halten. Also, seufzte Bronstein, würde er wohl mit einer der in der Konditorei aufliegenden Zeitungen und Zeitschriften vorliebnehmen müssen.
Endlich war Bronstein beim Etablissement angekommen. Der alte Prousek stand zwar nicht mehr selbst hinter der Budel, aber die Qualität stimmte immer noch. Augenblicklich kam Bronstein ins Schwelgen. Gleich links standen zwei verführerische Esterházy-Schnitten. Allein der Anblick der geilen Buttercreme, in der sich, Bronstein wusste es genau, Cognac und Vanilleextrakt befanden, und der Fondantglasur mit dem klassischen, spinnwebartigen Schokoladenmuster darauf ließ Bronstein das Wasser im Munde zusammenlaufen. Nichts gegen Sacher- oder Linzertorte, aber so eine Esterházy-Schnitte, die war einfach paradiesisch. Bronstein bestellte eine und orderte einen Kurzen dazu. Und weil Sonntag war, ließ er sich auch noch zu einer Regievirginier verführen, die er nach dem Verzehr der Süßspeise genussvoll anrauchte. Na bitte, die Pension hatte auch ihre guten Seiten, dachte Bronstein. Manchmal zumindest.
Unmerklich schlich der Tag dahin, und als es draußen allmählich zu dämmern begann, zündete sich Bronstein noch eine „C“ an, ehe er sich schön langsam auf den Weg zurück in seine Wohnung machte, wo er sich für den Theaterabend umzukleiden gedachte. Obwohl sich sein Wohnhaus kaum 500 Meter vom Porr-Haus, in welchem die Vorführung stattfinden würde, entfernt befand, musste Bronstein wieder seine Identitätskarte mitnehmen, denn die Innenstadt stand gerade unter amerikanischer Verwaltung, während der vierte Bezirk zur sowjetischen Zone gehörte. Die Russen würden ihn zwar anstandslos passieren lassen, wenn sie erst hörten, dass sein Ziel das „Sowjetische Informationszentrum“ war, aber den Amerikanern würde er darum umso verdächtiger erscheinen, denn wer ging schon freiwillig in den russischen Sektor? Das konnte in ihren Augen nur ein Kommunist oder ein gefährlicher Spinner sein. Sicherheitshalber griff sich Bronstein daher noch seinen alten Polizeiausweis, denn dieser mochte ihn bei den Yankees unbedenklich erscheinen lassen.
Die Dunkelheit war schon vollständig über die Stadt gefallen, als er endlich wieder auf die Straße trat. Vorbei an der Sirk-Ecke strebte er auf den Ring zu. Jetzt, am Abend, hatte der Wind sowohl an Intensität als auch an Kälte zugenommen. Bronstein zog den Mantelkragen fest zu und bemühte sich, so schnell als möglich wieder ins Warme zu kommen. Er ertappte sich bei dem Wunsch, die Stücke würden statt in der Treitlstraße in der Staatsoper gegeben werden, doch die war immer noch mit dem vor über fünf Jahren errichteten Notdach versehen, und auch wenn die Regierung gerade in letzter Zeit eine vollständige Wiedererrichtung für den kommenden Sommer in Aussicht stellte, war dort an Aufführungen nach wie vor nicht zu denken.
Bronstein dachte nicht weiter darüber nach und querte nun endlich auch den Karlsplatz, der ob seiner Offenheit besonders windanfällig war. Bronstein fror elendiglich und legte noch einmal an Geschwindigkeit zu, um sein Ziel ehebaldigst zu erreichen. Dankbar hielt er am Portal des Informationszentrums an, und noch immer keuchend zog er seinen Mitgliedsausweis der Österreichisch-Sowjetischen Gesellschaft in die Höhe. Der Rotarmist nickte ihm zu und ließ ihn anstandslos passieren. Ohne weitere Verzögerung betrat er den Saal. Am anderen Ende sah er seinen ehemaligen Chef Heinrich Dürmayer stehen, was ihn daran erinnerte, dass dieser in Bälde 50 Jahre alt werden würde. Dazu müsste er ihm ein passendes Geschenk machen, sagte sich Bronstein, während er Dürmayer quer über den Saal hinweg zuwinkte. Dürmayer erwiderte den Gruß und schickte sich an, sich auf Bronstein zuzubewegen, als es auch schon läutete. Dürmayer signalisierte Bronstein gestenreich, man werde sich nach der Vorstellung an der Bar treffen, was Bronstein mit einem Nicken quittierte.
Er setzte sich, und wenig später ging auch schon der Vorhang auf. Warum das erste Stück „Der Bär“ hieß, leuchtete Bronstein nicht so ganz ein, denn es ging um einen alten Gutsherrn, der bei einer Witwe Schulden eintreiben will, sich aber schließlich in selbige verliebt. Der Einakter hatte zwar ein paar recht charmante Szenen, aber wirkliche Begeisterung mochte bei Bronstein nicht aufkommen. Das galt auch für den „Heiratsantrag“, der den Theaterabend beschloss. Da kam einer eigentlich, weil er um die Hand einer Dame freien will, doch die beiden streiten sich von Anbeginn an um jede Kleinigkeit, was dem Brautvater als ideale Voraussetzung für eine Ehe erscheint. Bronstein konnte nicht umhin, dem Wiener Schmäh den Vorzug zu geben. Eine Posse mit Hans Moser oder Paul Hörbiger war da schon eher nach seinem Geschmack. Erst vor zwei Wochen hatte er eine neue Komödie von Franz Antel im Burg-Kino gesehen, in der Hans Moser, ganz gegen seine üblichen Rollen, einen Tankstellenbesitzer gegeben hatte. Doch Moser war auch nicht im Fokus von „Verliebte Leute“ gestanden, dafür war er mit seinen 75 Jahren doch schon zu alt. Selbst Hauptdarsteller Peter Pasetti war als 39-Jähriger etwas überreif für einen jugendlichen Galan. Doch letztlich hatte der überaus jugendlich wirkende Peter Alexander den Film gerettet und für die meisten Lacher gesorgt. Dazu war dann noch die malerische Kulisse von Fuschl- und Wolfgangsee sowie dem Großglockner gekommen, was Bronstein wieder einmal ins Bewusstsein gerufen hatte, wie schön die Heimat eigentlich war. Die wollte er bei aller Liebe nicht gegen einen sibirischen Bären eintauschen.
Die Schauspieler nahmen den Schlussapplaus entgegen, und Bronstein erhob sich, um als einer der Ersten an der Bar zu sein. Ein Gläschen Bier und ein Wurstbrot konnte er jetzt durchaus vertragen. Am besten, er bestellte jeweils gleich zwei, dann musste sich Dürmayer nicht extra anstellen, und sie konnten länger plaudern.
Tatsächlich hatte Bronstein sein Brot schon längst verzehrt und jenes von Dürmayer mit wachsender Gier angestarrt, als dieser endlich auf ihn zutrat. „Servus, David. Verzeih, dass es so lange gedauert hat. Aber weißt eh, wie’s ist. Ich kenn da so viele Leute, da kann ich nicht einfach grußlos aus dem Saal stürmen.“
„Ist schon recht, Heinz. Ich hab dir ein Brot und ein Bier gesichert“, entgegnete Bronstein, während er sich eine „C“ ansteckte. Dürmayer schüttelte den Kopf: „Rauchst immer noch dieses Kraut?“
„Weißt was Besseres?“
„Na Chesterfield zum Beispiel.“
Jetzt war es an Bronstein, den Kopf von links nach rechts und wieder nach links zu bewegen. „Die kriegst ja nur im Schleich.“
Dürmayer grinste: „Und?“
„Hörst, wir sind … waren Polizisten.“
„Na, dann beschlagnahmst du sie eben.“
Bronstein gluckste. „Du g’fallst mir.“
„Apropos g’fallen“, wechselte Dürmayer das Thema, „wie hat dir die Aufführung gefallen?“
Bronstein war sich nicht sicher, ob Dürmayer seine Kritik gefallen würde, und daher entschloss er sich zu einer lahmen Befürwortung der gezeigten Leistungen. Dürmayer hörte sich Bronsteins Ausführungen an und zuckte dann mit den Schultern. „Ich weiß nicht“, begann er, „Ich kann nicht umhin, dem Wiener Schmäh den Vorzug zu geben. Eine Posse mit Hans Moser oder Paul Hörbiger ist da schon eher nach meinem Geschmack. Erst vor zwei Wochen habe ich eine neue Komödie von Franz Antel im Burg-Kino g’sehen, in der der Moser, ganz gegen seine üblichen Rollen übrigens, einen Tankstellenbesitzer gegeben hat.“
Bronstein hob abwehrend die Hand. „Ja, ja, die kenn ich. Die hab ich auch gesehen.“ Er verspürte keine sonderliche Lust, über den Film zu diskutieren, nachdem ihn Dürmayer so hatte auflaufen lassen. „Sag, was anderes“, begann er daher, „was ist denn wahr an den Gerüchten, dass die Alliierten jetzt doch endlich abziehen?“
Dürmayer zuckte mit den Schultern. „Woher soll ich das wissen?“
„Na hörst, immerhin sitzt du im ZK …“
„Ja, aber nicht in dem von der KPdSU. Vergiss das nicht. Auch wenn es dauernd heißt, die KPÖ existiert nur am Gängelband der Sowjets, so sind wir doch eine eigenständige Partei. Wie die KPdSU eben auch. Was die Genossen in Moskau beschließen, ist ausschließlich deren Bier.“
„Na, eher Wodka, oder?“ Bronstein gluckste. Dürmayer schenkte ihm einen tadelnden Blick: „Ernst wirst du in diesem Leben nimma, was?“ Bronstein setzte eine stoische Miene auf: „Nein. Ich bleib ein David. Mein Leben lang.“
Er hatte den Wortwitz nicht am Wegesrand verkommen lassen wollen, doch der Preis für den Kalauer bestand darin, dass Dürmayer nun endgültig nicht mehr mit ihm politisieren wollte. Zwei Genossen, die an sie herangetreten waren, bildeten einen willkommenen Vorwand, Bronstein noch einen schönen Abend zu wünschen und ihn stehen zu lassen. Dem pensionierten Oberst blieb nichts anderes übrig, als sein Glas auszutrinken und sich auf den Heimweg zu machen.
Die Kälte hatte empfindlich zugenommen, und so strebte er, so schnell ihn seine Beine trugen, seinem Wohnhaus zu. Endlich dort angekommen, breitete er die Decke über Burli, schenkte sich noch ein Glas Rotwein ein, um sich dann mit einem Buch in seinen neuen Fauteuil plumpsen zu lassen. „Kalendergeschichten“ lautete der Titel des Druckwerks. Bronstein war durch die Aufführungen im „Scala-Theater“ auf dessen Autor Bert Brecht aufmerksam geworden, wobei ihn vor allem Helene Weigel, Ernst Busch und Otto Tausig in „Die Mutter“ beeindruckt hatten. Genau an jenen Theaterabend vor eineinhalb Jahren hatte er sich nun wieder erinnert und sich spontan dazu entschlossen, sich auch einmal Brechts Prosa zuzuwenden. Und gleich die erste der „Kalendergeschichten“ hatte es in sich. Eine Magd namens Anna hatte ein Kind in harten Kriegszeiten gerettet, und nun, im Frieden, wollte die leibliche Mutter das Kind wiederhaben, wogegen die Magd sich wehrte. Also kam es zu einem Prozess, bei dem der Richter verfügte, die beiden Frauen mögen das in einem Kreidekreis stehende Kind mit Gewalt an sich ziehen. Während die leibliche Mutter eben dies tut, verzichtet die Magd auf solche Kraftanstrengung, um dem Kind keinen Schaden zuzufügen. Der Richter spricht das Kind daraufhin ihr zu, da sie mehr Empathie als die eigentliche Mutter gezeigt habe. Bronstein hielt in der Lektüre inne. Gab es da nicht eine solche Geschichte, in der Salomo die Rolle des Richters zukam? Ob das in der Bibel stand? Hatte er überhaupt eine zu Hause, um nachschlagen zu können? Fragen über Fragen, und doch keine Antworten. Außer einer. Zeit, schlafen zu gehen.
Bronstein stellte das Glas in der Küche ab, schlurfte dann müde in sein Schlafzimmer, entledigte sich seiner Kleidung, zog seinen Pyjama an und legte sich nieder. Er tat noch einen langen Seufzer, stellte sich auf grübelndes Wachen ein und war auch schon eingeschlafen.
Montag, 31. Jänner 1955
Gnadenlos rasselte der Wecker um 7 Uhr morgens. Auch wenn es für Bronstein keinerlei Grund mehr gab, zu dieser frühen Stunde der eigenen Bettstatt zu entfliehen, so hatte er sich diese Angewohnheit auch nach seiner Pensionierung beibehalten, um, wie er sich selbst sagte, nicht einzurosten. Widerwillig schlug er die dicke Decke zurück, was ihn sogleich frösteln machte. Er setzte sich umständlich auf und verspürte sofort heftige Verspannungen im Rückenbereich. Auch seine Hüfte tat ihm weh, sodass er beschloss, es vorsichtig anzugehen. Seine Füße tasteten nach den Hausschuhen, dann, nachdem sie selbige gefunden hatten, gab er sich einen Ruck und brachte sich in eine stehende Position.
Träge schlurfte Bronstein in seine Küche, wo er tapsig nach der Kaffeemaschine suchte. Wozu die Mühe, fragte der faule Teil in ihm. Es war Ultimo. Morgen würde ihn der Geldbriefträger besuchen und ihm die Pension auszahlen, also konnte er sich getrost ein Frühstück im Kaffeehaus leisten. Bronstein gab die Suche nach der Espressomaschine auf und wankte stattdessen ins Badezimmer, wo er sich einer oberflächlichen Waschung unterzog, ehe er, bibbernd vor Kälte, ins Schlafzimmer zurückeilte, um sich anzukleiden.
Eine halbe Stunde später stapfte Bronstein am „Sacher“ vorbei auf den Michaelerplatz zu. Mit jedem Schritt wurde ihm kälter, und nur die Hoffnung auf eine Buttersemmel und eine Schale Gold hielt ihn aufrecht. So schnell, wie es ihm möglich war, überwand er den Kohlmarkt und fixierte sein anvisiertes Ziel mit festem Blick. Endlich konnte er die Tür zum Café „Herrenhof“ öffnen und sich erleichtert auf seinen Stammplatz fallen lassen. Er mochte Polizeibeamter in Ruhe sein, aber einen Stammplatz hatte man auf Lebenszeit. Dies umso mehr, solange im „Herrenhof“ noch der Oberkellner Albert das Zepter führte. Bronstein atmete tief ein und kramte nach seinen Zigaretten.
„Guten Morgen, Herr Oberst. Na, wie ist das werte Befinden heute?“ Von Bronstein unbemerkt war Albert an den Tisch herangetreten und stellte wie selbstverständlich eine Schale Gold auf denselben.
„Danke. Danke“, sagte Bronstein nur und zögerte einen Augenblick, was Albert dazu veranlasste, in seiner Bewegung innezuhalten. „Wissen S’ was, Herr Albert. Ich glaub, heut nehm ich ein Kipferl. Und dazu geben S’ mir irgendein Revolverblattl. Ich war gestern im Theater, da brauch ich einen geistigen Ausgleich heute.“ Dabei grinste Bronstein schief.
Drei Minuten später kam Albert mit dem gewünschten Gebäck und dem „Bild-Telegraf“ vom Tage zurück. Die reißerische Schlagzeile erregte sofort Bronsteins Aufmerksamkeit. Er nickte Albert daher nur kurz zu und begann, das Kipferl nicht weiter beachtend, den Artikel zu lesen, der mit den Worten „KP-Polizist Seiser liquidiert?“ betitelt war. Bronstein sagte der Name nichts, aber dass Seiser Polizist gewesen zu sein schien, rechtfertigte allemal eine ausführliche Lektüre des Beitrags.
„,Ich weiß genau, was mir jetzt blüht‘, sagte Ex-Polizeichef Vinzenz Seiser, 43, am Samstag zu einem Freund“, begann dieser auf der ersten Seite des Blattes, und Bronstein war sich sicher, es mit einer der üblichen Skandalgeschichten zu tun zu haben, mit denen der Boulevard seine Auflagen zu steigern trachtete. „Am Nachmittag trank er in aller Gemütsruhe und bester Laune in seinem Stammlokal in der Ettenreichgasse 15 ein Seidel Bier. Dann verließ er das Gasthaus, sein Auto blieb auf der Straße vor dem Hause stehen. Eine knappe halbe Stunde später knallte in der Nähe des ehemaligen Linienamtes in Neuwaldegg ein Schuss. Kurze Zeit darauf fand ein Lastwagenchauffeur Seisers Leiche.“
Bronstein pfiff durch die Zähne. Augenblicklich erwachte der Ermittler in ihm. Wenn der Mann Favoriten ohne sein Auto verlassen hatte, konnte er unmöglich in so kurzer Zeit nach Hernals gelangen. Denn Taxis waren nach wie vor Mangelware, und es stand kaum zu erwarten, dass sich eines davon ausgerechnet in diese proletarischen Gründe verirrt haben sollte. Noch dazu galt es, egal, wie man fuhr, mehrere Zonengrenzen zu überwinden. Allein durch die diesbezüglichen Kontrollen hätte man eine gute Viertelstunde verloren. Sicherheitshalber pfiff Bronstein ein weiteres Mal.