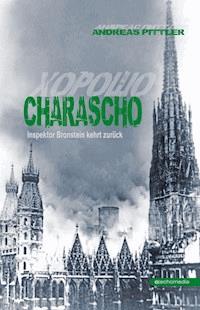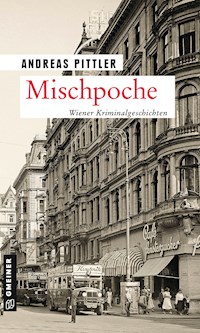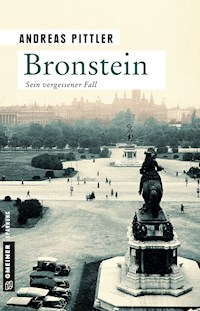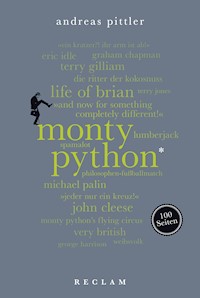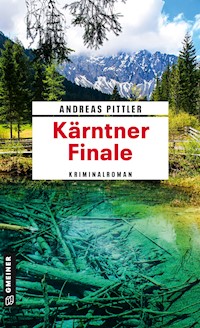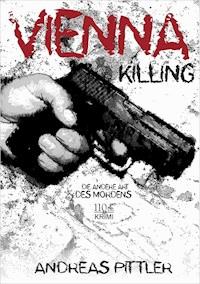Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Obiltschnig und Popatnig
- Sprache: Deutsch
Die Ferlacher Polizisten Obiltschnig und Popatnig haben keine Zeit, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. In Kärntens Tourismus-Hotspot Burg Hochosterwitz wird eine enthauptete Leiche gefunden. Da das traditionelle Mittelalterfest unmittelbar vor der Tür steht, drängt die Zeit. Die beiden Ermittler finden heraus, dass es sich bei dem Toten um einen Schausteller handelt, der durch die bunte Welt der Jahrmärkte gondelte, und stehen vor einem Rätsel: Wer hegte ausgerechnet gegen einen harmlosen Zeitgenossen einen derart großen Groll?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Pittler
Kärntner Ritterspiel
Kriminalroman
Zum Buch
Die Kärntner Mörderjagd geht weiter Die beiden Ferlacher Ortspolizisten Obiltschnig und Popatnig sonnen sich im Ruhm, einen spektakulären Kriminalfall in ihrer Heimatstadt erfolgreich gelöst zu haben. Doch für beschauliche Zufriedenheit ist kein Platz mehr, als auf der Burg Hochosterwitz, einem der touristischen Hotspots in Österreichs südlichsten Bundesland, eine enthauptete Leiche gefunden wird. Mangels entsprechenden Personals im Kärntner LKA werden Obiltschnig und Popatnig mit dem Fall betraut. Sie finden heraus, dass es sich bei dem Toten um einen harmlosen Schausteller handelt, der mit seinen Waren durch die bunte Welt der Mittelaltermärkte tingelte. Wer könnte so jemandem Schaden zufügen wollen? Als noch ein Standbetreiber ermordet wird, ist den beiden Ermittlern klar: Es geht um eine interne Angelegenheit. Doch wer begleicht hier höchst grausam eine Rechnung?
Andreas Pittler, geboren 1964, studierte Geschichte und Politikwissenschaft (Magister und Doktor phil.). Ursprünglich als Journalist tätig, wandte er sich im 21. Jahrhundert vermehrt der Belletristik zu und veröffentlichte seit dem Jahr 2000 insgesamt 23 Romane. Seine Werke landen regelmäßig auf den österreichischen Bestsellerlisten und wurden bislang in acht Sprachen übersetzt. In seiner ursprünglichen Profession als Historiker ist er regelmäßig als Experte im Österreichischen Rundfunk zu Gast. Für sein literarisches Wirken erhielt er 2006 das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, 2016 wurde ihm vom österreichischen Bundespräsidenten der Berufstitel »Professor« verliehen.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Sergey Novikov / shutterstock.com
ISBN 978-3-8392-7950-2
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Prolog
Aufwachen! Bitte aufwachen! Das muss ein Albtraum sein! Ja, das kann gar nichts anderes sein. So etwas gibt es doch in der Wirklichkeit nicht. Das sieht man höchstens in Filmen. In sehr schlechten Filmen. Ich will mich kneifen, damit ich endlich aufwache. Doch das geht nicht. Mir sind die Hände gebunden. Buchstäblich.
Und man hat mir einen grobleinernen Sack über den Kopf gestülpt, weshalb ich nichts sehe. Ich kann gerade zwischen hell und dunkel unterscheiden, und im Augenblick scheint eine Lampe oder etwas Ähnliches auf mein Gesicht gerichtet. Und ich höre Stimmen. Also zumindest eine. Der, der da spricht, klingt ziemlich derb. Sagt etwas davon, dass ich mich anscheißen würde. Im übertragenen Sinn hat er nicht unrecht. Ich habe tatsächlich Angst. Ziemlich große sogar.
Ich frage mich, wie ich hierhergekommen bin, und dabei weiß ich nicht einmal, wo ich mich überhaupt befinde. Erinnern! Ich muss meine Gedanken ordnen, muss herausfinden, was vorgefallen ist. Ich weiß noch, dass ich unterhalb der Burg war. Meinen Stand für das Fest vorbereiten. Ich habe das Equipment inspiziert. Alles war an seinem Platz, die Schwerter, die Dolche, die Schilde, der Harnisch, der Helm. Alles war wie immer.
Ich war dann noch bei Selina. Das weiß ich auch noch. Sie hat wieder ihren mittelalterlichen Kräutereintopf gekocht, den sie in den nächsten Tagen an die Besucher verkaufen will. Und wie immer hat sie uns reichlich davon kosten lassen. Und er war einmal mehr köstlich. Ich habe sogar einen Nachschlag verlangt. Dazu bot uns Mario seinen Met an. Irgendwann hat dann jemand Wein geholt, und von dem habe ich vielleicht ein paar Gläser zu viel getrunken, denn ich bin dann anstatt nach Hause zu fahren in mein Zelt gegangen. Klar, warum auch nicht. War ja eine schöne, milde Sommernacht. Ich wollte noch meine Mails checken, doch ich war so müde und bin wohl sehr rasch eingeschlafen.
Plötzlich bekam ich keine Luft! Irgendjemand hatte mich gepackt und mir Mund und Nase zugehalten. Ich spürte hammerharte Schläge in den Magen und in die Seiten. Versuchte zu schreien, doch das ging nicht. Und dann … ja, dann hat mir jemand irgendetwas über den Schädel gezogen, denn ab diesem Zeitpunkt habe ich einen Filmriss.
Das heißt, nicht ganz. Ich kam irgendwann zu mir, weil ich hin und her rollte. Und da ich immer wieder gegen etwas Hartes prallte, nehme ich an, dass ich mich auf der Ladefläche eines Kleinlasters befand. Dazu passte auch dieses Dröhnen, das nur von einem Motor stammen konnte. Und so gesehen war es wohl eine scharfe Kurve, die dafür verantwortlich war, dass ich neuerlich das Bewusstsein verlor, als mein Kopf gegen eine Metallwand prallte.
Ich kann daher nicht sagen, wie viel Zeit verging, bis plötzlich derbe Hände an mir zerrten. Wie ein nasser Sack fiel ich zu Boden und schrie aus Leibeskräften. Doch ich wurde einfach weitergeschleift. Jede Faser meines Körpers schmerzte höllisch, und die Pein wurde noch verstärkt, als man mich über irgendwelche Stiegen hinaufschleppte. Ich hörte eine schwere Tür, die zugeschlagen wurde, dann landete ich unsanft auf meinem Hintern, und seitdem sitze ich hier auf einem kalten Boden, der aus Stein zu sein scheint, und muss mir diesen rüden Kerl anhören, der ohne Pause herumfeixt.
Jetzt spricht er mich anscheinend direkt an. Ob ich mir schon wünschte, meine Mami würde mich retten. Was weiß der von meiner Mutter? Au, verdammt. Der Arsch hat mir mit voller Wucht in die Seite getreten, und ich bin umgekippt wie ein Kegel beim Bowling. Aargh, der nächste Tritt ging direkt in den Mund! Ich glaube, meine Lippe ist geplatzt, denn ich schmecke deutlich Blut. Gott! Der Scheißkerl hört nicht auf. Das tut mörderisch weh, und ich denke, das mit dem Anscheißen, das ist nicht länger nur eine rhetorische Figur.
Ich höre mich selbst stöhnen und wimmern, flehe ihn an, endlich aufzuhören. Was er denn um Himmels willen von mir will, frage ich ihn. Doch er lacht nur. Und traktiert mich weiter. Ein Albtraum, ein einziger Albtraum.
Halt. Hat er wirklich aufgehört? Ich wage kaum, Luft zu holen, denn jeder Atemzug schmerzt fürchterlich. Mein Peiniger ist still geworden. Höre ich da Schritte? Ja, er scheint sich von mir zu entfernen. Jetzt vernehme ich ein seltsam schnarrendes Geräusch, so wie Metall, das über den Boden kratzt. Ob ich weiß, was das ist, fragt er mich. Als ob ich durch diesen dämlichen Sack etwas erkennen könnte.
Heilige Muttergottes! Der hat … der hat mir eben etwas in den Oberschenkel gerammt. Dem unaussprechlichen Schmerz nach zu urteilen etwas ziemlich Großes. Ein … Schwert? Der wird mich doch nicht mit meinem eigenen Equipment …? Oh Gott! Was geht da verdammt noch einmal vor sich? Und warum kommt niemand, mich zu retten?
Da! Noch ein Streich. Ich höre meine eigenen Schreie so laut, doch sie bewirken nichts. Der Irre hackt mich in Stücke. Hilfe! Um Himmels willen Hilfe!
Und plötzlich wieder Stille. Unheimliche Stille. Mir ist, als verspürte ich einen Luftzug. Dazu ein leises Surren. Das hört sich so an wie meine Schwerter, wenn ich sie vor meinem Publikum ordentlich durchschwinge. Oh mein Gott! Der wird doch nicht …
I.
Freitag, 11. August
Obiltschnig hatte seinen freien Tag. Seit Huebers Verurteilung waren drei Monate ins Land gezogen. Erwartungsgemäß hatte sie die Höchststrafe erhalten, und ihr Hof gehörte nun endgültig der Gemeinde, da die Rechtmäßigkeit des Kaufvertrags mittlerweile gerichtlich bestätigt worden war. Stadion gab es allerdings noch immer keines, und es war fraglich, mit welcher Verve der neue Finanzstadtrat, der zugleich auch als Vizebürgermeister fungierte, das Projekt vorantreiben würde.
Es schien sich also nicht viel verändert zu haben in der beschaulichen Rosentaler Metropole. Man kaufte immer noch seine Bärentatzen bei Swee Fong, deren Talent für Sprachen Obiltschnig jedes Mal aufs Neue beeindruckte. Die quirlige Chinesin sprach mit den deutschen Gästen Hochdeutsch, mit den Einheimischen einen breiten Kärntner Dialekt und mit den Slowenen Slowenisch. Einmal hatte Obiltschnig beobachtet, dass sie mit dem örtlichen Schriftsteller sogar Chinesisch redete. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn Swee Fong auch noch Italienisch oder gar Französisch beherrschte.
Nach dem Verzehr des Süßgebäcks war er zum Italiener geschlendert, auf dessen Terrasse er nun saß, um sich einen Cappuccino einzuverleiben. Der Eissalon am Hauptplatz galt immer noch als »der« Italiener, weil das neue italienische Delikatessengeschäft, das genau gegenüber eröffnet hatte, eigentlich von einem Tschechen namens Honza geführt wurde. Wollte man also Äquidistanz wahren, dann trank man zuerst einen Kaffee beim Italiener und anschließend noch einen Espresso beim Tschechen. Und dazwischen schlenderte man durch die am Hauptplatz aufgestellten Marktstände, wo man sich, je nach Lust und Laune, mit Kokoskuppeln, Salamistangen oder Käselaiben eindecken konnte. Freitag war seit urdenklichen Zeiten Markttag, und dementsprechend betriebsam ging es unter Obiltschnigs Blicken zu.
Normalerweise hätte er nun versonnen an seinem Kaffee genippt und dabei die Leute beobachtet. Doch etwas hatte sich seit der Huebersache doch geändert. Obiltschnig war zum Leser geworden. Annas Standpauke zeichnete dafür verantwortlich, dass er sich nun regelmäßig in der Stadtbücherei ein Buch auslieh. Dabei bemühte er sich, seinen Horizont zu erweitern, weshalb er zumeist Sachbücher mit Regionalbezug las. Dadurch hatte er Erstaunliches über seine Heimat erfahren. Dass die Dolicher Kirche einst von den lokalen Eisenwerksbesitzern gestiftet worden war, dass es sich beim Ferlacher Schloss ursprünglich gar nicht um ein solches gehandelt hatte, und dass sich die Napotnigs vor 100 Jahren noch mit einem »k« hinten schrieben.
Von Zeit zu Zeit brauchte er aber auch ein wenig Abwechslung, und so saß er nun bei seinem Cappuccino und warf einen prüfenden Blick auf seine neueste Leihe. Es handelte sich um ein frühes Werk des lokalen Schriftstellers, das offensichtlich in Wien spielte. Auf dem Cover war eine Abbildung des Heldenplatzes im Morgennebel zu sehen. Der Gmeiner-Verlag, in dem das Werk erschienen war, schien auf Krimis spezialisiert zu sein, eine Gattung, die Obiltschnig schon aus Berufsgründen eher mit Skepsis betrachtete. Doch Anna hielt es anscheinend für zweckmäßig, auch solcher Literatur eine Chance zu geben. Gute Kriminalromane brauchten sich, so statuierte sie, hinter anderen Werken nicht zu verstecken. Und so kam es, dass Obiltschnig jetzt einem fiktiven Kollegen bei dessen Arbeit über die Schulter blickte.
Weit war er nicht gekommen, als Popatnig an ihm vorbeischlenderte. Obiltschnig riskierte eine irritierte Augenbraue. »Ferdl«, knurrte er daher, »machst um die Zeit schon Mittag?« Der Kollege zuckte mit den Schultern. »Ist doch eh nix los«, entgegnete er, während er sich wie selbstverständlich auf den Sessel neben Obiltschnig fallen ließ. »Einen Autofahrer hab ich abgemahnt, weil der in der 12. Novemberstraße gegen die Einbahn gefahren ist, und die alte Weghuber hat sich wieder über den Köter vom Nachbarn beschwert. Das ist der gesamte Tagesbericht. Da kann man sich zwischendurch schon ein Kaffeetscherl gönnen. Außerdem ist der junge Koschat eh am Posten.«
Obiltschnig musste schmunzeln. Der »junge« Koschat war der Enkel des seinerzeitigen Postenkommandanten, der ihnen zu Beginn des Jahres zugeteilt worden war. Er schien seinem Großvater alle Ehre machen zu wollen und war gerade deshalb besonders dienstbeflissen. Nach einem alten Asterix-Band witzelte Obiltschnig gerne, der Neuzugang habe noch Blümchen am Pilum, doch aus fachlicher Sicht war der Mann in jeder Hinsicht vorbildlich. Vielleicht sogar eine Spur zu vorbildlich, dachte Obiltschnig, während Popatnig eben einen Verlängerten bestellte.
»Hast das mit Hochosterwitz mitbekommen?«, fragte der Kollege unvermittelt. Obiltschnig erwies sich als ahnungslos. »Ist die Burg eingestürzt oder was?«, versuchte er einen Witz, auf den Popatnig gar nicht erst einging. »Einen ganz brutalen Mord hat es dort gegeben. Und das ausgerechnet zwei Tage, bevor die Mittelalterfestspiele anfangen sollen. Die sind dort alle voll aus dem Häuschen.«
»Ich habe heute noch keine Zeitung gelesen«, gestand Obiltschnig und erntete ein heiseres Lachen von Popatnig. »Zeitung! Da merkt man echt, dass du alt bist, Sigi. Die Tat ist ja erst heute Morgen entdeckt worden, da kann das noch gar nicht in der Zeitung stehen, die sind doch immer zwei Tage hintennach mit ihren sogenannten Meldungen.« Popatnig grinste penetrant. »Nein, so was erfährst du aus dem Internet. Ich hab dafür eine eigene App.«
Obiltschnig zuckte mit den Schultern. »Mir reicht’s, wenn ich so etwas aus der Zeitung erfahre. Das ist immer noch früh genug.«
»Aber wenn etwas wirklich wichtig ist?«, beharrte Popatnig und beeindruckte Obiltschnig auch damit nicht. »Dann sagt’s mir die Resi«, erklärte der Gruppeninspektor aufgeräumt. Popatnig schüttelte resigniert den Kopf. »Mit der Einstellung kommst du nie aus Ferlach raus.« Obiltschnig deutete ein Lächeln an. »Will ich auch gar nicht.«
Im Augenwinkel nahm er den Bürgermeister wahr, der vom Rathaus kommend offenbar eine Runde über den Markt drehte. Obiltschnig kannte diese Angewohnheit des Stadtvaters nur zu gut. Auf diese Weise war er auch für jene Gemeindemitglieder ansprechbar, die sich davor scheuten, ihn in seinen Amtsräumen aufzusuchen. Gar manches Problem war elegant zwischen Drautaler Käse und Karstschinken gelöst worden. Kein Wunder also, dass der Mann populär war. Und wie um seine Volkstümlichkeit zu unterstreichen, winkte er den beiden Polizisten im Vorübergehen zu, dabei ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen. Obiltschnig legte Zeige- und Mittelfinger an die Schläfe und deutete ein Salutieren an, dann wendete er sich wieder Popatnig zu. »Bist du dir sicher, dass du den Koschat so lange alleine lassen willst?« Er erntete ein kaum hörbares Grummeln. »Bin eh schon weg«, maulte der Jüngere. Na bitte, endlich konnte sich Obiltschnig auf sein Buch konzentrieren. »Noch einen Cappuccino bitte«, rief er dem Cafetier zu.
Er war noch keine zehn Seiten weit gekommen, als sein Handy läutete. Automatisch warf er einen Blick auf das Display. »Unbekannte Nummer« stand dort, die Vorwahl war jene von Klagenfurt. Welcher Hauptstädter konnte etwas von ihm wollen? Die Neugier siegte, und Obiltschnig nahm den Anruf entgegen. »Begrüße Sie, Herr Gruppeninspektor. Oberst Dullnig am Apparat.« Obiltschnig verdrehte die Augen. Ein derartige Kontaktaufnahme konnte nichts Gutes bedeuten. Er atmete leise durch. »Herr Oberst, was kann ich für Sie tun?«
»Sind Sie gerade an etwas Dringendem dran? Einen Massenmord beim Glock oder einem Massaker bei der Büchsenmacher-Prüfanstalt?« Obiltschnig unterdrückte ein Knurren. Diesen Sarkasmus konnten sich die aus Klagenfurt sparen. Aber gut, Ironie gab es auch in einer Ferlacher Version. »Wie der Zufall es so will, haben Kollege Popatnig und ich gerade den Al Kaponig zur Strecke gebracht, daher ist hier im Augenblick alles ruhig.«
»Na bestens, dann ließe es sich doch sicherlich einrichten, dass Sie auf einen Hüpfer bei uns vorbeischauen. Es gäbe etwas zu besprechen.« Sein Knurren war nun wohl nicht mehr zu überhören. Doch die in Klagenfurt scherte es sicher einen feuchten Kehricht, dass es sich um seinen freien Tag handelte. Jeder Widerstand war daher zwecklos. Besser, er brachte die Sache schnell hinter sich, dann war vielleicht noch der Nachmittag zu retten. »Kein Problem, Herr Oberst, wir sind in 20 Minuten bei Ihnen.«
Einen Augenblick später wählte er Popatnigs Nummer. »Ferdl, dir ist doch eh fad am Posten, oder?« Er wartete keine Antwort ab. »Die in Klagenfurt wollen was von uns. Wirf dich in den Streifenwagen und hol mich am Hauptplatz ab.«
Der Minutenzeiger der Uhr war zehnmal weitergewandert, als die beiden Görtschach passierten. Popatnig hielt auf den ersten Kreisverkehr zu. »Und du weißt wirklich nicht, worum es geht?« Obiltschnig warf einen sehnsüchtigen Blick auf die Pizzeria. »Ich hab nicht gefragt, der Dullnig hat es nicht gesagt.«
»Sehr mysteriös!«
Obiltschnig winkte ab. »Erwarte dir nicht zu viel. Wenn die Großkopferten nach unsereins verlangen, dann verheißt das selten etwas Gutes. Stell dich eher darauf ein, dass wir uns wieder wegen irgendetwas verteidigen müssen. Vielleicht wollen sie uns den Koschat wieder wegnehmen. Oder wir werden zwangsverpflichtet für irgendein blödes Seminar, das wieder vollkommen unnötig ist.«
Popatnig sprang auf den Zug auf. »Ja, so wie dieser Digitalisierungsscheiß im Jänner. Genauso ärgerlich wie fad.«
»Eben. Ich bin mir sicher, wir werden den ganzen Rückweg nichts als fluchen.«
Popatnig war an der Hollenburg vorbeigefahren und hielt auf Maria Rain zu. Wieder bot sich ein Anlass für einen sehnsüchtigen Blick, diesmal auf das Cevapcici-Lokal auf der linken Seite. »Dort hätt’ ich jetzt lieber einen Termin«, ließ der Gruppeninspektor Popatnig wissen. Der aber konzentrierte sich auf den dichter werdenden Verkehr in Lambichl, wo ihn eine rote Ampel zwang, den Wagen anzuhalten. »Na ja«, meinte er, während er das Signal im Auge behielt, »vielleicht dauert das ja nicht allzu lange, dann können wir uns beim Rückweg noch ein paar Tschewerln1 in einem Lepinja geben lassen.« Obiltschnig hörte die Botschaft und registrierte, wie ihm das Wasser im Mund zusammenlief.
Je näher sie dem Zentrum der Landeshauptstadt kamen, desto zähflüssiger wurde der Verkehr. Obiltschnig war regelrecht dankbar, als sie sich endlich aus dem Wagen schälen und das Polizeigebäude betreten konnten. Ohne Umschweife begaben sie sich in Dulnigs Büro, der sofort übertriebene Freundlichkeit signalisierte, ein Grund, argwöhnisch zu sein, dachte der Gruppeninspektor.
Nachdem sie auf eine moderne Sitzgruppe platziert und mit Kaffee versorgt worden waren, kam Dullnig ohne weiteres Zögern auf das eigentliche Thema zu sprechen. »Sie werden wissen, was sich heute des Nächtens in Hochosterwitz ereignet hat?«
»Der bestialische Mord«, antwortete Obiltschnig wie aus der Pistole geschossen, »natürlich. Das ganze Internet ist voll davon.« Es gelang ihm, dabei keine Miene zu verziehen und Popatnigs offenen Mund zu ignorieren. Dullnig deutete ein Lächeln an. »Sie gehen mit der Zeit, Herr Gruppeninspektor. Gratuliere. Das ist gut. Sie glauben gar nicht, wie viele unserer Kollegen einfach darauf warten, bis solche Dinge erst einmal in der Zeitung stehen.«
»Freilich wahr«, hielt dem Obiltschnig entgegen, »die werden es nur leider nie zu etwas bringen.« Er schaffte es, auch den Fußtritt, den ihm Popatnig unter dem Tisch verabreichte, auszublenden.
»Apropos. Da sind wir auch schon beim Kern der Sache. Wie Ihnen sicherlich nicht entgangen ist, durfte sich Kollege Hartl nach beinahe einem Jahr Burn-out in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Seine Stelle ist leider immer noch nicht nachbesetzt, sodass wir gerade wieder einmal eine sehr angespannte Personallage haben.« Dullnig lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Und da hat sich die Chefetage daran erinnert, dass Sie beide in dieser Hueber-Sache hervorragende Arbeit geleistet haben. In diesem Zusammenhang kam die Idee auf, diesen heiklen Fall in Hochosterwitz Ihnen beiden anzuvertrauen. Was halten Sie davon?«
Obiltschnig fasste sich als Erster. »Was würde das für unseren Posten in Ferlach bedeuten?«
Dullnig zeigte ein weiteres Lächeln. »Daran haben wir natürlich auch gedacht. Der Kollege Koschat ist ja ohnehin schon dienstzugeteilt, und für die Dauer Ihrer Ermittlungen könnten wir von hier aus der Zentrale jemanden abstellen. Für Ferlach wäre also gesorgt.«
»Und wenn wir erfolgreich sind, was dann?«, wollte Popatnig wissen.
»Wie, was dann?« Dullnig schien nicht zu verstehen, worauf Popatnig hinauswollte. »Nun, Sie sagten, die Planstelle von Oberst Hartl ist noch nicht nachbesetzt. Ich für meinen Teil hätte nichts dagegen …«
Dullnig hob die Hand. »Nicht so schnell mit den jungen Pferden. Natürlich steht es jedem Mitglied der Exekutive frei, sich für andere Positionen zu bewerben. Und es ist dabei sicherlich kein Nachteil, wenn man dabei darauf verweisen kann, zwei Schwerverbrecher überführt zu haben. Aber versprechen können wir Ihnen da natürlich nichts. Das verstieße ja gegen das Ausschreibungsgesetz.«
Na klar, dachte Obiltschnig, die hochwohllöbliche Direktion musste erst abwarten, ob nicht irgendein Günstling aus Politik oder Chefetage an der Funktion interessiert war. Eigentlich sollte er darauf bestehen, im Falle des Erfolgs den Posten auf jeden Fall zu bekommen. Doch andererseits konnte eine solche Mordermittlung eine recht nette Abwechslung darstellen. Mit wohligem Prickeln dachte er daran zurück, wie sehr er vor einem knappen Jahr genossen hatte, den Mord an den beiden Stadträten aufzuklären. Derartiges war jedenfalls viel spannender, als auf der Hollenburgbrücke mit einer Radarpistole herumzufuchteln.
»Wir machen ’s«, verkündete er. »Hervorragend«, replizierte Dullnig, »die KTU hat alle Spuren vor Ort penibel analysiert, und der Kollege Bergmann hat das Opfer gerade am Tisch.« Dullnig suchte mit den Augen seinen Schreibtisch ab, fand dann eine dünne Mappe, ergriff sie und drückte sie Obiltschnig in die Hand. »Hier drinnen befindet sich alles, was wir bislang über die Sache wissen. Sie können sich ja einmal ins Bild setzen und bereits mit der Recherche beginnen. Und morgen geht es dann frisch ans Werk.«
»Morgen ist aber Samstag«, entfuhr es Popatnig. Dullnig machte absichtlich große Augen und fuhr mit der rechten Hand vor seinen Mund. »Jössas! Da darf man natürlich rein überhaupt gar nichts machen. Was für ein Glück, dass sich die Verbrecher immer an die Wochenendruhe halten und extra warten, bis sie von der Exekutive wieder verfolgt werden können.« Der gallige Kommentar ging einher mit einer missbilligenden Miene. Obiltschnig, der haargenau dasselbe wie Popatnig gedacht hatte, entschloss sich zu einem tadelnden Kopfschütteln in die Richtung des Kollegen, während er sich selbst über seinen Opportunismus wunderte.
Dullnig blickte währenddessen auf die Uhr. »Ich hab eine viel bessere Idee«, eröffnete er den beiden, »Sie fahren sofort an den Tatort. Da können Sie sich vor Ort ein Bild machen.« Er schien richtiggehend beglückt über diesen Gedanken. »Ja, so machen wir das. Ich beordere die Tatortgruppe und die KTU noch einmal dorthin, die sollen Ihnen alles erklären.« Obiltschnig und Popatnig wechselten einen eiligen Blick, mit dem sie sich wechselseitig ihres Entsetzens versicherten. Der Tag begann in der Tat eine ungute Wendung zu nehmen.
An Widerspruch war gleichwohl nicht zu denken, und so schickten sie sich ins Unvermeidliche. Nur wenig später durchquerten sie geschichtsträchtigen Kärntner Boden. An Maria Saal vorbei, passierten sie das Zollfeld und ließen den Magdalensberg rechts liegen. Hochosterwitz lag nur rund 20 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt, und so erreichten sie nach einer guten Viertelstunde ihr Fahrziel. Die Einsatzfahrzeuge, die dort geparkt waren, signalisierten ihnen, dass sie bereits erwartet wurden. Popatnig stieg als Erster aus und legte eine beunruhigte Miene an den Tag. »Wir müssen da jetzt aber nicht raufhatschen, oder?« Sein Ton signalisierte ernsthafte Beunruhigung. Der Sankt Veiter Kollege aber beruhigte ihn. »Mit dem Auto kommt man zwar nicht rauf, aber es gibt einen Lift. Mit dem sind Sie in einer Minute oben.« Popatnig folgte dem ausgestreckten Zeigefinger und atmete erleichtert auf. »Ein Wandertag, das hätt’ mir nämlich gerade noch gefehlt«, erläuterte er, ehe er Obiltschnig zum Aufzug folgte.
Im inneren Burghof wurden sie von zwei Männern in den typischen weißen Schutzanzügen empfangen. »Grüß euch, wir haben alles für euch vorbereitet. Viel ist es ja nicht mehr, weil die Leiche schon abtransportiert wurde. Aber wir konnten ja nicht wissen, dass da …« Obiltschnig winkte ab. »Wir auch nicht.« Der ältere KTU-ler ließ seine Zähne sehen. »Wieder so eine glorreiche Idee aus der Zentrale. Warum haben sie nicht gleich euch geschickt, dann wäre es einfacher gewesen.« Obiltschnig zuckte mit den Schultern. »Na ja, in der Früh haben die ja noch nicht gewusst, dass sie auf uns zurückgreifen können.«
Jetzt zeigte sich der Anflug eines Lächelns auf dem Gesicht des Jüngeren. »Ihr seid die zwei mit dieser Stadtratssache in Ferlach, oder?« Popatnig nickte geschmeichelt. »Aha, und wer von euch zwei ist der Sherlock und wer der Watson?« Das Lächeln wandelte sich zu einem abwartenden Grinsen. Obiltschnig aber blieb Herr der Lage. »Er ist Sherlock«, deutete er auf Popatnig, ehe er seinen Finger auf sich selbst richtete, »und ich bin Holmes.« Deutlich sah man ihm die Zufriedenheit über die Replik an, während die Mundwinkel des KTU-lers langsam wieder nach unten wanderten.
Popatnig entging die frostiger gewordene Stimmung nicht. »Wissts was, kommen wir einfach zur Sache. Was habt ihr am Morgen herausgefunden?«
Das Quartett begab sich durch den Museumseingang in eine Art Vorraum, an welchen das Zimmer, in dem der Mord geschehen war, anschloss. Deutlich konnte man noch die Stelle sehen, wo die Leiche gefunden worden war. Rundherum standen noch die kleinen Täfelchen, mit denen die Tatortgruppe Auffälligkeiten markiert hatte. Obiltschnig ließ den Raum auf sich wirken. Ihn erinnerte das Ganze an eine Privatkapelle, denn rechter Hand befand sich eine Art Altar, der aus Bronze oder einem ähnlichen Material gemacht zu sein schien. Davor kniete eine lebensgroße Statue mit üppigem Vollbart in vermeintlicher Eisenrüstung. Amüsiert deutete der Gruppeninspektor auf die Figur. »Wenn der sich in echt da hingekniet hätte, wäre er nie wieder alleine hochgekommen, bei dem Panzer, den er trägt.« Popatnig assistierte augenblicklich. »Ja, da hätte er einen Hebekran gebraucht.« Obiltschnig sah sich weiter um. An den Wänden hingen mehrere Ölgemälde und die Darstellung einer mächtigen Eiche, die wohl den Stammbaum der Familie illustrieren sollte. Von den anderen aufmerksam beäugt, ging Obiltschnig durch die nächste Tür und stellte fest, dass dort zwar eine ebenfalls lebensgroße Frauenfigur und eine Ritterrüstung standen, sonst aber weiter nichts von Relevanz zu erkennen war. Vor allem schien es sich dort um eine Sackgasse zu handeln, denn er konnte auf den ersten Blick keine weitere Tür erkennen, die etwa in den Haupttrakt, den ehemaligen Palas, geführt hätte.
»Wie ihr seht, haben wir eigentlich gar nicht so viel. Den Spuren nach zu urteilen, eine regelrechte Hinrichtung.« Der Ältere unterbrach Obiltschnigs Meditation und zeigte auf den Fußboden. »Da kann man erkennen, wie weit das Blut gespritzt ist. Aber klar, so etwas passiert, wenn die Halsschlagader getroffen wird.« Obiltschnig sah sich um. »Hat der Gerichtsmediziner eine Schätzung abgegeben, wann die Tat begangen wurde?« Er erntete ratlose Gesichter. »Irgendwann zwischen zehn Uhr abends und 4 Uhr früh, hat er gesagt. Aber das heißt alles und nichts, würde ich einmal meinen«, antwortete der Ältere.
»Ist der Raum öffentlich zugänglich? Ich meine, für gewöhnlich.« Nun übernahm der Jüngere. »Er ist Teil der Museumstour, ja. Aber um die Zeit war natürlich längst alles abgesperrt und gesichert.«
»Das heißt, wer immer da dieses grausame Werk verrichtete, hat sich illegal Zutritt verschafft und es außerdem verstanden, die Alarmanlage auszuschalten.« Diesmal gab es ein doppeltes Nicken als Reaktion.
»Gibt es noch andere Zugänge als den, durch den wir gekommen sind?«, wollte nun Popatnig wissen. »Am Ende dieses Traktes, so ungefähr fünf Räume weiter, ist der Ausgang, der genauso gestaltet ist wie der Eingang. Von dort kommt man durch den Museumsshop wieder in den Innenhof. Man könnte also, wenn man partout will, pausenlos Runden drehen.«
»Das heißt, der oder die Täter kann sich auch dort hineingeschlichen haben?«
»Wenn du dich da auskennst, dann weißt du wahrscheinlich 100 Wege hierher. Aber ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass die Täter irgendwelche Umwege gemacht haben. Das Opfer war an Händen und Füßen gefesselt, müsst ihr wissen. Also wenn es nicht genau hier überwältigt und anschließend gebunden wurde – worauf allerdings nichts hindeutet –, dann wäre es sehr mühsam gewesen, nicht den direktesten Weg zu wählen.«
»Und wer hat die Leiche gefunden?«, wollte der Gruppeninspektor nun wissen. »Eine Museumsmitarbeiterin, Frau Schwenk. Ihr geht’s nicht so gut, wie ihr euch vorstellen könnt«, klärte ihn der Jüngere auf. »Aber sie sitzt drüben im Restaurant und erholt sich von dem Schock.«
Obiltschnig gab Popatnig ein Zeichen, und sie verließen, die beiden KTU-ler im Schlepptau, das Museum. Sie überquerten den Burghof, stiegen einige Stufen hinauf und fanden den Eingang zum Restaurant, das, so vermutete Obiltschnig, einst der Rittersaal gewesen war. Dort saß einsam und allein an einem Tisch eine aparte Mittvierzigerin mit pechschwarzem Haar, die stumm vor sich hinstarrte. Erst als sie die Männer auf sich zukommen sah, blickte sie auf.
»Ich begrüße Sie, Gnädigste«, begann der Gruppeninspektor höflich, »wie ich gehört habe, waren Sie es, die heute den Toten gefunden hat. Darf ich Ihnen dazu ein paar Fragen stellen?« Sie nickte matt, begann zeitgleich aber merklich zu zittern.
»Können Sie mir sagen, was Sie am Morgen genau gemacht haben?« Sie schniefte kurz und straffte sich dabei. »Alles war wie immer. Ich bin zur üblichen Zeit hier gewesen und habe die Türen geöffnet. Zuerst den Eingang natürlich. Dann bin ich nach links gegangen, quer durch die ganze Zimmerflucht, und habe hinten auch den Ausgang aufgesperrt. Dann bin ich wieder zurück und wollte mir eigentlich in der Burgküche einen Kaffee holen. Und plötzlich sehe ich im vorletzten Zimmer etwas glitzern. Das ist mir natürlich verdächtig vorgekommen, und so habe ich Nachschau gehalten …« Sie begann heftig zu atmen, und deutlich konnte man ihr anmerken, dass sie die Erinnerung an das Erlebte mitnahm.
»Das heißt, als Sie heute hier eingetroffen sind, war alles ordnungsgemäß versperrt?« Die Schwenk nickte. »Ja, wie gesagt, alles wie immer. Wir haben gestern kurz nach 18 Uhr den üblichen Kontrollgang gemacht, ob sich niemand versteckt hat oder ob noch irgendwo irgendetwas herumliegt«, sie sah den Gruppeninspektor direkt an. »Sie ahnen ja gar nicht, was für seltsame Gestalten wir hier manchmal auf der Burg haben. Die marschieren da durch, als wäre es Disneyland. Und dabei haben sie irgendein Snickers oder ein Mars mit, und weil sie keinen Papierkorb sehen, schmeißen sie die Verpackung dann einfach in ein Eck. Und Ecken haben wir hier viele. Vor allem oben am Dachboden, wo die Ahnengalerie ist.«
»Auf den Dachboden kommt man wie?«
»Über eine Wendeltreppe. Die ist vom Eingang aus zwei Zimmer weiter«, erklärte sie. »Und das ist der einzige Zugang?« Sie bestätigte diese Vermutung. »Kommt man außer durch die beiden Türen sonst noch irgendwie in den Museumsbereich?« Schwenk streckte ihren Arm aus. »Da gibt es eine Verbindungstür, die vom Restaurantbereich in den Museumsteil führt. Früher war das hier die alte Burg, und der Teil, wo sie die … den Mann gefunden haben, der wurde ja erst später errichtet. Im Auftrag von Georg Khevenhüller. Das ist der Mann, dessen Figur vor dem Altar kniet. Der hat auch die 14 Tore auf dem Weg hierher errichten lassen«, fügte sie, ganz Museumsmitarbeiterin, hinzu.
»Das heißt, theoretisch hätte man sich auch von hier aus Zutritt zum Museum verschaffen können?«, präzisierte Obiltschnig. »Ja, aber es wäre unvergleichlich komplizierter«, brachte Schwenk die Dinge auf den Punkt.« Obiltschnig drehte sich einmal um die eigene Achse und richtete sein Gesicht dann wieder auf die Schwenk aus. »Halten Sie es für möglich, dass sich Opfer und Täter hier irgendwo versteckt hielten. Gestern, meine ich.«
Sie zuckte mit den Achseln. »Das weiß ich natürlich nicht. Aber es erscheint mir die einzige Lösung zu sein. Hier gibt es Hunderte Ecken, wo man unter Garantie nicht gefunden wird, wenn man das so will. Sie sehen ja, überall Mauern, Nischen, Erker. Wir bräuchten wahrscheinlich 100 Mitarbeiter, um am Abend, bevor die Burg abgesperrt wird, alle Winkel zu kontrollieren. Das ist praktisch unmöglich.«
Obiltschnig signalisierte, dass er verstanden hatte. »Außerdem«, fuhr die Schwenk fort, »klingt die Alternative so abenteuerlich, dass ich sie schlicht für unmöglich halte.«
»Wie meinen Sie das«, mischte sich Popatnig ein.
»Sie haben ja gerade selbst gemerkt, wie kompliziert es ist, hierher zu gelangen. Sie müssen zuerst den Lift nehmen. Dann das halbe Vorwerk entlang zum Eingangstor in den Innenhof. Da haben sie dann linker Hand relativ schnell den Eingang zum Museum. Warum also sollten sie zum Restaurant weitergehen, die Stufen da herauf überwinden und auf der anderen Seite dieses Saales wieder hinunterklettern? Das klingt für mich nicht logisch. Außerdem ist es wohl einfacher, eine Tür zu knacken anstelle von einem halben Dutzend.«
»Apropos. Das führt mich zur nächsten Frage. Wer hat hier aller einen Schlüssel – und wofür?«
Schwenk brauchte eine Weile, um die etwas vertrackt vorgebrachte Frage voll einordnen zu können. »Abgesehen von den Besitzern hat eigentlich nur unser Chef einen Generalschlüssel. Die einzelnen Mitarbeiter verfügen jeweils nur über die Schlüssel zu den ihnen zugewiesenen Bereichen. Ich zum Beispiel habe nur diesen einen für die beiden Museumstüren.« Dabei hob sie ein überaus klobiges Teil hoch, das Obiltschnig an ein Schaustück in einer Schlosserei erinnerte. »Das heißt, selbst wenn ich es wollte«, verdeutlichte Schwenk ihre Erklärung, »käme ich nicht über das Restaurant ins Museum, weil mir dafür die Schlüssel fehlen.«
Der Gruppeninspektor war immer noch von dem riesigen Metallteil fasziniert. »Der sieht ziemlich beeindruckend aus«, merkte er an. »Aber er ist sicher auch leicht nachzumachen«, mutmaßte der ältere KTU-ler. »Ein Profi schafft dir damit in ein paar Minuten ein Duplikat.« Obiltschnig sah zuerst den Kollegen, dann die Schwenk an. »Wäre das möglich?« Die war überfragt. »Ich wüsste nicht, dass uns irgendwann ein Schlüssel abhandengekommen wäre. Aber bitte, wenn es jemand darauf anlegt, dann kann er wahrscheinlich kurzfristig einen entwenden und tatsächlich nachmachen. Wir sind eine Burg und nicht Fort Knox.«
»Verstehen Sie die folgende Frage bitte nicht falsch. Sie ist reine Routine und soll uns nur helfen, die Dinge besser zu begreifen. Halten Sie es für möglich, dass einer Ihrer Kollegen oder eine Kollegin …« Die Schwenk hob sofort abwehrend ihre Hände. »Ausgeschlossen. Wir sind hier eine eingeschworene Gemeinschaft und arbeiten seit vielen Jahren als ein Team zusammen. Da würde ich für jeden Einzelnen die Hand ins Feuer legen. Außerdem«, erinnerte sie an das zuvor Gesagte, »haben nur die Gerti, der Gilli und ich Schlüssel für das Museum. Also wenn man nicht an die beiden Sätze Generalschlüssel herankommt, müsste man einen von uns dreien beklaut haben. Und das bezweifle ich sehr.«
»Gut«, bilanzierte Obiltschnig, »das wär’s auch schon fürs Erste. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Frau Schwenk. Ich hoffe, Sie haben jemanden, der sich um Sie kümmert?« Die Mitarbeiterin nickte. »Ja, mein Mann holt mich gleich ab. Der Chef hat mir nach diesem Erlebnis für heute freigegeben.«
Die vier verabschiedeten sich von der Schwenk und kehrten in den Burghof zurück. »Also mir ist die Sache zu hoch«, gestand Popatnig. »Ich meine, es muss eine absolute Heidenarbeit sein, ein Opfer von außen auf die Burg zu bringen. Dazu wären wahrscheinlich mehrere Täter vonnöten. Allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, welches Opfer freiwillig mit seinem Mörder hier darauf wartet, bis sie ungestört sind.«
»Vielleicht wollten sie zu zweit das Museum ausrauben, und dann wollte einer nicht teilen?«, stellte der jüngere KTU-ler eine These in den Raum. »Und die Tatwaffe stammt aus Museumsbeständen«, ergänzte er.
»Das haben wir eigentlich schon ausgeschlossen«, wandte der Ältere ein. »Laut Schwenk fehlt nämlich nichts von den Exponaten. Wenn eines der hier ausgestellten Schwerter die Tatwaffe wäre, dann hätte der Mörder sie anschließend retourniert. Und dann hätten wir sie anhand von entsprechenden Blutspuren sofort entdeckt.«