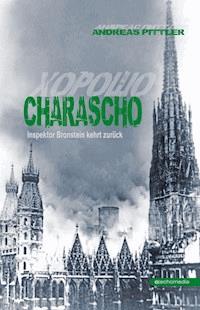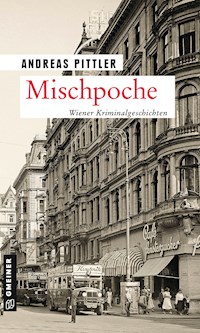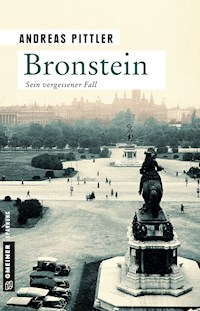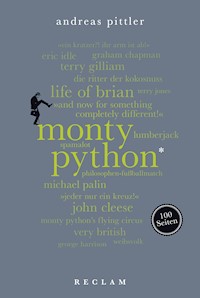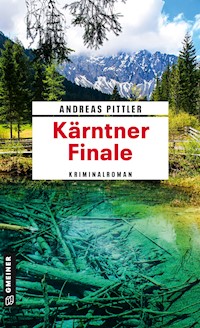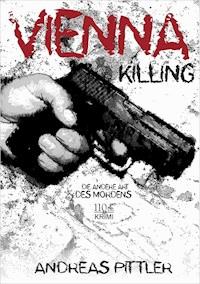Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Wien, die Stadt von Stephansdom, Hofburg und Schloss Schönbrunn. Bei Pittler sind die Sehenswürdigkeiten der Donaumetropole Schauplatz kniffliger Kriminalfälle. Und die Leser sollten Pittlers Inspektor genau über die Schulter sehen - denn die Hälfte der 14 Geschichten ist wahr, die andere Hälfte erfunden. Bloß welche?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Pittler
Wiener Bagage
14 Wiener Kriminalgeschichten
Zum Buch
Wiens dunkle Seite Stephansdom, Hofburg, Schloss Schönbrunn – selbst das malerischste Gebäude ist nicht davor gefeit, zum Tatort eines Verbrechens zu werden, und so rückt Inspektor Bronstein von der Wiener Mordkommission ein ums andere Mal aus, um vor glanzvoller Kulisse den Tätern zu Leibe zu rücken. Doch nur die Hälfte der historischen Geschichten basiert auf einer wahren Begebenheit, die andere Hälfte ist frei erfunden, was der Leserschaft Gelegenheit bietet, selbst zum Detektiv zu werden. Im Anhang findet sich schließlich die Lösung, gemeinsam mit touristischen Erläuterungen zu den diversen Sehenswürdigkeiten der Donaumetropole. Spannung, Rätselspaß und City-Guide, vor allem aber eine vergnügliche Lektüre.
Andreas Pittler, geboren 1964, studierte Geschichte und Politikwissenschaft (Magister und Doktor phil.). Ursprünglich als Journalist tätig, wandte er sich im 21. Jahrhundert vermehrt der Belletristik zu und veröffentlichte seit dem Jahr 2000 insgesamt 23 Romane. Seine Werke landen regelmäßig auf den österreichischen Bestsellerlisten und wurden bislang in acht Sprachen übersetzt. In seiner ursprünglichen Profession als Historiker ist er regelmäßig als Experte im Österreichischen Rundfunk zu Gast. Für sein literarisches Wirken erhielt er 2006 das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, 2016 wurde ihm vom österreichischen Bundespräsidenten der Berufstitel »Professor« verliehen.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Seitenangaben in diesem Buch beziehen sich auf die Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Imagno / Getty Images
ISBN 978-3-8392-4536-1
Tödliche Eifersucht
I.
»Was ist denn mit Ihnen los, Bronstein? Wieso sind Sie immer noch im Amt? Haben Sie kein Privatleben, oder wie seh’ ich das!« Bronstein sah verwirrt von seinen Akten auf und blickte direkt in die blauen Augen seines Vorgesetzten. »Äh, wie bitte?«
»Na ich bitt Sie, Bronstein, irgendein Pläsier werden S’ doch haben! Wenn schon nicht Frau und Kind daheim warten, dann vielleicht die alten Herren Ihrer Verbindung in der Bierklinik. Oder wenigstens der Briefmarkensammlerverein im Kaffeehaus. Irgendwo muss doch der Beamte in Ihnen enden und der Mensch beginnen.«
Bronstein blies gepresst Luft aus. »Wie Sie wissen, bin ich ledig und habe keine Kinder. Ich war nie in einer Studentenverbindung, und Briefmarken sammle ich auch keine mehr, seit ich die Blaue Mauritius habe.«
Die Augen des Vorgesetzten sprangen schier aus den Höhlen. Doch noch ehe er seine logische nächste Frage aussprach, dämmerte ihm, dass Bronstein gerade einen Witz gemacht hatte. Die Miene wandelte sich von Erstaunen zu Mitleid. »Bronstein, Bronstein! Bei mir sind Ihre Witzchen fehl am Platz. Die holde Weiblichkeit müssen S’ umgarnen damit. Sie sind 43, Mensch! Wann wollen S’ denn endlich zu leben anfangen?«
Eigentlich wollte Bronstein diese Worte souverän abschmettern, doch irgendetwas in ihm hielt ihn zurück. Eigentlich hatte der Chef ja recht. Ohne, dass er es gemerkt hätte, war er alt geworden. Das Leben zog an ihm vorbei. Seit Jahr und Tag bestand das Sein für ihn nur aus Aufstehen, zur Arbeit Gehen, Heimgehen und Schlafengehen. Wären alle Wiener wie er, Nachtlokalbesitzer, Kabarettisten, Theaterdirektoren und Kinobetreiber könnten umgehend Konkurs anmelden. Ohne es zu wollen, seufzte er.
»Schau’n S’, Bronstein. Ich geh jetzt ins Theater. Da entspannt man sich, tut etwas für seine Bildung, und unterhalten tut man sich auch. Schau’n S’ doch, dass Sie wieder einmal unter die Leut’ kommen, Bronstein! Sonst sind S’ am End genauso verstaubt wie Ihre Akten.«
»Ich werde Ihren Rat beherzigen, Herr Hofrat«, quälte sich Bronstein ab, während sein Chef mit einem nonchalanten »Machen S’ das, Bronstein, machen S’ das« seiner Wege zog.
II.
Was hatte er sich da wieder aufschwatzen lassen? Bronstein stöhnte still in sich hinein, ehe er wieder auf die Opernkarten blickte. Gleich am Morgen war der Hofrat bei ihm im Zimmer angetanzt und hatte ihm zwei Billetts für die Aufführung von Rigoletto am selben Abend auf den Tisch gelegt. »Meine Frau ist unpässlich, und ich muss ohnehin mit dem Herrn Präsidenten soupieren. Also ist das die willkommene Gelegenheit für Sie, endlich einmal wieder etwas Kulturluft zu schnuppern. Gehen S’ ruhig! Ist eine gute Oper. Verdi. Da ist immer etwas los. Und die Titelpartie wird von diesem jungen Rumänen gesungen, von dem alle sagen, er ist der neue Caruso. Der soll noch besser sein als der Kiepura.«
Natürlich sagte der Name Traian Grozavescu Bronstein rein gar nichts. Auch Jan Kiepura war ihm völlig unbekannt, und Caruso bedeutete ihm kaum mehr als ein fernes, fernes Klingeln in den hintersten Bereichen seines Gehirns, welches ein »da war doch was« umschrieb. Ja, er wusste nicht einmal, worum es in Rigoletto überhaupt ging.
»Nehmen S’ Ihnen ein fesches Mäderl mit, das können S’ mit den Karten da beeindrucken!«
»Aber Herr Hofrat, ich wüsste nicht, wen …«
»Ach papperlapapp! Die kleine Doleschal von der Registratur, die schaut Sie doch eh immer so sehnsüchtig an. Ich bin mir sicher, die sagt Ja, noch bevor Sie sie gefragt haben.« Bronstein bemühte vergeblich die Schatztruhen seines Gedächtnisses. Eine Doleschal kam da nicht vor. »Wer soll denn das sein? Die hagere Brünette? Die üppige Blondine? Die blade Schwarze?«
»Bronstein, wie reden S’ denn daher! Ich muss doch sehr bitten! So spricht man doch nicht über Damen. Obwohl, zugegeben, die Bruckner is scho ziemlich blad. Aber die is ja auch keine Dame, bitte schön. Na, na, die Doleschal. Das ist die Brünette mit den sinnlichen Lippen. Ich geb schon zu, ihr fehlt’s a bisserl an dem, was Männer wild macht, aber Sie sollen ja mit ihr auch in die Oper und ned ins Separee. Alsdern, Bronstein, fragen Sie sie. Sie wird ned Nein sagen.«
»Aber …«
»Sagen S’ jetzt nur ned, Sie haben heut Abend schon was vor, weil sonst werd’ ich fuchtig! Wissen S’ was, Bronstein, das is eine Weisung.« Der Hofrat grinste breit, und Bronstein konnte nur noch nicken.
In der Mittagspause nahm er all seinen Mut zusammen. Er trank noch schnell einen Slibowitz, dann nahm er einen alten Akt, der schon lange auf Pokornys Schreibtisch verschimmelte, und ging unsicheren Schritts in die Registratur.
»Na so was, der fesche Herr Major Bronstein! Beehrt mich da mitten am helllichten Tag! Sie sind mir aber ein ganz Forscher. So schamlos die weibliche Schwäche ausnützen, das hamma schon gern.«
»Äh …«
»Sie kommen sicher wegen dem Akt, gell. Ich kenn aber einen viel besseren Akt. Soll ich Ihnen den zeigen, Herr Major? Soll ich?«
»Können S’ bitte ihre Bluse geschlossen halten, Frau Bruckner. Das wär’ echt zuvorkommend von Ihnen. Und den Akt habe ich, wie Sie vielleicht bemerkt haben, in der Hand und ned vor meiner Brust. Da suchen S’ also vergeblich nach ihm.«
Augenblicklich war das maliziöse Lächeln im Gesicht der Bruckner verschwunden. »Dann halt ned, depperter Itzig«, murmelte sie, während sie sich umdrehte. Bronstein hatte die Worte dennoch deutlich gehört. Er überlegte, ob und wie er regieren sollte, als plötzlich das Fräulein Doleschal den Raum betrat. »Da bin ich wieder, Sissi …, oh, der Herr Major Bronstein. Schönen guten Tag zu wünschen.«
»Bemüh dich ned. Der is stocksteif wie ein Stockfisch. Und ned an der richtigen Stell’, wennst mich fragst.«
Bronstein sah die Doleschal erstmals mit anderen Augen, als sie ob der herabsetzenden Aussage der Bruckner hold errötete. Sie blickte betreten zu Boden und scharrte verlegen mit den Füßen. »Fräulein Doleschal«, hörte sich Bronstein in die Stille sagen, »die Freude ist ganz meinerseits. Ob ich Sie vielleicht auf ein Wort unter vier Augen …« Dabei fixierte er die Bruckner, als wäre sie eine zum Angriff bereite Giftschlange. »Hab’ schon verstanden«, grollte diese und trollte sich. »Was wünschen Sie denn, Herr Major?«, fragte die Doleschal kaum hörbar.
»Ich hab’ da ein kleines Problem. Ich hab’ für heute Abend zwei Opernkarten, hab’ aber noch keine Begleitung. Ich mein’, ich hoff’, Sie versteh’n das jetzt nicht falsch … meine diesbezügliche Anfrage ist vollkommen honetter Art, und ich frag’ auch nur, weil man mir gesagt hat, dass Sie gern in die Oper geh’n … also … was ich sagen … äh fragen will, ist, ob Sie vielleicht …«
»Heute spielen sie ›Rigoletto‹«, hauchte die Doleschal ganz vergeistigt. »So eine wunderbare Oper. Ja, die tät ich sehr gern seh’n, Herr Major. Und natürlich weiß ich, dass dieses Angebot keineswegs anzüglich gemeint ist. Sie sind schließlich als absoluter Ehrenmann im ganzen Haus bekannt.«
Ohne es zu wollen, schlug Bronstein die Hacken zusammen und verbeugte sich dabei leicht. »Dann darf ich das gnädige Fräulein heute um halb sieben abholen?«
Die Doleschal kicherte verlegen. »Ja, das dürfen S’, Herr Major.«
»Bedanke mich höflichst. Man sieht sich!« Bronstein war ob der Doleschalschen Zusage ganz flau im Magen geworden. Er spürte, wie seine Beine zu zittern begannen, und so wollte er nur noch so rasch als möglich aus dem Zimmer fliehen. Er verbeugte sich, drehte sich um und strebte der Tür zu.
»Herr Major?«
Das war ja zu befürchten gewesen. Natürlich würde sie absagen. Was sollte eine junge Frau auch mit ihm alten Deppen in der Oper. Seine Frage hatte sie überfahren, und deshalb war es ihr nicht gleich möglich gewesen, nein zu sagen. Das aber würde sie jetzt nachholen. Er hielt sich krampfhaft an der Türschnalle fest und drehte seinen Kopf leicht nach hinten.
»Ja?«
»Wäre es nicht hilfreich, wenn Sie wüssten, wo ich überhaupt wohne? Oder haben S’ schon das zentrale Melderegister nach mir durchforscht?«
Ach, er hasste die Frauen! Dass sie immer so überlegen sein mussten! Jetzt saß er in der Patsche. Würde er behaupten, er kenne die Adresse, dann würde sie ihn für einen Unhold halten, der ihr bereits heimlich nachstellte. Gab er aber zu, die Adresse nicht zu kennen, dann war sie sicher der Ansicht, er interessiere sich ohnehin nicht für sie.
»Operngasse 14. Im vierten Bezirk. Gar nicht weit von der Oper, sehen S’.«
Vielleicht war die Doleschal doch nicht so böse. Sie hatte ihn eben vom Haken gelassen, ohne dass er sich irgendeine Blöße hatte geben müssen. Das sprach für sie, fand er. Er bemühte sich um ein freundliches Lächeln. »Danke schön«, flüsterte er, »bis heute Abend dann.«
»Ja, bis heute Abend.«
III.
Die Operngasse 14, so fand er heraus, lag schief gegenüber des Café ›Museum‹ an der Ecke zur Elisabethstraße, in welcher wiederum das ›Smutny‹ beheimatet war, in dem er besonders gerne verkehrte. Allerdings wusste er deswegen noch nicht, ob das Fräulein Doleschal dort alleine wohnte! Sollte er Blumen mitbringen? Für die Frau Mama zum Beispiel, falls sie mit ihren 25 Jahren noch bei den Eltern wohnte. Oder würde das schon wieder genau jene Nähe insinuieren, die es ja eigentlich zu vermeiden galt? Und was, wenn sie doch alleine wohnte? Dann waren die Blumen ohnehin ein Fehlgriff. Ach, wenn er bloß jemanden hätte, den er in solchen Angelegenheiten um Rat fragen könnte.
Wenige Minuten vor 18 Uhr fühlte sich Bronstein, als hätte er im Casino gewonnen. Am Weg durch die Margaretenstraße war er doch glatt an diesem Grammophon-Geschäft vorbeigekommen, wo man ausgerechnet eine Schellackpressung von ›La Donna e mobile‹, gesungen vom großen Meister Caruso persönlich, für wenige Schilling angeboten hatte. Mit einem solchen Geschenk, so befand er, lag er in jedem Fall richtig.
Er legte die wenigen Meter zu Doleschals Wohnhaus fast im Laufschritt zurück, besah sich das Parteienverzeichnis und klopfte schließlich an die entsprechende Tür. Als hätte sie hinter selbiger gewartet, öffnete Doleschal die Pforte, noch ehe Bronstein seine Hand wieder an der Hosennaht hatte. »Guten Abend, gnädiges Fräulein. Äh, das wäre nachher für Sie. Quasi als Erinnerung für den heutigen Abend.« Mit einer ungelenken Bewegung drückte er ihr die Platte in die Hand. Die Doleschal strahlte. »Caruso ist halt doch der Beste. Obwohl der Grozavescu wirklich ganz große Klasse sein soll. Na, davon werden wir uns ja in Kürze persönlich ein Bild machen können. Wollen wir?«
»Unbedingt.«
Die wenigen Meter zur Oper legte Bronstein schweigend zurück. Die Doleschal redete dafür umso mehr. Sie erklärte ihm, dass Rigoletto der Hofnarr des Herzogs von Mantua sei, der wiederum Rigolettos Tochter verführe und entehre, woraufhin Rigoletto die Ermordung des Herzogs plane. Rigolettos Tochter aber verliebe sich in den Herzog und opfere sich für diesen, sodass Rigoletto am Ende statt des toten Herzogs die sterbende Tochter vor sich habe. »Womit sich Rigolettos Fluch auf grausige Art erfüllt«, schloss sie ihre Erzählung.
»Danke, gnädiges Fräulein. Jetzt weiß ich wenigstens, worum es da geht. Ich kann ja kein Italienisch, da hätt’ ich kein Wort verstanden. Jetzt aber bin ich im Bilde.« Dabei lächelte er sphingenhaft, was der Doleschal nicht entging.
»Was denken S’ denn g’rad?«, fragte sie.
»Na ja, der Rigoletto ist schuldig nach Paragraph 5 in Verbindung mit den Paragraphen 134 und 135 StG, Anstiftung zum Mord, und der Herzog ist schuldig nach Paragraph 128 StG, Schändung einer Minderjährigen. Jetzt ist das Ganze für mich auch dienstliche Fortbildung und nicht nur kultureller Genuss.«
Doleschal sah geradeaus und sagte nichts. Der Scherz, so musste er sich eingestehen, war ein Rohrkrepierer gewesen. Aber das passte vielleicht durchaus zum bevorstehenden Abend. ›Rigoletto‹ war ja offensichtlich auch eine Tragödie, und die Architekten des Opernhauses hatten gleichfalls kein gutes Ende genommen. Soweit Bronstein sich entsann, war der eine dem Wahnsinn verfallen, während sich der andere selbst entleibt hatte.
Doch all das zählte nicht mehr, als er den schüchternen jungen Rumänen erblickte, der den Rigoletto spielte. Bronstein hätte niemals geglaubt, dass ihn eine Stimme, zumal eine männliche, so zu fesseln vermochte. Er wurde von einer tiefen Traurigkeit umfangen, als die Vorstellung zu Ende war. Und er beschloss, künftighin öfter in die Oper zu gehen, insbesondere, wenn dieser Grozavescu auf der Bühne stand. Dass die Doleschal seine Ansicht am Heimweg teilte, fand er dabei durchaus erfreulich, denn sie hatte sich als überaus charmante Begleitung entpuppt. Wer weiß, dachte Bronstein, als er seiner Wohnung zustrebte, vielleicht bahnte sich da ja etwas an. Gleich darauf schalt er sich selbst für seinen völlig unbegründeten Optimismus. Und während er die Treppe emporstieg, ertappte er sich dabei, wie er »Oh wie so trügerisch, sind Frauenherzen« trällerte.
IV.
Als Bronstein am nächsten Morgen den Weg zum Büro einschlug, musste er immer noch an die Doleschal denken. Sie hatte zwar mehr von Grozavescu geschwärmt, doch vielleicht lag gerade darin eine Möglichkeit, ihr eine Gefälligkeit zu erweisen. Aus alter Routine heraus wusste er, dass Opernsänger am Vormittag immer Probe hatten, und so beschloss er kurzerhand, den Rumänen abzufangen und ihn um ein Autogramm für das Fräulein Doleschal zu bitten. Üblicherweise waren diese Künstler doch allesamt eitle Gesellen, sodass sie sich stets geschmeichelt fühlten, wenn man sie bat, ihren Namenszug irgendwohin zu setzen. Mit diesem Präsent gedachte Bronstein sodann, sich in die Registratur zu begeben. Ihm gefiel sein Plan ausnehmend gut, und so sagte er Pokorny, er solle die Stellung halten, denn er, Bronstein, habe eine Besorgung zu erledigen.
Für einen Polizisten war es eine Leichtigkeit, in den Künstlerbereich vorzudringen. Sicher, objektiv beging er Amtsmissbrauch, als er am Eingang die Kokarde hob und erklärte, er müsse Grozavescu sprechen, doch derartige kleine Manöver fielen schlimmstenfalls unter »Kavaliersdelikt«. Jedenfalls verfehlte seine Legitimation nicht die erhoffte Wirkung. Der Portier griff umgehend zum Telefon und schickte sich an, Bronstein zu melden. Dann aber folgten ein ernstes Gesicht und ein längeres Schweigen. Der Portier legte auf und richtete seinen Blick auf den Major. »Der Herr Grozavescu ist heute entgegen seinen Gepflogenheiten nicht bei der Probe erschienen.«
»Mein Gott, es wird doch nicht am Ende etwas Ernstes sein?«
»Mit Verlaub, Herr Inspektor, das glaube ich nicht. Der Herr Grozavescu hat ein Gastspiel in Berlin, und soviel ich gehört habe, reist er heute Abend dorthin ab. Vielleicht ist er also einfach zu Hause geblieben, um zu packen.«
Bronstein bemühte sich, seine Enttäuschung zu verbergen. Dann folgte er einer spontanen Eingebung. »Und zu Hause wäre dann wo?«
»Aber Herr Inspektor. Das darf ich Ihnen doch gar nicht sagen.«
»Ich bin die Polizei. Mir dürfen Sie nicht alles sagen, mir müssen Sie alles sagen«, versuchte es Bronstein mit einem gerüttelt Maß an Autorität. Dabei starrte er den Portier mit zusammengekniffenen Augen an, sodass dieser tatsächlich zu transpirieren begann.
»Lerchenfelder Straße 62«, sagte er knapp.
»Na bitte«, schnalzte Bronstein mit der Zunge, »geht doch.«
Mit federndem Schritt legte er die wenigen Meter zur Zweierlinie zurück, auf welcher er dann zügig bis zur Lerchenfelder Straße marschierte. Dort angekommen bog er links ab und hielt nun auf den Gürtel zu. Gute zehn Minuten später hatte er das Haus erreicht, in dem der Sänger wohnte. Er öffnete das Portal, warf wieder einmal einen Blick auf das Parteienverzeichnis und suchte sodann die entsprechende Wohnung auf.
Zu diesem Zeitpunkt kamen ihm erstmals Zweifel über sein Tun. Konnte er, ein kleiner Kieberer, einfach so einen großen Künstler zu Hause überfallen, um diesen um eine persönliche Gefälligkeit zu bitten? Doch, so fand er, wo er schon so weit gegangen war – buchstäblich –, sollte er die Sache auch zu Ende bringen. Er atmete tief durch und klopfte dann an.
Eine erstaunt dreinblickende Frau öffnete ihm. Er beschloss, sich mit seiner Dienstmarke zu legitimieren, um nicht als gewöhnlicher Verehrer dazustehen, und fragte dann, ob der Hausherr zugegen sei. Dies schien die Frau nur noch mehr zu verwirren. »Aber der ist doch in der Oper …«, kam es schleppend aus ihrem Munde.
Bronstein wollte bereits dazu ansetzen, der Frau auseinanderzusetzen, dass er eben von dort komme, den Künstler jedoch nicht angetroffen habe. Doch irgendetwas riet ihm, den Satz ungesagt zu lassen. Wenn Grozavescu seiner Frau erklärt habe, er gehe in die Oper, dies dann aber unterlassen hatte, so gab es dafür wohl Gründe, die ihn, Bronstein, nun einmal gar nichts angingen. Es war schon dreist genug, einen Opernsänger zu Hause aufzusuchen, um ein Autogramm von ihm zu erhalten, hernach aber auch noch eine Ehekrise zu provozieren, überspannte fraglos jeden Bogen. »Ach so«, meinte er daher, »richtig. Natürlich. Na dann frag ich einmal dort nach.«
Er schickte sich an zu gehen, doch die Frau hielt ihn zurück. »Ist leicht was mit ihm? Sagen Sie es mir. Bitte! Treibt er sich mit einer anderen herum?« Na bitte, die Ehekrise war schon da. »Nein nein, Gnädigste. Es handelt sich um eine reine Routineangelegenheit, die Ihren Herrn Gatten nur als Auskunftsperson betrifft.«
Bronstein war direkt stolz auf seine Formulierung. Ganz streng genommen war die Aussage nicht einmal gelogen. Bevor er sich jedoch endgültig in Widersprüche verhedderte, war es besser, das Weite zu suchen. Er empfahl sich und ging auf direktem Wege zurück ins Amt. Die Doleschal musste vorerst auf ihr Autogramm warten, entschied Bronstein, was ihr umso leichter fallen mochte, als sie ja nicht wusste, dass sich Bronstein um ein solches bemüht hatte.
V.
Doch irgendwie kam er von der Vorstellung, Doleschal just den authentischen Schriftzug des Rumänen zu besorgen, nicht los. Bis zur Mittagspause und auch noch danach saß er an seinem Schreibtisch und starrte dieselbe Berichtsseite an, ohne deren Inhalt in sich aufnehmen zu können. Er blickte auf die Uhr. Es ging auf zwei zu. Wenn er jetzt losmarschierte, so dachte er, könnte er Grozavescu beim Packen überraschen, ihm das Autogramm abluchsen und im Amt zurücksein, bevor die Doleschal Dienstschluss hatte.
Gesagt, getan. »Pokorny, ich muss noch einmal weg. Ich weiß nicht, wann ich zurück bin. Halt die Stellung, ja!« Der Alte nickte nur, setzte dann zu einer Replik an, die Bronstein durch ein rasches Schließen der Zimmertür unterband. Diesmal lief er den Ring in entgegengesetzter Richtung entlang, ehe er beim Parlament rechts abbog. Erneut verschaffte er sich Zugang zu Grozavescus Wohnhaus, vermied diesmal aber, sich bemerkbar zu machen, sondern lauschte erst einmal an der Tür, ob er Stimmen vernahm. Doch drinnen war alles ruhig. Der Sänger befand sich also noch nicht wieder in den eigenen vier Wänden. Bronstein verließ das Haus und setzte sich in das benachbarte Café, von wo aus er einen direkten Blick auf das Haustor hatte. Egal, von welcher Seite Grozavescu kam – und dass er kommen musste, schien ja angesichts der geplanten Berlin-Reise außer Zweifel zu stehen –, Bronstein würde ihn sehen und ihm danach folgen können.
Zwei Schalen Gold und sieben Zigaretten später wurde Bronstein aus seinem Grübeln gerissen. Deutlich und unverkennbar schritt der Orpheusjünger die Straße herauf und verschwand Augenblicke später in seinem Haustor. Bronstein zahlte eilig, überquerte die Fahrbahn und heftete sich an Grozavescus Fersen. Kurz überlegte er, den Rumänen noch im Stiegenhaus anzusprechen, doch dieser Plan wurde vom Sänger vereitelt, der seine Wohnung zu schnell für Bronstein erreicht hatte, der nun abermals vor der verschlossenen Tür stand. Und neuerlich lauschte.
Was drang da für ein merkwürdiger Lärm an sein Ohr? Spitze, schrille Schreie der Dame des Hauses! Doch sie klangen nicht verängstigt. Nein, viel eher vorwurfsvoll. Keine Frage, die Dame war tatsächlich eifersüchtig! Bronstein konnte nicht verstehen, was genau gesagt wurde, doch es bestand kein Zweifel daran, dass die Gattin dem Ehemann bittere Vorhaltungen machte und der sich rechtfertigte.
Streitereien in den eigenen vier Wänden waren die denkbar schlechteste Voraussetzung, jemandem ein Autogramm zu entlocken. Bronstein seufzte kurz und drehte sich um. Zumindest vorerst musste das Fräulein Doleschal auf die kostbare Signatur verzichten. Nun ja, ein andermal vielleicht, tröstete sich Bronstein und setzte sich in Bewegung. Er war am Treppenabsatz angelangt, als er einen lauten Knall hörte. Er war zu erfahren, um sich einreden zu können, da sei irgendwo eine Tür zugefallen oder eine Fehlzündung eines Motors erfolgt. Nein, das war eindeutig ein Schuss gewesen! Und seine Erkenntnis wurde durch ein dumpfes Geräusch verstärkt. Der Körper eines getroffenen Menschen, der zu Boden gefallen war.
Ohne zu zögern, eilte er zurück zur Wohnungstür. Die wurde auch schon aufgerissen, und die Ehefrau stand mit irrem Blick vor ihm. Überraschenderweise erkannte sie in ihm sofort den Polizisten vom Vormittag. »Verurteilen Sie mich, ich habe ihn erschossen«, sagte sie tonlos.
Bronstein drängte die Frau zurück in die Wohnung und eilte, sie am Arm festhaltend, in den Salon. Dort lag Grozavescu mit seltsam überraschtem Gesichtsausdruck am Perserteppich, der sich immer mehr mit Blut vollsaugte. Die Frau immer noch festhaltend, eilte er zu der reglosen Gestalt, ging dort in die Knie, was dazu führte, dass die Schützin beinahe umgefallen wäre, und fühlte mit der freien Hand den Puls. Nichts!
»Um Gottes willen, was ist denn da los?« Unbemerkt von Bronstein war die Hausbesorgerin in die Wohnung gekommen und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Wissen Sie, ob es im Haus einen Arzt gibt?«, schrie Bronstein mehrmals, da es eine Weile dauerte, bis sich die Frau wieder gefangen hatte. Endlich nickte sie. »Einen Stock drüber!«
»Dann holen Sie ihn, und zwar schnell.«
Doch der Arzt hatte nicht mehr viel zu tun. Er sah Bronstein traurig an und schüttelte den Kopf.
»Tja, gnä’ Frau«, sagte Bronstein fast ein wenig bedauernd, »dann werden wir Sie wohl mitnehmen müssen.«
VI.
Bronstein war untröstlich, dem Fräulein Doleschal nun kein Autogramm Grozavescus überreichen zu können. Vielleicht verfolgte er darum umso mehr den Fall, auch wenn er nicht an der Befragung der Frau Grozavescu beteiligt gewesen war. Drei Monate nach der Tat war formell Mordanklage gegen sie erhoben worden, einen guten Monat später begann der Prozess. Da Bronstein ohnehin nichts Besseres zu tun hatte, nahm er sich zum Zwecke der Fortbildung, wie er es nannte, eine kleine Auszeit von der Büroarbeit und setzte sich in den Schwurgerichtssaal.
Doch was er dort zu hören bekam, erstaunte ihn doch einigermaßen. In den Medien war der Fall schon abgeurteilt gewesen, selbst seine eheliche Untreue hatte man dem Sänger angesichts der Furienhaftigkeit seiner Gattin nachgesehen. Für kein Blatt Wiens war eine andere als die Höchststrafe für den kaltblütigen Mord an einer großen Künstlerseele denkbar.
Die Grozavescu erklärte rundweg, keine Reue oder Schuldgefühle zu empfinden, sie habe sich nur, durch das Verhalten ihres Gatten bis zum Äußersten gereizt, zur Wehr gesetzt, weshalb sie sich auch nicht für schuldig im Sinne der Anklage bekennen könne. Diese Verteidigung schien nicht nur Bronstein absurd. Auch das übrige Publikum gab deutliche Zeichen des Unmuts von sich, das durch sämtliche Zeugenaussagen nur noch bekräftigt wurde. Kein einziger Zeuge ließ auch nur ein gutes Haar an der Mörderin.
»Na ja«, sagte Bronstein, als er am nächsten Tag doch wieder im Amt erschien, »die kriegt den Frack, das ist sicher. Die mag niemand, alle beschreiben ihn als Helden und sie als kranke Hysterikerin mit ausgeprägtem Hang zur Erinnye. Das wird lebenslang am Felsen, wirst sehen.«
Allerdings entnahm Bronstein in den folgenden Tagen den Zeitungen doch merkwürdige Meldungen über den Prozessverlauf. So schien es mit einem Mal, als hätte die Grozavescu doch Grund zur Eifersucht gehabt, da sie ihr Mann mit einer Frau Stransky betrogen zu haben schien. Außerdem war die Grozavescu schon einmal verheiratet gewesen, mit einem Major, von dem offenbar auch die Tatwaffe stammte. Bronstein wurde wieder neugierig. Welche Rolle spielte der in diesem Drama?
Und so begab sich Bronstein doch noch einmal ins Gericht, um die Plädoyers der Anwälte zu hören. Der Staatsanwalt malte den Schrecken und die Verderblichkeit der Tat noch einmal in den düstersten Farben aus, um dann an die Laienrichter zu appellieren: »Meine Herren Geschworenen! Am Abend des 14. Februar 1927 sang Traian Grozavescu den Rigoletto. Er ahnte nicht, dass die Arie ›La donna è mobile‹ – ›Ach, wie so trügerisch sind Frauenherzen, mögen sie klagen, mögen sie scherzen …‹ sein Schwanenlied war! Nelly Grozavescu hat getötet, weil sie töten wollte! Denn als Grozavescu sie nicht nach Berlin mitnehmen wollte, hatte sie erkannt, dass dies das Ende ihrer Herrschaft über ihren Mann war! Der Mann, der bisher ein fügsamer Sklave war, hatte einen Rest von Männlichkeit in sich entdeckt. Wenn auch nur ein Funke der heiligen Flamme in Ihnen glüht, die man die Gerechtigkeit nennt, dann müssen Sie mit dem Wahrspruch herauskommen: Nelly Grozavescu, du bist schuldig und du sollst deine Tat sühnen!«
Der Verteidiger sah die Dinge freilich gänzlich anders. Er plädierte auf geistige Verwirrung seiner Mandantin, und das schien auch die einzige Möglichkeit, wie er sie noch vor der Höchststrafe retten konnte. Seine Rede war dabei so rührselig, dass Bronstein sich lange nicht entscheiden konnte, ob er nun lachen oder doch lieber weinen sollte. Er wurde von Ausdrücken wie »unglückselig«, »arm« und »tragisch« nur so bombardiert, dass er sich am Ende fragte, ob die Grozavescu nicht tatsächlich bloß ein verwirrtes Opfer der Umstände war. Er erinnerte sich an den Eindruck, den sie auf ihn gemacht hatte, und war erstmals froh, nicht über sie urteilen zu müssen.
Die Geschworenen waren sich erstaunlich rasch einig. Sie fällten einen Freispruch wegen vorübergehender Verwirrung der Sinne. Bronstein war schon bereit, sich für die Frau, die als freier Mensch das Gericht verlassen konnte, trotz allem zu freuen, als er erstarrte. Die Grozavescu stand auf, lächelte klaren Sinnes und fiel in die Arme eines Mannes, in dem Bronstein deren ersten Gatten erkannte. Arm in Arm mit dem Major entschwand sie glückselig aus dem Gebäude. »Na«, schnalzte Bronstein in die Richtung der Laienrichter, »die hat euch ja schön geleimt.«
VII.
Eigentlich war sein frisch erwachter Eifer für die Oper durch diese Ereignisse jäh wieder abgekühlt. Doch als er Ende Juni im Café ›Herrenhof‹ seine ›Wiener Zeitung‹ las, wurde er plötzlich von einem jungen Feschak aus seiner Lektüre aufgeschreckt. Mit sanfter Tenorstimme fragte der Mann, ob die auf Bronsteins Tisch liegende ›Sportwoche‹ schon frei sei. Der Major sah dem Jüngling in die ausdrucksstarken Augen und war sich sicher, das Gesicht zu kennen. »Entschuldigen der Herr«, begann er daher, »sind Sie nicht der Herr Kiepura?« Der so Angesprochene lächelte. »Ich fürchte, das lässt sich nicht leugnen.«
»Dann, Herr Kiepura, kann ich Ihnen zweierlei sagen. Erstens, die ›Sportwoche‹ ist frei, zweitens, ich gebe sie nicht so einfach her.« Dabei grinste er. »Das kostet Sie etwas, Herr Kiepura.« Nun war der Pole doch erstaunt. Er wollte wohl eben darauf verweisen, dass die Zeitungen in einem Kaffeehaus für alle Gäste frei benützbar waren, als Bronstein nachsetzte: »Ein Autogramm, wenn ich bitten dürfte.«
Kiepura nahm den letzten Satz mit spürbarer Erleichterung zur Kenntnis. »Wenn’s weiter nichts ist …«
»Es ist weiter nichts. Und können S’ bitte schreiben: Für Anna Doleschal mit besten Grüßen oder so …«
Letztes Mittagmahl
Dieses Zittern! Diese Nervosität! Diese unerträgliche Angst! Wann hörte das alles endlich auf? Konnte er dem allen nicht Herr werden? War er denn kein Mann? Hunderttausenden war es wie ihm ergangen, und die suhlten sich auch nicht tagein tagaus in ihren vermeintlichen Wehwehchen! Vor allem: Er saß hier, er war gesund, hatte keine Gliedmaßen verloren und war, zumindest theoretisch, voll einsatzfähig.
Weshalb wachte er dann Nacht für Nacht von Albträumen geplagt auf? Er war 33 Jahre alt, da durfte man doch erwarten, dass er sich nicht mehr fürchtete wie ein kleines Kind. Schon gar nicht, wenn die Gefahr längst vorbei war!
Bronstein zündete sich eine Zigarette an und trank den trüben Eichelkaffee ohne jeden Zusatz. Zucker gab es schon lange keinen mehr, und die Milchfrau war am Vortag nicht mehr in ihrem Geschäft gewesen. Warum, so fragte sich Bronstein, während er den Rauch ausblies, musste er immer wieder an Tarnow-Gorlice denken? Eine Woche hatte dieses grauenvolle Schlachten gedauert, und am Ende waren fast 100.000 Soldaten der eigenen Seite und ebenso viele Feinde tot oder verwundet am Schlachtfeld geblieben. Und er, Bronstein, musste sich eingestehen, niemals in seinem Leben hätte er sich so etwas Schreckliches auch nur vorzustellen vermocht.
Mit einer Infanteriedivision der 4. Armee war er als Oberleutnant nach Kleinpolen beordert worden. Dort hatten sie als Erstes erfahren, dass die deutschen Waffenbrüder, namentlich die Generale Mackensen und von Seeckt, den Oberbefehl hatten, was in der Mannschaft sofort für Unruhe sorgte. Bronstein war am ersten Tag mehr damit beschäftigt gewesen, den Leuten zu erklären, dass es egal sei, wer das Oberkommando innehabe, als dass er Zeit für eine Überprüfung der Ausrüstung gefunden hätte. Die einfachen Soldaten hatten es damals schon besser gewusst. Er erinnerte sich an einen böhmischen Lackl, der ihm unverfroren gesagt hatte: »Nichts für ungut, Herr Oberleutnant, aber die Piefke haben da das Kommando, weil sie euch Österreichern nichts mehr zutrauen.« Damals hatte Bronstein den Mann angebrüllt, er solle gefälligst die Disziplin wahren, doch heute blieb ihm nichts anderes übrig, als dem Tschechen beizupflichten. Die Deutschen trauten den Österreichern tatsächlich nichts zu, und das wurde mit jedem neuen Tag nur offenkundiger.
Damals aber, an jenem 2. Mai 1915, hatten sie die deutschen Offiziere kurz nach sechs Uhr morgens aus den Schützengräben gejagt. Er hatte sich dabei ertappt, wie er an jenen dummen Witz des Schriftstellers Roda Roda denken musste, worin denn der Unterschied zwischen einem ungarischen und einem österreichischen Frontoffizier bestehe. Ersterer rufe »mir nach«, Letzterer »vorwärts«. An diesem Tag wollte Bronstein ein Ungar sein. Er rief lautstark »mir nach« und sprang nach dem Pfeifton aus dem Graben. Geduckt lief er durch das völlig zerfurchte Terrain, das von Geschützfeuer, Maschinengewehrgarben und Minenwerfern bis zur Unkenntlichkeit umgepflügt worden war. Seine 60 Mann folgten ihm in kurzem Abstand. Er hätte es nicht für möglich gehalten, eine Distanz von drei Kilometern im Sprint zurückzulegen, doch nackte Todesangst spornte einen anscheinend zu ungeahnten Höchstleistungen an. Links und rechts pfiffen Kugeln an seinem Helm vorbei, und er war so außer sich, dass er nicht einmal mehr daran zu denken vermochte, eine der Kugeln könnte ihn treffen.
Als sie den Stacheldrahtverhau des gegnerischen Schützengrabens erreicht hatten, bot sich ihm ein Bild der Apokalypse. Leichen über Leichen türmten sich da, in der schwarzen Erde versickerten Ströme von Blut. Hier lagen Gedärme, dort Augäpfel, wiederum dort ein abgetrennter Arm oder ein abgerissenes Bein. Dazu ein pestilenzartiger Gestank, der die ohnehin schon vorhandene Übelkeit nur noch verstärkte. Sein Gehirn gebot ihm, den Draht zu überwinden und in den Schützengraben zu springen. Doch er sah nur diese unbeschreibliche Verwüstung und sich selbst vollkommen bewegungsunfähig.
Erst Wochen später, als er halbwegs wieder auf dem Damm war, erfuhr er im Lazarett vom Ausgang der Schlacht. Lemberg war durch den grandiosen Sieg zurückerobert worden, hieß es, und er, so beschied man ihm, habe unendliches Glück gehabt, dass die Kugel, die ihn am Kamm getroffen hatte, die Schlagader um einen Zentimeter verfehlte. Denn sonst, so lautete das ärztliche Urteil, wäre er dort binnen weniger Augenblicke verblutet. So aber sei er spätestens im Juli wieder voll einsatzfähig. Welch ein Trost!
Und dabei war Tarnow-Gorlice noch gar nicht das Schlimmste gewesen! Der Gasangriff vor einem halben Jahr war es, der für seine Albträume verantwortlich war. Denn immer noch wachte er schweißgebadet mit der fixen Vorstellung auf, er sei gerade im Giftgas erstickt. Er zündete sich eine neue Zigarette an, die er mit fahrigen Bewegungen zum Mund führte. Wie lange, so fragte er sich, konnte man mit dieser beständigen Angst leben? Würde er ihr irgendwann einmal nachgeben? Nach außen hin war es ihm bisher gelungen, die Fassade aufrechtzuerhalten, doch tief in ihm nagte die fortwährende Furcht, die ihn bei der kleinsten unvorhergesehenen Entwicklung schier in Panik ausbrechen ließ.
Mit nicht geringer Erleichterung stellte er fest, dass Samstag war. Wenigstens musste er an diesem Tag nur bis zur Mittagsstunde im Amt ausharren. Danach freilich war ein Lunch mit dem Herrn Papa angesetzt, der sich, wie Bronstein nur zu gut wusste, um den Sprössling ernstlich sorgte. Ihm gegenüber konnte er sich also schwerlich offenbaren, und dies umso weniger, als der Vater sich redlich Mühe gab, dem Sohn wieder in ruhigere Fahrwasser zu verhelfen. So hatte Bronstein senior extra einen Tisch im Hotel ›Meissl & Schadn‹ reserviert, wo es, zumindest nach der Meinung von Karl Kraus, dem Herausgeber der ›Fackel‹, das beste Ochsenbeinfleisch des gesamten Planeten gab. Ein solch lukullisches Mahl durfte man also kaum durch banales Wehklagen über die eigene Befindlichkeit entweihen. Es galt vielmehr, die Zähne zusammenzubeißen und ein ›keine besonderen Vorkommnisse‹ zu rapportieren.
Erfreut stellte er wenig später fest, dass die Straßenbahn klaglos funktionierte und ihn direkt zur Universität fuhr. Der Oktoberwind blies ihm scharf ins Gesicht, als er den Ring abwärts marschierte, sodass ihn fröstelte, als er seine Amtsstube betrat. Er befeuerte den Kanonenofen, rieb sich die Hände und setzte sich dann endlich an seinen Schreibtisch. Stumm blickte er das Porträt Kaiser Franz Josephs an, wie um damit zu signalisieren, dass er nun mit seiner Arbeit beginne.
Im Nachhinein hätte er selbst nicht mehr zu sagen vermocht, wie es ihm gelungen war, die vier Stunden zu überstehen, doch diese Frage zählte nicht angesichts des kleinen Erfolgs, den er über sich selbst und seine Angst errungen hatte. Er durchquerte flotten Schrittes die Schottengasse, hielt dann auf den Graben zu und erreichte so, um einiges zu früh, wie er feststellte, den Neuen Markt. Da er nicht im Freien auf den Vater warten wollte, zog er sich in das Café des Hotels zurück, wo er einen kleinen Braunen und einen Trebernen orderte, sich von Letzterem ein wenig mehr Ruhe und Sicherheit erhoffend.
Er stellte fest, dass er schon zu viele Zigaretten für diese Zeit des Tages geraucht hatte, und so erwarb er beim Kellner eine weitere Packung, dabei inständig hoffend, der Herr Papa würde für das Mittagmahl aufkommen, da seine pekuniäre Lage sonst allzu prekär geworden wäre.
Wie aufs Stichwort erschien die gebeugte Gestalt des alten Bronstein in der Lobby und sah sich mit wachen Augen um. Nahezu im selben Augenblick erspähte er den Sohn, und ein schmales Lächeln zeigte sich auf dem zerfurchten Antlitz. Jener aber überwand behände die Entfernung zwischen ihnen und schüttelte dem Vater freudig die Hand. »Ich freu mich, Papa, dass wir uns endlich wieder einmal sehen.«
»Und ich erst, mein Junge. Du glaubst ja gar nicht, wie fad es ist, wenn man immer nur Zeitung liest und Briefmarkenalben abstaubt. Da tut es gut, wenn man einmal aus der Wieden herauskommt.«