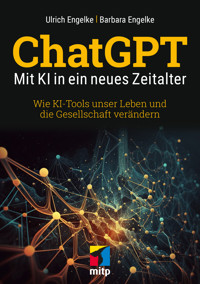
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MITP
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: mitp Sachbuch
- Sprache: Deutsch
- Wie ChatGPT und Co. Eingaben verarbeiten und Inhalte generieren
- Chancen und Herausforderungen für Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft
- Wichtige rechtliche Fragen wie Urheberschaft und Datenschutz
Künstliche Intelligenz hat bereits weitreichende Auswirkungen auf unser Leben und die Gesellschaft. Ulrich und Barbara Engelke diskutieren in diesem Buch verschiedene Sichtweisen auf ChatGPT & Co. und deren Einfluss auf die Bereiche Schule und Studium sowie Arbeit und Gesellschaft. Sie erläutern, wie die KI-Tools im Detail arbeiten, und zeigen anhand zahlreicher Beispiele, wofür sie im Alltag eingesetzt werden können. Darüber hinaus stehen Themen wie Ethik, Sicherheit und Missbrauch im Fokus.
Mit dem Buch stellen die Autoren grundlegende Fragen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz und geben Ihnen damit die Möglichkeit, sich kritisch mit aktuellen und künftigen Auswirkungen auseinanderzusetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)
Liebe Leserinnen und Leser,
dieses E-Book, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Mit dem Kauf räumen wir Ihnen das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Jede Verwertung außerhalb dieser Grenzen ist ohne unsere Zustimmung unzulässig und strafbar. Das gilt besonders für Vervielfältigungen, Übersetzungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Je nachdem wo Sie Ihr E-Book gekauft haben, kann dieser Shop das E-Book vor Missbrauch durch ein digitales Rechtemanagement schützen. Häufig erfolgt dies in Form eines nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichens, das dann individuell pro Nutzer signiert ist. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Beim Kauf des E-Books in unserem Verlagsshop ist Ihr E-Book DRM-frei.
Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen,
Ulrich Engelke Barbara Engelke
ChatGPT
Mit KI in ein neues Zeitalter
Wie KI-Tools unser Leben und die Gesellschaft verändern
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-7475-0759-9
1. Auflage 2023
www.mitp.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: +497953 / 7189 – 079
Telefax: +497953 / 7189 – 082
© 2023 mitp-Verlags GmbH & Co. KG, Frechen
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Dieses E-Book verwendet das EPUB-Format und ist optimiert für die Nutzung mit Apple Books auf dem iPad von Apple. Bei der Verwendung von anderen Readern kann es zu Darstellungsproblemen kommen.
Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des E-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine E-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die E-Books mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert. Bei Kauf in anderen E-Book-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Lektorat: Janina Vervost
Sprachkorrektorat: Jürgen Benvenuti
Covergestaltung: Christian Kalkert
Bildnachweis: ©Zaleman \stock.adobe.com
Satz: mitp Verlags GmbH & Co. KG, Frechen, www.mitp.de
electronic publication: CPI books GmbH, Leck
Inhalt
Vorwort
1KI und Machine Learning: Entwicklung und Technologien
1.1.Natürliche Intelligenz und ihre künstliche Schwester
1.2.Ursprünge der KI und historische Entwicklung
1.3.KI-Sprachassistenten und Gründung von OpenAI
1.4.Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL)
1.5.Schlüsseltechnologien und Methoden des Machine Learnings
1.6.Schlüsseltechnologien und Methoden des Deep Learnings
1.7.Praktische Anwendungen von KI in unserem Alltag
1.8.Wenn KI sich selbstständig macht: Die Singularität
2ChatGPT und generative Modelle sowie weitere KI-Tools
2.1.Universaltalent ChatGPT
2.2.Die Entwicklung von GPT
2.3.Aufmerksamkeits- versus Konversationsfenster
2.4.Die wichtigsten Neuerungen in GPT-4
2.5.Das Training eines Modells: Parameter und Tokens
2.6.Ein Überblick über die Trainingsdaten
2.7.Ein Blick unter die Motorhaube: Wie funktioniert ChatGPT?
2.8.Praktische Nutzung und KI-Prompting
2.9.Plugins, Erweiterungen und KI-Schreibassistenten
2.10.Maschinell erstellte Texte erkennen: AI-Detektoren
2.11.Bard: Das KI-Experiment von Google
3Prompts für Schule, Beruf und Freizeit
3.1.Hilfe in Schulfächern, Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitung
3.2.Fremdsprachen lernen für Urlaub, Schule und Beruf
3.3.Bewerbung, Lebenslauf und Fragen im Vorstellungsgespräch
3.4.Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Events
3.5.Reden und Rhetorik
3.6.Marketing und Werbung
3.7.Web-Programmierung mit HTML, CSS und JavaScript
3.8.Lebensmittel, Rezepte und Ernährungsplanung
3.9.Tipps für Gesundheit und Fitness sowie Trainingspläne
3.10.Originelle und kreative Geschenkideen für jeden Anlass
3.11.Reiseziele, Reiseplanung und Reiseführer
3.12.Finanzen, Investment und Vorsorge
4ChatGPT vs. Google: Ein Vergleich
4.1.Wie funktioniert eine moderne Suchmaschine?
4.2.Google – vom Start-up zum Monopolisten
4.3.Googles Wikipedia: Der Knowledge Graph
4.4.Die Tricks von Google
4.5.Arten von Suchanfragen
4.6.Die Google User Experience als Qualitätsversprechen
4.7.Unterschiede zwischen Suchmaschinen und Sprachmodellen
4.8.Sprachmodell und Suchmaschine: Versuche einer Synthese
5Ethische Gesichtspunkte
5.1.Weiß die KI, was sie tut?
5.2.Kennt der Chatbot Moral?
5.3.Die Moral der KI und der Clickworker
6Herausforderungen für das Bildungswesen
6.1.ChatGPT in der Schule – eine gute Idee?
6.2.Wie kann ChatGPT fachspezifisch eingesetzt werden?
6.3.Absolut unerlässlich: Der Faktencheck
6.4.Auf lange Sicht: Was ändert ChatGPT in der Schule?
6.5.Die Vision: Schule der Zukunft
6.6.KI-Schule – der Pilotversuch
6.7.ChatGPT und die Universitäten
7Auswirkungen auf die Arbeitswelt
7.1.KI in der Arbeitswelt: Welche Jobs sind betroffen?
7.2.Neue Perspektiven in alten Jobs
7.3.Ist die KI ein Jobkiller oder ein Segen auf dem Arbeitsmarkt?
7.4.Nicht alle Veränderungen werden positiv sein
7.5.Neue Chancen zur Humanisierung der Arbeitswelt
8Auswirkungen auf die Gesellschaft
8.1.Fake News und Deepfakes
8.2.Stehen wir vor einer neuen Spaltung der Gesellschaft?
8.3.Macht ChatGPT uns alle dumm?
8.4.Leben mit allerlei digitalen Assistenten
8.5.Klimakrise versus Energieschlucker KI?
8.6.Virtuelle Models und Influencer: Perfekte Schönheit ohne Zicken
8.7.Werden Foren, Blogs und das informationsorientierte Web überflüssig?
9Urheberrecht und Datenschutz
9.1.Grundlagen des deutschen Urheberrechts
9.2.Verwertungsgesellschaften vertreten das Urheberrecht
9.3.Der größte Diebstahl des Jahrhunderts?
9.4.Geistiges Recycling, Freiheit der Information und Hackerethik
9.5.Wem schadet die generative KI?
9.6.Ist ChatGPT datenschutzkonform?
9.7.Risiken beim Einsatz von ChatGPT
10Sicherheit, Kontrolle und Missbrauch
10.1.Ein Zauberlehrling, der die Geister nicht mehr loswird
10.2.Das Moratorium für die KI-Entwicklung
10.3.Wenn KI-Systeme aus dem Ruder laufen
10.4.Kontrollverlust – nur gefühlt oder schon echt?
10.5.Kann man ChatGPT auch offline nutzen?
10.6.Desinformation aufdecken und bekämpfen
10.7.ChatGPT verschärft Cyberbedrohungen
11Himmlische Offenbarung oder »Trojanische Bombe«?
Das KI-Betthupferl
Quellenverzeichnis
Anmerkungen
Vorwort
E-Bikes sind böse! Aber sind sie es wirklich? Aus Sicht des Radsportlers ist die Sache klar: »Gift für die Beine und eine weitere Krücke für eine degenerierte Gesellschaft, die sich bald nicht mehr ohne künstliche Hilfsmittel fortbewegen kann.« Gott sei Dank gibt es nicht viele von diesen kurzsichtigen Sportlern, denn eigentlich hat das E-Bike viel Gutes gebracht: Die Menschen radeln dank der Unterstützung nun wieder, und zwar mehr und weiter als je zuvor!
Warum erzählen wir Ihnen das alles? Weil es Parallelen zu ChatGPT gibt, weil wir mehr als zehn Jahre nach dem E-Bike eine weitere Krücke bekommen haben: ChatGPT nämlich. Statt schlagender Radfahrer-Verbindungen verkünden nun Bildungsfunktionäre und die Wächter des Deutschunterrichtes den geistigen Niedergang des Abendlandes: Wenn wir ChatGPT das Schreiben überlassen und sogar Schüler das Werkzeug in der Schule nutzen, kann bald niemand mehr selbst formulieren und Texte schreiben. Schlimmer noch: Weil Denken und Sprache nun mal untrennbar sind, sind die intellektuelle Entwicklung und die geistige Reife künftiger Generationen in akuter Gefahr.
Echt jetzt? So schlimm? Haben wir eigentlich beim Aufkommen des Taschenrechners denselben Tanz aufgeführt? Und wie war es damals bei der Erfindung des Rades? Hat man damals auch aufgeschrien, wir würden jetzt das Gehen und das Tragen schwerer Dinge verlernen? Wohl wahr: Seit es das Auto gibt, können nur noch wenige Menschen reiten. Aber ist diese Entwicklung so fatal, wie man vor mehr als 100Jahren vielleicht gedacht hatte?
ChatGPT ist seit dem 30.11.2022 für alle zugänglich und nutzbar. Es ist ein Faktum wie das Auto und der Taschenrechner. Wir können nur noch darauf reagieren, individuell und als Gesellschaft. Und versuchen, das Beste daraus zu machen. Dieses Buch soll Ihnen dabei helfen und Licht auf folgende Fragen werfen:
■Was ist künstliche Intelligenz?
■Wie entsteht sie und was kann sie leisten?
■Wie wird sie unser Leben und unsere Gesellschaft verändern?
Wir haben uns Mühe gegeben, diese Fragen und weitere umfassend und verständlich zu beantworten. Und hoffen, dass unsere Antworten Sie weiterbringen.
1KI und Machine Learning: Entwicklung und Technologien
1.1Natürliche Intelligenz und ihre künstliche Schwester
Wer sich mit künstlicher Intelligenz (KI oder engl. AI für artificial intelligence) beschäftigt, muss zuerst klären, was natürliche Intelligenz eigentlich ist. Intelligenz ist ein ziemlich schwer zu definierendes Konzept. Wissenschaftliche Erklärungsversuche kommen aus der Psychologie und Philosophie, der Neurologie und weiteren Disziplinen, die basierend auf ihrem Forschungsgegenstand jeweils andere Aspekte in den Vordergrund stellen. Eine zusammenhängende Erklärung oder ein tiefgehendes Verständnis, warum unser Gehirn zu wirklich außerordentlichen Leistungen fähig ist, gibt es noch nicht.
Versucht man sich an einer allgemeingültigen Definition, die quer durch alle Fachrichtungen wenigstens ein Kopfnicken hervorrufen soll, könnte man Intelligenz als die Fähigkeit bezeichnen, Wissen zu erwerben und dieses Wissen anzuwenden, um damit beliebige Probleme zu lösen. In einem weiteren Schritt entsteht daraus idealerweise neues Wissen und es können neue Erkenntnisse und Konzepte formuliert werden. Intelligenz ist untrennbar mit dem Begriff des Transfers verbunden. Es geht dabei um Anpassungsfähigkeit, das Lernen aus Erfahrungen und das Anwenden von erworbenem Wissen in stetig variierenden Kontexten. Die Entwicklung von Intelligenztests zur Bewertung und Messung menschlicher Intelligenz war von Anfang an ein fragwürdiges Unterfangen, das nicht zu einem besseren Verständnis des Phänomens geführt hat.
Künstliche Intelligenz war und ist ganz allgemein gesprochen der Versuch, menschliche Intelligenz in Maschinenform nachzubilden und irgendwann sogar zu übertreffen. Maschinen im Allgemeinen und Computer im Besonderen sollten so gestaltet werden, dass sie menschenähnliche Fähigkeiten erhalten, um Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Künstliche Intelligenz als umfassender Ansatz wurde in viele einzelne Teilbereiche zerlegt, von Computer Vision (Bilder und Videos interpretieren, um daraus Informationen zu gewinnen) bis zur Robotik (Entwicklung von Maschinen, die eine Vielzahl von Aufgaben autonom ausführen können). Die natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP), also das Verstehen und aktive Verwenden menschlicher Sprache für Anwendungen wie Chatbots, Übersetzungsdienste und Sprachassistenten, entwickelte sich schnell zu einem der anspruchsvollsten Forschungszweige in der Informatik.
Künstliche Intelligenz ist bis heute keine Nachbildung allgemeiner menschlicher Intelligenz in Maschinenform. Die Entwicklung konkreter Anwendungen konzentriert sich immer auf eine spezialisierte Intelligenz für ganz bestimmte Aufgaben. Ein Schachcomputer kann die besten Spieler der Welt auf dem Schachbrett mattsetzen, kann außerhalb des Spielfeldes aber kein einfaches Gespräch führen und eine Maus nicht von einem Elefanten unterscheiden.
Heute ist die künstliche Repräsentation menschlicher Intelligenz ein ziemlich buntes und multidisziplinäres Unterfangen, das ständig wächst und sich in alle Richtungen in rasendem Tempo weiterentwickelt: Chatbots sprechen wie Menschen mit uns, Computerprogramme erkennen den Inhalt von Bildern, produzieren auf Wunsch auch neue Bilder oder Videos in täuschend echter Qualität, sie erkennen und bewerten komplexe Verkehrssituationen in Echtzeit und können Fahrzeuge autonom steuern. Diesen wirklich beeindruckenden Fortschritten in vielen Bereichen, die menschliche Fähigkeiten teilweise um ein Vielfaches überschreiten, stehen andere Aspekte menschlicher Intelligenz gegenüber, die auf der Maschine offenbar schwer zu replizieren sind: Emotion, Empathie und interdisziplinäres Denken.
1.2Ursprünge der KI und historische Entwicklung
Die Geschichte der künstlichen Intelligenz ist ebenso lang wie faszinierend. Erste Konzepte und Visionen stammen von Heron von Alexandria, einem griechischen Mathematiker und Ingenieur, der unter dem Titel Automata das erste Buch der Maschinen veröffentlichte und einen Weihwasserautomaten entwickelte. Die Jahrtausende alte Idee, künstliches Leben zu erschaffen, griff ein französischer Ingenieur und Erfinder namens Jacques de Vaucanson auf und entwickelte 1738 die Mechanische Ente und weitere Automaten. Aber erst das 20.Jahrhundert gilt als Geburtsstunde der modernen KI. Pionier in den 1930er- und 1940er-Jahren war Alan Turing mit seiner Turing-Maschine, die kein physisches Gerät, sondern ein theoretisches Konzept zur Theorie der Berechenbarkeit darstellte. Sie hat zur Entwicklung von Programmiersprachen, zur Theorie der Automaten und zur Erkenntnis der Grenzen der Computermathematik beigetragen und Grundlagen für das Verständnis algorithmischer Prozesse gelegt. Von ihm stammt auch der bekannte Turing-Test, der ab 1950 zu einem zentralen Diskussionsthema im Bereich KI wurde: Ein Computer besteht den Turing-Test, wenn ein menschlicher Richter nicht in der Lage ist zu entscheiden, ob er mit einem Menschen oder einem Computer kommuniziert, basierend allein auf den gegebenen Antworten.
Der Begriff künstliche Intelligenz wurde 1955 von John McCarthy geprägt und im Rahmen des Dartmouth Meetings im Jahr 1956 vorgestellt. Dieser Kongress gilt als die Geburtsstunde der KI als eigenständige Teildisziplin der Informatik. Die ersten KI-Programme wurden mit großer Euphorie entwickelt, darunter das Schachprogramm von Claude Shannon und das Programm Logic Theorist von Allen Newell und Herbert A. Simon. In den 1960ern und 1970ern gab es einen großen Optimismus in der KI-Forschung, mit respektablen Fortschritten in Bereichen wie maschinellem Lernen und der Sprachverarbeitung. »ELIZA« wurde in den 1960er-Jahren von Joseph Weizenbaum am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt und war eines der ersten Computerprogramme, das in der Lage war, textbasierte Konversationen mit Menschen zu führen. Auf Grundlage des DOCTOR-Skripts ahmte es die Gesprächsführung eines Therapeuten nach. ELIZA verwendet Muster und Schlüsselwörter, um die Eingabe eines Benutzers zu analysieren und passende vordefinierte Antworten auszuwählen. Viele Benutzer hatten das Gefühl, mit einem menschlichen Therapeuten und nicht mit einem Computer zu sprechen.
Allerdings traten in den späten 1970ern auch die Grenzen der KI-Techniken zutage und führten zum ersten KI-Winter. In dieser Periode erlahmte das allgemeine Interesse am Forschungsgebiet und die Finanzierung wurde stark zurückgefahren. In den 1980ern kamen die sogenannten Expertensysteme auf den Markt und sorgten für eine Wiederbelebung der KI. Diese waren darauf ausgelegt, menschliches Fachwissen in einem spezifischen, stark eingegrenzten Bereich zu sammeln und das Wissen vieler Experten darin zu bündeln, um Beratung und Entscheidungsunterstützung anzubieten. Ein prominentes Beispiel eines Expertensystems ist MYCIN, ein System, das Ärzte bei der Diagnose von bakteriellen Infektionen unterstützt und Therapieempfehlungen für Antibiotika gibt. Weitere Systeme wie PUFF halfen Medizinern bei der Interpretation von Lungenfunktionsdaten, ein anderes unterstütze Ingenieure bei der Entwicklung von Schaltungen (CADET: Computer Aided Design of Electric Circuits). Alle diese Systeme markierten einen signifikanten Fortschritt in der KI-Forschung und schufen überaus nützliche Anwendungen für eng abgegrenzte Bereiche. Obwohl ihre Fähigkeiten im Vergleich zu heutigen KI-Systemen sehr begrenzt waren, legten sie den Grundstein für viele heutige KI-Anwendungen und maschinelle Lernsysteme.
Auf den ersten KI-Winter folgte der zweite, als gegen Ende des Jahrzehnts die anfängliche Begeisterung wieder verflogen war. Ein Rückgang des allgemeinen Interesses an einem Forschungsgebiet führt immer zu einer Reduzierung der finanziellen Mittel und diese Ausdünnung der Forschungsgelder führte unweigerlich zum zweiten (und letzten) KI-Winter. Die Grundlagenforschung in den 1990ern fokussierte sich immer weiter auf datengetriebene, statistische Ansätze, besonders in der Sprachverarbeitung und beim maschinellen Lernen. In den 2000ern beschleunigten sich die Entwicklungen dann weiter. Die Verfügbarkeit von immer leistungsstärkerer Hardware und die exponentielle Zunahme an verfügbaren Daten läuteten nun das Zeitalter von Big Data ein und sorgten für große Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens.
Das 21.Jahrhundert bedeutet für die KI also gleichermaßen Renaissance wie endgültiger Durchbruch. Deep Learning sowie neuronale Netzwerke mit vielen Schichten und tiefen Architekturen revolutionierten Bereiche wie Bild- und Spracherkennung. KI-Systeme wie IBMs Watson und AlphaGo von DeepMind zeigten beeindruckende Fähigkeiten in der Lösung immer komplexerer Aufgaben. Bis heute hat die KI-Forschung eine beeindruckende Reise hinter sich, von ersten Visionen über die theoretischen Anfänge bis hin zu realen Anwendungen, die unsere moderne Welt immer tiefer prägen. Noch immer gibt es zahlreiche ungelöste Fragen und Herausforderungen, aber die Fortschritte der letzten Jahrzehnte sind erstaunlich.
1.3KI-Sprachassistenten und Gründung von OpenAI
Ich erinnere mich an eine Szene aus der Serie Raumschiff Enterprise, die mich als Kind sehr beeindruckt hat: Ein Außerirdischer erhält Zugriff auf den Bordcomputer des Raumschiffes und eröffnet seine Befehlseingabe ganz selbstverständlich mit »Hallo Computer«. Ein etwas verdutzter, aber hilfsbereiter Mr.Spock händigt ihm daraufhin eine Tastatur aus, die der andere mit verächtlicher Miene entgegennimmt und mit »Wie rückständig!« kommentiert. Was in den 1970ern noch reine Utopie war, ist heute längst Realität: Siri, Alexa und ähnliche Sprachassistenten gehören auf dem Smartphone zum Alltag und sind dort längst keine Sensation mehr. Vor der Einführung von Siri im Jahre 2011 als Teil des iPhone 4S waren KI-Interaktionen mit gesprochener Sprache für den durchschnittlichen Verbraucher auf Science-Fiction-Filme beschränkt. Auf Apples Siri folgte Amazons Alexa und der Google Assistant. Die Sprachassistenten brachten KI in die Taschen und Wohnzimmer von zahllosen Menschen. Aus dem ehrgeizigen Konzept wurde im Handumdrehen ein ganz alltägliches Werkzeug.
Die Sprachassistenten der großen Internet-Konzerne führten mit der Kommerzialisierung zu erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung von Spracherkennungstechnologien. Fortschritte in der Spracherkennung haben die Popularität von Sprachassistenten noch weiter gesteigert und die anfängliche Fehlerquote in der Erkennung natürlicher gesprochener Sprache ist in den letzten Jahren drastisch gesunken. Hinzu kommen Fortschritte im Natural Language Processing (NLP), weil Assistenten auch den Kontext und die Bedeutung der Anfragen verstehen müssen. Dieses konkrete kommerzielle Interesse hat die Entwicklung in den Bereichen NLP und Natural Language Understanding (NLU) enorm vorangetrieben.
Ein Meilenstein in der Entwicklung der KI war die Gründung von OpenAI im Dezember 2015. Die Organisation wollte sich der Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz widmen. Der im ursprünglichen Gründungsbrief dargelegte Hauptzweck formulierte, dass künstliche allgemeine Intelligenz (Artificial General Intelligence, AGI) der gesamten Menschheit zugutekommen sollte. OpenAI wollte selbst Anwendungen entwickeln und damit sicherstellen, dass KI auch von anderen auf eine Weise entwickelt wird, die der Menschheit nützt. Zu den Gründern von OpenAI gehörten Tech-Unternehmer und -Investoren wie Elon Musk und Sam Altman, der später CEO wurde. OpenAI hatte sich von Beginn an darauf festgelegt, seine Forschung öffentlich zugänglich zu machen, später wurde diese vollständige Offenheit wegen Sicherheits- und Wettbewerbsbedenken aber immer weiter einschränkt.
Elon Musk war einer der Hauptunterstützer von OpenAI, hatte aber keine Kontrolle über die Aktivitäten der Organisation, die als unabhängige Einheit agierte. Musk war natürlich Vorstandsmitglied und wollte der Nachrichtenwebsite Semafor zufolge im Jahr 2018 die Kontrolle von OpenAI übernehmen. CEO Sam Altman und andere Gründer hätten seine Ambitionen aber abgelehnt, was zum Ausstieg von Musk wegen angeblicher Interessenkonflikte führte. Die Gründung von OpenAI war neben gemeinnützigen und geschäftlichen Interessen nicht zuletzt auch Ausdruck einer wachsenden Besorgnis in der Tech-Gemeinschaft über die potenziellen Risiken von KI und insbesondere von AGI. Durch ihre Bemühungen und Forschungen hoffte die Organisation damals, den Weg für eine sichere und für alle vorteilhafte Entwicklung von fortschrittlichen KI-Technologien zu ebnen.
1.4Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL)
Machine Learning oder maschinelles Lernen ist ganz allgemein gesprochen der Ansatz, Maschinen so zu programmieren, dass sie, statt vorgegebene Anweisungen zu befolgen, aus Daten lernen können, ähnlich wie Menschen aus ihren Erfahrungen lernen. Ziel ist, dass die Maschinen ihre Leistung bei der Lösung bestimmter Aufgaben über die Zeit hinweg durch Erfahrung (also weiteres Lernen) immer weiter verbessern.
Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL) sind Teilgebiete der künstlichen Intelligenz, die sich aber in Konzept, Architektur und Anwendung stark unterscheiden. Machine Learning beschreibt den konzeptuellen Ansatz, bei dem Computer die Fähigkeit erlernen, Aufgaben ohne explizite Programmierung auszuführen. ML-Algorithmen nutzen vorgegebene Daten, um Vorhersagen oder Entscheidungen zu treffen, ohne explizite Programmanweisungen, wie diese Entscheidungen getroffen werden sollen. Wenn ein KI-Programm Bilder von Stühlen und Sesseln unterscheiden soll, werden im Algorithmus keine Kriterien für Stühle oder Sessel hinterlegt. Stattdessen werden dem Programm gelabelte Trainingsdaten vorgelegt, also Bilder von Stühlen und Sesseln gezeigt, und für jedes Bild wird der korrekte Typ genannt. Der ML-Algorithmen muss (und kann) nun selbstständig geeignete Kriterien zur Unterscheidung finden und gewichten. Nach den Trainingsdaten kommen weitere, bisher unbekannte Testdaten, mit denen geprüft wird, ob das System bereits praxistauglich ist oder weiteres Training benötigt.
Deep Learning (DL) ist ein Teilbereich von ML, der meistens tief verschachtelte neuronale Netzwerkarchitekturen verwendet. Diese tiefen Modelle können aus sehr vielen Schichten bestehen, weshalb man sie als Deep Learning bezeichnet. DL-Modelle sind komplexe Netzwerke, die sehr große Mengen an Daten benötigen, um angemessen trainiert zu werden. ML-Modelle können mit deutlich weniger Daten auskommen als DL-Modelle. Wegen der Datenmenge und der höheren Komplexität der Netzwerke erfordern DL-Modelle häufig spezialisierte Hardware wie Grafikprozessoreinheiten (GPUs) oder Tensor Processing Units (TPUs) für das Training, was enorm rechen- und kostenintensiv ist. Einfache ML-Modelle sind deutlich anspruchsloser und erfordern keine besondere Hardware.
Deep-Learning-Modelle, die auf großen Datenmengen beruhen, sind zwar sehr leistungsfähig, weil es aber schwierig bis unmöglich ist, die genaue Funktionsweise der einzelnen Neuronenschichten nachzuvollziehen, sind die Ergebnisse wenig bis gar nicht interpretierbar und werden oft als Black Boxes empfunden. Machine Learning wird in eher einfachen Anwendungen der Vorhersageanalyse, für Empfehlungssysteme bis hin zur Mustererkennung eingesetzt. Deep Learning hingegen ist bei sehr großen Mengen unstrukturierter Daten im Vorteil und entwickelt das volle Potenzial bei Aufgaben wie der Bild- und Spracherkennung. ML nutzt eine Vielzahl von Algorithmen wie lineare Regression, Entscheidungsbäume und Support Vector Machines, DL konzentriert sich hauptsächlich auf neuronale Netzwerkarchitekturen und Transformer, wie sie auch bei ChatGPT zum Einsatz kommen.
Deep Learning ist also so etwas wie das Sahnehäubchen und die Weiterentwicklung von Machine Learning. Es setzt auf komplexe neuronale Netzwerke und deren tief verschachtelte Architekturen. Praktisch alle neueren Leuchtturm-Anwendungen der KI basieren auf Deep-Learning-Algorithmen und profitieren von der großen Menge an verfügbaren Daten und einer immer leistungsfähigeren Hardware mit exponentiell wachsender Rechenleistung. Wussten Sie das schon? Nach heutigen Standards betrachtet, hat ein aktuelles Smartphone schon deutlich mehr Rechenleistung als die Computer der ersten Apollo-Mission!
1.5Schlüsseltechnologien und Methoden des Machine Learnings
Künstliche Intelligenz umfasst eine Reihe von Schlüsseltechnologien für spezifische Anwendungen, die je nach Problem und Art der vorliegenden Daten eingesetzt werden. Beim Machine Learning werden vor allem drei unterschiedliche Formen des Lernens eingesetzt: das Supervised Learning, das Unsupervised Learning und das Reinforcement Learning.
Man kann ein Modell anhand von gelabelten Daten trainieren, in unserem Beispiel Bilder von Stühlen und Sesseln, die vorher gelabelt, also gekennzeichnet und der jeweiligen Klasse zugeordnet wurden. Das Verfahren zum Training des Modells nennt sich überwachtes Lernen oder Supervised Learning. Typische Anwendungen von überwachtem Lernen sind E-Mail-Spam-Filter: Ein Modell wird trainiert, um zu erkennen, ob eine E-Mail Spam ist oder nicht. Das Training erfolgt auf einem Datensatz, in dem vorhandene E-Mails bereits als Spam oder Nicht-Spam gekennzeichnet sind. Systemanalytiker bezeichnen dieses Verfahren als Klassifikation. Im Gegensatz dazu eröffnen sich mit der sogenannten Regression weitere Möglichkeiten, wie sie z.B. in der Vorhersage von Immobilienpreisen durch eine KI verwendet werden: Ein Modell wird trainiert, um den Verkaufspreis von Häusern, basierend auf verschiedenen Merkmalen wie Größe, Lage und Anzahl der Zimmer, vorherzusagen. Der Trainingsdatensatz enthält historische Daten von verkauften Häusern mit allen Merkmalen und den tatsächlich erzielten Verkaufspreisen.
Wenn die Daten zum Trainieren von Modellen ohne Labels auskommen müssen, sprechen wir vom unüberwachten Lernen bzw. Unsupervised Learning. Das kommt immer dann zum Einsatz, wenn es zu viele Parameter gibt und gleichzeitig die Relevanz einzelner Parameter noch nicht eingeschätzt werden kann. Dass man auf die Intelligenz eines Menschen eher über dessen Schulnoten als über die Schuhgröße rückschließen kann, steht sicherlich außer Frage. Aber an welchen Parametern erkennt der Online-Händler die Besucher seiner Website mit dem größten Umsatz-Potenzial?
Beim unüberwachten Lernen werden Modelle anhand von nicht gelabelten Daten trainiert. Das Hauptziel besteht darin, Muster, Strukturen oder Zusammenhänge in den Daten zu entdecken, ohne dass vorher festgelegte Labels oder Kategorien vorhanden sind. An konkreten Beispielen wird das deutlicher: Ein Handelsunternehmen möchte seine Kunden basierend auf ihrem Kaufverhalten in verschiedene Gruppen einteilen, ohne vorher zu wissen, welche Kategorien dafür eigentlich relevant sind. Ein Clustering-Algorithmus wie k-Means kann verwendet werden, um die Kunden in verschiedene Gruppen bzw. Cluster zu unterteilen, ohne dass vorher Kategorien für die Einteilung festgelegt wurden. Clustering ist für alle Arten von Segmentierungen ein sinnvolles Verfahren.
Für die Analyse des Warenkorbes werden Assoziationsregeln verwendet: Ein Einzelhändler möchte herausfinden, welche Produkte häufig zusammen gekauft werden, um effektive Produktbündel oder Werbeaktionen zu erstellen. Ein Algorithmus wie Apriori kann verwendet werden, um solche Assoziationsregeln in vorliegenden Transaktionsdaten zu finden. Bei diesen Beispielen zum Clustering und Assoziationsregel-Lernen gibt es keine vorgegebenen Labels oder Kategorien. Das Modell versucht stattdessen, die zugrunde liegende Struktur der Daten zu erkennen und daraus Erkenntnisse zu gewinnen.
Die dritte Form des Lernens ist das sogenannte Reinforcement Learning oder verstärkendes Lernen. Modelle lernen durch Belohnungen, basierend auf den getroffenen Entscheidungen. Das Konzept des verstärkenden Lernens hat Parallelen zur positiven und negativen Verstärkung in der Verhaltenspsychologie, die auch in Erziehungskontexten angewendet wird. Tatsächlich stammen viele Prinzipien des verstärkenden Lernens in der KI aus der Verhaltenspsychologie. In der Erziehung von Kindern bedeutet Verstärkung, dass bestimmte Reaktionen oder Verhaltensweisen des Kindes durch Belohnungen (positive Verstärkung) oder unangenehme Reize (negative Verstärkung) gestärkt werden, um das gewünschte Verhalten zu fördern. Maschinelles verstärkendes Lernen wird oft in der Robotik und in der Spiele-KI eingesetzt.
AlphaGo ist ein Programm, das von DeepMind entwickelt wurde, um das Brettspiel Go zu spielen. Es hat das Prinzip des verstärkenden Lernens verwendet, um sich selbst zu trainieren und schließlich den menschlichen Weltmeister im Go zu schlagen. Oder wir nehmen ein Beispiel aus der Roboter-Navigation: Ein Roboter wird in einer unbekannten Umgebung platziert und muss lernen, von einem Punkt zum anderen zu navigieren, ohne gegen Hindernisse zu stoßen. Durch verstärkendes Lernen kann der Roboter lernen, welche Aktionen ihn sicher zu seinem Ziel führen und welche zu Kollisionen oder anderen negativen Ergebnissen führen. Zuletzt noch ein Beispiel aus der Finanzwelt bzw. dem Aktienhandel: Ein Algorithmus kann trainiert werden, um Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf dem Aktienmarkt zu treffen, wobei das Ziel (die Belohnung) ist, den finanziellen Gewinn zu maximieren. Durch Interaktion mit Marktinformationen und -preisen kann der Algorithmus über die Zeit lernen, welche Handelsstrategien am rentabelsten sind.
In allen diesen Beispielen interagiert ein Agent (z.B. das AlphaGo-Programm, der Roboter oder der Handelsalgorithmus) mit seiner Umgebung, trifft Entscheidungen und erhält Feedback in Form von Belohnung (Erfolg) oder Nicht-Belohnung (Misserfolg). Der Algorithmus kann sich entsprechend anpassen, um die Wahrscheinlichkeit von Belohnungen über die Zeit zu maximieren.
1.6Schlüsseltechnologien und Methoden des Deep Learnings
Deutlich komplexer sind die Schlüsseltechnologien und Methoden des Deep Learnings. Hier werden in der Bildverarbeitung vorwiegend Konvolutionale neuronale Netzwerke, für sequenzielle Daten wie Text oder Zeitreihen Rekurrente neuronale Netzwerke oder Transformer-Architekturen wie bei GPT eingesetzt.
Transformer-Architekturen haben den Bereich des Natural Language Processing (NLP) revolutioniert. Die hier vorgestellten Konzepte sind sehr komplex, ermöglichen aber einen Einblick in die spannendsten Anwendungen moderner KI, die nur durch Deep Learning, große Datenmengen und mit ausgefeilten Technologien erst möglich wurden. Wem die folgenden Erklärungen zu technisch sind, darf die nächsten Abschnitte natürlich gern überspringen.
Konvolutionale neuronale Netzwerke (Convolutional Neural Networks, CNNs oder ConvNets) sind eine Kategorie von tiefen neuronalen Netzwerken, die speziell für Aufgaben wie die Bilderkennung entwickelt wurden. Die Grundidee von CNNs besteht darin, die räumlichen Hierarchien in Daten zu erkennen. CNNs sind so strukturiert, dass sie automatisch und adaptiv Merkmale aus Bildern lernen, verallgemeinern und wieder kombinieren können. In der ersten Schicht des Netzwerks (Convolutional Layer) werden Filter verwendet, um lokale Merkmale eines Bildes zu erkennen und eine sogenannte Feature-Map zu produzieren. Nach vielen weiteren Schichten werden die Daten in eine oder mehrere vollständig vernetzte Schichten geführt, um das endgültige Ergebnis (z.B. eine Klassifikation) zu erhalten.
Stellen Sie sich das Bild einer Katze im Garten vor: Zuerst werden einfache Merkmale wie Kanten und Texturen erkannt, in den tieferen Schichten folgen komplexere Merkmale wie Augen, Nasen und Ohren. Noch tiefer könnten weitere Objekte wie Blumen oder Bäume erkannt werden. Erst die unteren Pooling-Schichten können diese Merkmale dann verallgemeinern und in den vollständig vernetzten Schichten zu einer Schlussfolgerung gelangen, dass es sich bei dem Bild um eine »Katze im Garten« handelt. Dieser Prozess des Erkennens von Merkmalen von einfach bis komplex und deren Zusammenführung ermöglicht es CNNs, Bilder mit hoher Genauigkeit zu klassifizieren, um dann in der Praxis bildbezogene Aufgaben von der Gesichtserkennung bis zur medizinischen Bildanalyse zu lösen.
Rekurrente neuronale Netzwerke (RNNs) sind eine Klasse von neuronalen Netzwerken, die speziell für die Verarbeitung sequenzieller Daten entwickelt wurden. Sequenzielle Daten sind Informationen, die in geordneter Abfolge auftreten und bei denen die Reihenfolge für das Verständnis oder die Analyse wichtig ist. Dafür sorgen Schleifen, die es RNNs ermöglichen, Informationen über vorherige Schritte im Netzwerk zu behalten. Diese werden als versteckte Zustände gespeichert. Das macht RNNs besonders geeignet für Aufgaben, bei denen zeitliche Abhängigkeiten oder Sequenzen wichtig sind, wie in der Text- oder Spracherkennung. In der Praxis sind sie mittlerweile in der Lage, sehr komplexe Sequenzmuster zu erkennen, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen empfiehlt, von der maschinellen Übersetzung über die Spracherkennung bis hin zur Komposition von Musikstücken.
Stellen Sie sich vor, Sie möchten den Satz »Als ich im Wald spazieren ging, hörte ich das Zwitschern eines ___ .« vervollständigen. Für die Lücke wäre das Wort »Vogel« in der flektierten Form »Vogels« eine sinnvolle Lösung. Um zu diesem Schluss zu kommen, muss ein KI-Modell die Information über den Ort »Wald« und den Laut »Zwitschern« erinnern. Ein RNN verarbeitet den Satz Wort für Wort und aktualisiert seinen internen Zustand bei jedem einzelnen Wort neu. Wenn es zur Lücke kommt (und bei der Sprachgenerierung ist jedes nächste Wort eine Lücke), würde das RNN seinen aktuellen versteckten Zustand und die Information über den Wald und das Zwitschern verwenden, um das Wort »Vogel« vorherzusagen und die korrekte Form »Vogels« zu finden.
Zuletzt wollen wir uns mit den Transformer-Architekturen beschäftigen, die zumindest im Bereich der Sprachverarbeitung aktuell die Speerspitze in den KI-Technologien darstellen. Transformer-Architekturen sind ein vergleichsweise neues Modell in der Deep-Learning-Landschaft, das speziell für Aufgaben in der Sequenz-zu-Sequenz-Verarbeitung, insbesondere in der Sprachverarbeitung, entwickelt wurde. Die Schlüsselkomponente eines Transformers ist ein Self-Attention-Mechanismus, der es diesen Modellen ermöglicht, verschiedene Positionen innerhalb einer Eingabesequenz in Abhängigkeit von ihrem Kontext zu gewichten.





























