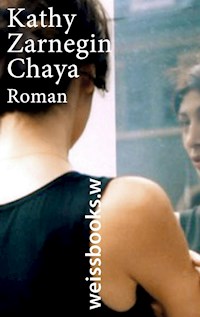
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weissbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Teheran, 70er Jahre: Ein junges Mädchen beschließt, Schriftstellerin zu werden, und träumt von Europa. Kaum ist sie aus dem turbulenten Iran im Herzen Europas angekommen, verwandelt sich das neugierige Kind im Schnelldurchlauf in eine Frau, die plötzlich "vor dem Leben" steht: Wie rasch lerne ich die neue Sprache, wie komme ich an Geld, was mache ich mit meinen Träumen, wo finde ich den, mit dem es sich lieben lässt? Chaya ist ein Paradiesvogel. Unangepasst, freiheitshungrig, eine Frau, die sich von nichts und niemandem schrecken lässt, ein Großstadtwesen und manchmal sogar ein quittengelber Kanarienvogel. Wie damals 'Zazie in der Metro' streift Chaya abenteuerlustig durch eine Welt, die sich vor ihr in eine wundersame bunte Kugel verwandelt. Für alle Fans von Lily Brett, Alina Bronsky und Vanessa F. Fogel Das Porträt einer unkonventionellen, starken Frau mit nicht zu bremsendem Freiheitsdrang. Ein so warmherziges wie hinreißend witziges Debüt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
weissbooks. w
Impressum
Kathy Zarnegin
Chaya
Roman
© Weissbooks GmbH Frankfurt am Main 2017
Alle Rechte vorbehalten
Konzept Design
Gottschalk+Ash Int’l
Satz
Publikations Atelier, Dreieich
Umschlaggestaltung
Julia Borgwardt, borgwardt design
unter Verwendung eines Motivs von Christian Knörr
Foto Kathy Zarnegin
© Michael Utz
Erste Auflage 2017
ISBN 978-3-86337-114-2
Dieses Buch ist auch als eBook erhältlich
ISBN 978-3-86337-134-0
weissbooks.com
zarnegin.ch
Kathy Zarnegin
Chaya
Roman
Chaya
– weh mir! ich bin eine Nuance –
Friedrich Nietzsche
Unterstützt durch den Fachausschuss Literatur Basel-Stadt/Basel-Landschaft und Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
1.
Mein Vater lebte mit zwei Frauen. Die erste, mit der er sechs Kinder gezeugt hatte, war so alt wie er selbst, die zweite, mit der er mich und meine Geschwister gezeugt hatte, war naturgemäß um einiges jünger. Am einen Ort die kränkelnde Verständnisvolle, die ihm sogar Opium auftrieb, wenn er Lust auf einen kleinen Rausch hatte, den sie ihm nicht mehr persönlich besorgen konnte, am anderen die anstrengende Schönheit, die selten zufrieden war und vor allem immer mehr wollte, unter anderem, dass er mehr Zeit bei uns zu Hause verbrachte, was keine Selbstverständlichkeit war.
Dieses bei uns zu Hause klang an sich schon fremd, zumindest aus dem Munde meines Vaters. Denn dieses zu Hause war nichts Einzigartiges, es war nicht dieses unschuldig daherkommende zu Hause. Bei uns zu Hause hieß bei uns im Unterschied zu jenem anderen Zuhause, das mein Vater zudem sein Eigen nannte.
Er genoss in zwei Welten ein Zuhause und fühlte sich in beiden wohl. Vielleicht wäre das Arrangement aufgegangen, hätte meine Mutter sich nicht um diesen Familienzustand, der ja keiner war, weil er immer wieder neu hergestellt werden musste, geschert. Aber sie machte sich etwas daraus, was immer sehr laut und, aus kindlicher Perspektive, beängstigend war.
Niemand hatte meine Mutter zur Heirat mit meinem Vater gezwungen. Im Gegenteil. Sie hatte, als sie eine kurze Zeit als Krankenschwester in einem Teheraner Spital gearbeitet hatte, meinen Vater kennengelernt, der wegen einer Lebervergiftung dort lag, und sich Hals über Kopf in ihn verliebt, in diesen für iranische Verhältnisse ungewöhnlich groß gewachsenen Mann, der einer anderen Frau sechs Kinder geschenkt hatte und, wie man so sagt, in festen Händen war. Aber nur, bis er die Bekanntschaft meiner Mutter gemacht hatte.
Amor hatte meinem Vater ein Stück schlecht gelagertes Fleisch in einem abgelegenen Restaurant im Süden des Landes serviert und ihm auf diese Weise ermöglicht, meine Mutter im Spital kennenzulernen.
Ein schwarzweiß glänzendes Foto mit Randverzierungen, heute leicht vergilbt, hat als einziges Relikt diese Zeit überlebt. Darauf ist meine Mutter zusammen mit anderen Kolleginnen in ihrer Spitaluniform zu sehen. Ihre dramatisch schwarz geschminkten Augen dominieren das Bild. Es ist, als hätte der Fotograf nur sie und ihre reifen Früchten nachempfundenen Lippen im Visier gehabt. In der Mitte einer weiß uniformierten Frauengruppe, allesamt werdende Krankenschwestern, die damals noch dunklen Haare mit viel Haarspray und Toupierkunst akribisch um die strenge Haube dressiert, schaut meine schöne Mutter mit halb offenem Mund den künftigen Zuschauern eines vergangenen Augenblicks stolz in die Augen.
Mit diesem Blick, der die Herausforderung auf sich nahm, angestarrt zu werden, und mit diesem sich einem Lächeln verweigernden Mund betrat sie damals das Zimmer meines Vaters und verlor auf der Stelle ihr Herz, als mein Vater sie mit Mademoiselle ansprach und sie, ohne ihre Stimme je zuvor gehört zu haben, fragte, ob sie in Paris gelebt hätte.
»Non, mais je voudrais bien!«, wobei sie das je nicht wie »jö« aussprach, sondern wie »jee« und das »r« ihr wie bei den Italienern von der Spitze der Zunge hinausrollte. Ihre Antwort war von einem siegesbewussten Lächeln begleitet. Die Frau in meiner Mutter wusste, dass mein Vater sich aus diesem unerwarteten, fremdgestrickten Satznetz nicht mehr befreien könnte.
Meridiane hin oder her – ein Cadillac fahrender, wohlhabender Mann und eine attraktive, ehrgeizige Frau, die so sein wollte wie die Stars der Magazine, die sie konsultierte (Gina Lollobrigida, Sophia Loren oder Brigitte Bardot standen ihr wahlweise als Vorbild), fanden sich auf Anhieb anziehend. Das hat etwas mit der Physik zu tun. Eine talentierte jüngere Frau, die sich durch Frauenzeitschriften und Kreuzworträtsel eine gewisse Alltagsbildung, die sie zeitlebens für Wissen hielt, angeeignet hatte und ein Mann, der diese Welt außerhalb der staubigen Grenzen seiner orientalischen Heimat sehr gut kannte. Keine Haremsgeschichte. Keine Zwangsehe. Keine Unterdrückung der Frau. Es war Liebe. Und diese Liebe durfte nicht sein, weshalb meine Mutter einige Zeit später ins Ausland ging, um zu vergessen.
Aber wie soll man vergessen, wenn schon etwas da ist? Wie soll aus etwas, was da ist, plötzlich nichts werden? Allenfalls im Nachhinein wird uns bewusst, dass wir vergessen haben. Wie geboren werden – auch hier stellen wir eines Tages fest, dass es uns gibt. Vergessen gibt es im Grunde nicht, weil Vergessen keine Gegenwart hat: I am forgetting ist sinnlos.
Meine Mutter reiste zu ihrer Schwester in ein fernes Land, um eines Tages sagen zu können, dass sie vergessen hat. Doch das Schicksal spielte ein anderes Spiel mit ihr. Das Schicksal wollte nicht, dass sie vergisst, und schickte Blicke und Düfte und Stimmen und Erinnerungen. Nicht alles aufs Mal, aber häppchenweise, zum Beispiel das Bild meines Vaters am Steuer seines hellblauen amerikanischen Wagens, der alle Blicke auf den mit den Straßen von San Francisco vergleichbaren Teheraner Alleen auf sich zog, oder sein ansteckendes Lachen; gelegentlich waren es auch die Knöpfe seiner italienischen Anzüge. Und als das Schicksal auch noch anfing, ihr Liebesbriefe meines Vaters zuzustellen, da konnte sie nicht mehr vergessen. Da fand sie sich auf einmal nach dem Versuch, einen zweijährigen Intensivkurs in Vergessen in einem fremden Land zu absolvieren, mit ihm auf einer Europareise, von der sie später lebenslang träumen würde – was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste.
Sie wusste nicht, dass sie Dezennien danach Europa immer nur mit dieser Reise in Verbindung bringen würde. Kein anderer Auslandsaufenthalt würde für sie künftig die Bedeutung haben wie dieser. Jedes Mal, wenn sie mich Jahre später in der Schweiz besuchte, verkündete sie mir schon am ersten Tag ihres Besuches, dass sie in Europa Depressionen bekommen würde, was vielleicht schweizspezifisch war. Sie lehnte sich zum Fenster hinaus, schaute auf die grünen menschenleeren Straßen in meinem Quartier und schüttelte den Kopf:
»Habt ihr keine Menschen in diesem Land?«, fragte sie dann. Und fügte hinzu: »Hier würde ich verrückt werden vor lauter Stille.«
Wenn sie also von Europa schwärmte, dann war immer jene Initialreise gemeint, von der sie mit blond gefärbten Haaren in die Heimat zurückkehrte und in deren Verlauf ich irgendwo zwischen Florenz und Rom gezeugt wurde. Das spielte auch keine Rolle, sie hätte auch zwischen Lörrach und Potsdam sagen können, bloß kamen diese Orte in den persischen Kreuzworträtseln nicht vor.
Ich war also auf der mehrmonatigen Europareise durch Deutschland, Frankreich und Italien gezeugt worden, während meine Geschwister unter dem abgasreichen Teheraner Himmel das Licht der Welt erblickt hatten.
So kam es, dass ich schon als Kind nach Europa wollte, obwohl ich erst mit siebzehn von der romantischen Konstellation meiner Zeugung erfuhr. Bis dahin hatte ich den Beginn meines lästigen Da-Seins gewöhnlichen Umständen zugeschrieben (der Hitze, dem Zufall, dem unendlichen Begehren meines Vaters usw.). Aber in vollkommener Ahnungslosigkeit hatte das Schicksal mir früh schon zugeflüstert, dass ich nach Europa, das sich nachträglich als Ort meines Ursprungs erwies, zurückkehren musste.
Und ich kehrte an diesen Ort zurück. Für immer.
Aber zuvor hatte zu meiner glamourösen Entstehung auch eine entsprechende Erziehung hinzuzukommen. Und die beginnt, wie jedes Kind weiß, mit der Sprache.
In den 60er-Jahren galt Englisch plötzlich als schick. Englisch war die kommende Weltsprache, ohne Englisch würde niemand mehr eine Chance auf dieser Erde haben – das wusste meine Mutter aus ihren Frauenzeitschriften. Also wurde beschlossen, dass auch ich Englisch lernen müsse. Mit drei Jahren wurde ich in eine englischsprachige Tagesschule geschickt, die wegen ihrer hohen Gebühren immer wieder Streitereien zwischen meinen Eltern auslöste.
»Du hast die Schulrechnung nicht bezahlt.«
»Ich habe im Moment kein Geld.«
»Für deinen privaten Spaß hast du Geld. Wenn es aber um das Kind geht, bist du plötzlich arm.«
Danach wurde es sehr laut, und man verstand keinen Satz mehr.
In meiner prestigiösen Schule verbrachte ich den ganzen Tag in Gruppen, in denen fröhlich gespielt, gesungen und gemalt wurde und uns irgendeine Miss, wie die Lehrerinnen genannt wurden, etwas erzählte – aber was erzählte sie? Ich verstand sie nicht. In Erinnerung sind mir hingegen die schwindelerregend kurzen Röcke meiner Kindergärtnerinnen geblieben.
Der europäische Himmel zum Zeitpunkt meiner Zeugung hatte es offensichtlich versäumt, mir Englisch sprechende Gene mit auf den Weg zu geben. Und so entstand mit dieser zweiten Sprache ein früh erworbenes »Kannitverstan«. Dass ein Kind nicht alles versteht, ist normal. Aber ich hatte Lücken in zwei Sprachen. Jedenfalls kristallisierte sich so etwas wie eine Zeitverschiebung in meiner Wahrnehmung heraus, weil ich oft darauf vorbereitet war, etwas nicht zu verstehen. Der frühzeitigen Internationalisierung meiner Persönlichkeit wohnte zusätzlich das Problem inne, dass meine Eltern beide kein Englisch sprachen. Das hieß konkret, dass dieses »Kannitverstan« sich durch die Hausaufgaben auch in unser Familienleben hineinschmuggelte. Auch dort bei den Hausaufgaben im Dienste meiner globalen Anschlussfähigkeit war ich allein. Ich lernte also die englische Sprache und sprach einige Jahre später als Kind schon wie ein native speaker, konnte diese Sprache aber mit den nächsten Menschen um mich herum nicht teilen. Englisch wurde zu meiner Geheimsprache, und im Kreis meiner Lieben gehörte eine ganze Sprache nur mir allein.
War das der erste Wink des Schicksals, dass mein exklusiver Lebenswind Richtung Westen wehte? Jedenfalls schrieb sich ein emotionaler Jetlag als Lebensgefühl schon damals in mir ein und wartet seither auf einen Ausgleich aus dem Osten.
2.
Im dritten Stock unseres Hauses wohnte Tante Farah. Wir nannten sie so, nicht weil sie mit uns verwandt, sondern weil sie mit meiner Mutter befreundet war. Tante Farah war mit ihrer Lebensweise der gesamten Nachbarschaft ein Dorn im Auge und sorgte dafür, dass die Hausfrauen in unserer Gegend stets etwas zu flüstern hatten. Nicht nur, dass sie sich geweigert hatte, zu heiraten – diesen Makel verzeiht die iranische Gesellschaft keiner Frau –, sondern noch dazu lebte sie alleine, was noch skandalöser war. Eine alleinstehende selbstbewusste Frau, die einem Beruf nachging, hieß, sie durfte von allen beschimpft und beleidigt werden, was Tante Farah, trotz ihres jungen Alters, gelassen hinnahm.
»Worüber sollen sie sonst reden?«, fragte sie mit ruhiger Stimme. »Man kann doch nicht den ganzen Tag über Reis und Tomaten schwatzen!«
Und wenn meine Mutter nicht in der Nähe war, flüsterte sie mir ketzerisch ins Ohr: »Ich erinnere sie alle daran, dass sie etwas zwischen den Beinen haben.« Und dann kicherte sie.
Was ich nur halb verstand. Ich wusste, dass es unanständig war, zu erwähnen, dass man etwas zwischen den Beinen hatte, verstand aber nicht, warum es Tante Farah brauchte, um daran erinnert zu werden.
Aber so redete sie mit mir nur, wenn meine Mutter nicht zuhörte. Farah wusste, dass es das Ende ihrer Freundschaft bedeutet hätte, wenn sie nicht wenigstens vordergründig auf die üblichen Konventionen Rücksicht nahm.
Die Freundschaft und Solidarität meiner Mutter mit ihr hatte nur in einem stillschweigenden Einverständnis Bestand, denn nie hätte meine Mutter daran erinnert werden wollen, dass auch sie vor ihrer Heirat ein freizügiges Leben geführt hatte. Die Reise nach Europa war eine verdichtete Metapher für alles, nur nicht dafür, dass diese Reise auch Sex vor der Ehe bedeutet hatte. Über das »überflüssige Zeug« sprach meine Mutter nie und wenn, dann nur abschätzig.
Überhaupt, wenn man ihre Lebensgeschichte nicht kannte, die hauptsächlich den Familienmitgliedern vorbehalten war, konnte man denken, dass meine Mutter einer streng islamischen Gesellschaftsschicht entstammte. Sie ging manchmal sogar so weit, dass sie ihre jüdische Abstammung verheimlichte – im engen Familienkreis fluchte sie sogar gelegentlich über ihre Religion –, sodass viele Nachbarn sie für eine Muslimin hielten. Aber da waren eben ihre blond gefärbten Haare, die hohen Absätze und, als die Mode dies vorschrieb, ihre ultrakurzen Röcke, die ihren strengen Basar-Diskurs über das »überflüssige Zeug« relativierten.
Ihre Freundschaft mit Tante Farah war also die Frucht einer Spaltung. Sie genoss die Gesellschaft dieser kultivierten, humorvollen, jüngeren Frau, die all das lebte, was sie sich einst – im Geheimen vielleicht immer noch – erträumt, aber nie auszusprechen gewagt hatte. Und sie tolerierte die »skandalöse« Lebensweise ihrer Nachbarin nur, solange Tante Farah nicht offen darüber sprach. Wenn die Nachbarinnen es also wagten, in Gegenwart meiner Mutter etwas Schlechtes über Tante Farah zu murmeln, sagte sie konziliant: »Jedes Leben hat seine Tücken.« Und wechselte geschickt das Thema. Aber die Anspielungen der Nachbarinnen waren in der Regel viel subtiler. Niemand sagte in einem vollständigen Satz etwas Diffamierendes über Tante Farah. Zur Heraufbeschwörung grammatikalisch unvollständiger Sätze gesellte sich oft der Körpereinsatz: Augen wurden verdreht, die eine Hand schlug die andere, die Abergläubischen spuckten mehrmals in die Luft, um damit den Einfluss des Satans fern zu halten, womit jedem klar war, wer den Satan in unserem Umkreis herbeirief. Und wenn wir Kinder uns mit gespitzten Ohren in der Nähe solcher Anklagen – meist im Treppenhaus – versteckten, um mehr über das Erwachsenenleben zu erfahren, schickte uns meine Mutter mit einem klaren Befehl wieder weg.
Es war also ziemlich eindeutig, dass Tante Farah etwas Verbotenes machte, aber ich wusste nicht, was genau. Aus meiner kindlichen Perspektive war es nur seltsam, dass sie nicht verheiratet war. Ein oder zwei Mal fragte ich sie nach dem Grund, und sie antwortete: »Wer sagt denn, dass alle Frauen verheiratet sein müssen? Was fehlt mir denn so, wie ich lebe, ha?« Darauf wusste ich keine Antwort. Und dann lachte sie, streichelte mir zärtlich über das Haar und zitierte irgendjemanden auf Englisch.
Tante Farah war eine erfolgreiche Übersetzerin und der einzige Mensch weit und breit, der perfekt Englisch konnte und mir im englischsprachigen Teil meiner Seele Beistand leistete.
Was die Nachbarschaft nicht wusste, war, dass Tante Farah einen Liebhaber hatte, der um einiges älter und verheiratet war. Dass die Nachbarn das Kommen und Gehen von Tante Farahs armenischem Freund Georges nicht mitbekamen, ist mir bis heute ein Rätsel. Er war ein stämmiger, gut aussehender Mann mit graumelierten Schläfen, einem markanten Bauchansatz und einer tiefen Whiskystimme – er war also unüberseh- und unüberhörbar. Und trotzdem schien ihn die nachbarschaftliche Sittenpolizei nie bemerkt zu haben.
Georges war ein Lebemann, besaß mehrere Imbisslokale und verdiente gut. Diese armenischen Kleinrestaurants waren damals eine Art Restaurant und Bar in einem. Wer in aller Ruhe Alkohol trinken wollte, ging zum Armenier. Die Buden sahen oft ähnlich aus: ein schlauchiger Raum mit Neonlicht, zwei drei kleine Tischchen, auf denen Salz, Pfeffer und ein kleines Glas Senf standen, und ein paar Hocker rundherum. Irgendwo gab es auch eine kleine Theke für Gäste, die im Stehen essen wollten. Essen konnte man Sandwiches mit diversen Füllungen; exklusiv bei den Armeniern gab es aber auch Schinken. Georges besaß, wie gesagt, einige dieser Imbissbuden an pulsierenden Stellen der Hauptstadt, und weil es auch in Teheran damals schon viele einsame Seelen gab oder Menschen, die heimlich Schinken probieren wollten, liefen seine Geschäfte gut.
Georges und mein Vater verstanden sich vom ersten Moment an. Beide aßen, tranken und rauchten gern, beide machten gute Geschäfte und kannten die Welt, und beide hatten eine große Schwäche für Frauen. Der Rest war ihnen egal.
Niemand hatte je die Frage gestellt, wer dieser Georges war, und niemand bei uns zu Hause sagte etwas über seine Verbindung zu Tante Farah. Von Georges sprach man so, als gehörte er zu Tante Farahs Haushalt, mehr wollte keiner wissen.
Meine Eltern nahmen zur Kenntnis, dass Georges und Farah befreundet waren, und freuten sich, wenn sie mit ihnen zusammen saßen und Arak tranken. Niemand sitzt in Persien freiwillig alleine in seiner Wohnung, jeder umgarnt sich nach Möglichkeit mit Gästen, und die waren – bei diesem Liebespaar – nicht selten wir.
Manchmal brachte Georges seine Laute mit und spielte Musik und dann sang mein Vater etwas Unverständliches dazu. Mein Vater kannte kein Lied vollständig, vielleicht den ersten Vers und einen Refrain, den Rest erfand er beim Singen. Oft aber rezitierte Tante Farah, die viele Gedichte und Texte auswendig konnte. Wenn sie Shakespeare in der Originalsprache rezitierte, übersetzte sie die Verse immer ins Persische für meine Eltern, die einige Sprachen, aber nicht Englisch konnten.
Meiner Mutter gefielen die Rezitationen in einer fremden Sprache nicht. Sie fand, sie hätten keine Seele so wie die persischen. Manchmal unterbrach sie Tante Farah bei einer englischsprachigen Rezitation und sagte, heftig gestikulierend: »Komm, Farah, lass diesen Quatsch! Unser Land ist die Heimat der Poesie, diese Ausländer verstehen nichts von solchen Sachen. Lass gut sein, verschone uns bitte!«
Farah lächelte in solchen Momenten und widersprach sanft, versuchte, meiner Mutter die ihr unbekannten Bilder zu erklären, aber meine Mutter verstand die ausländische Fantasie nicht und wollte partout nichts dazulernen. Und als Farah bei meiner Mutter immer wieder auf Granit biss, wechselte sie freundlich zu einem persischen Text. Am Schluss ihrer Rezitation schaute sie meine Mutter an und fragte: »Nun, bist du zufrieden mit der Seele?«
Und meine Mutter, die zwar keinen Schulabschluss hatte, aber nie um eine Antwort verlegen war, hielt dann einen Vortrag über die Vorzüge der persischen Sprache, über ihren Reichtum und darüber, dass kein Ausländer (das war das Wort, das sie für die Fremden benutzte) jemals den Unterschied zwischen Djan und Ruh und den tieferen Sinn von Rumis Versen verstehen würde. Und da sie nicht unterbrochen wurde und daher meinte, mit ihrer Rede alle anderen mundtot gemacht zu haben, bat sie in feierlichem Ton Tante Farah darum, sie möge uns alle fortan mit dem fremden Blödsinn verschonen, worauf alle lachten und ruckzuck ein kleines Glas Arak in ihre Kehlen kippten.
Tante Farah war aber auch hartnäckig. Nicht so heftig und aufbrausend wie meine Mutter, sondern auf eine sanfte, diplomatische Art. Sie gab nie nach, und ich freute mich immer darüber, dass sie nicht aufgab, schließlich schlug ein noch nicht ganz festgelegter Teil meines Herzens im fremden Rhythmus.
Kurz nachdem sich alle beruhigt hatten, setzte Farah zu einem Vortrag über den Geist fremder Sprachen an.
»Schätzchen«, sagte sie dann zu meiner Mutter, »natürlich hast du recht mit dem, was du über die persische Sprache sagst. Ist ja klar! Schließlich hat Hafez auf Persisch geschrieben.«
»Na, bitte schön, bitte schön!«, unterbrach meine Mutter sie laut, »Gott möge dich segnen, das hast du nun selber gesagt, nicht wahr? Alle haben es gehört: Hafez hat auf Persisch geschrieben und nicht auf Englisch! Und der wäre gewiss nicht zu blöd gewesen, Englisch zu lernen, wenn es literarisch notwendig gewesen wäre, nicht wahr?«
Darauf Farah wieder: »Ich bin ja mit dir einverstanden, was den Reichtum der persischen Sprache und Literatur betrifft. Aber Persisch ist nicht die einzige Sprache auf der Welt. Jede Sprache hat ihre Seele. Jede Sprache kreiert eine eigene Seele, und wenn sich die Kulturen unterscheiden, dann auch deshalb, weil die Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen. Jede Sprache bringt eigene geistig-seelische Zustände hervor.«
»Ja, aber nach deiner Theorie dürften sich die verschiedenen Kulturen ja gar nicht verstehen!«, wendete meine Mutter triumphierend ein.
»Das ist richtig, Schätzchen.« Farah wusste zu gut, wie rechthaberisch meine Mutter war, und sprach jetzt äußerst behutsam mit ihr: »In gewissen Dingen verstehen sie sich auch nicht auf Anhieb oder sogar nie, und trotzdem ist Verständnis möglich, weil jeder Mensch mit seiner eigenen Sprache gelernt hat zu verstehen und daran glaubt, dass Verständnis möglich ist. Ich gebe dir ein Beispiel: Um die persische Seele zu verstehen, muss man das Wort Ta’arof verstehen. Ich habs schon tausendmal probiert, unseren ausländischen Gästen im Verlag zu erklären, was das ist, aber ich brachte sie immer nur zum Lachen. Seien wir ehrlich: Ta’arof bedeutet doch nichts anderes, als jemandem etwas anzubieten. Nicht wahr?«
»Richtig«, sagte meine Mutter.
»So, aber wir wissen auch, dass Ta’arof gleichzeitig die Bedeutung hat, das Angebotene nicht sofort anzunehmen.«
»Es wäre äusserst unhöflich«, ergänzte meine Mutter, »das Angebotene sofort anzunehmen. Niemand tut das.«
»Bravo! Niemand tut das bei uns. Aber es ist doch interessant, dass ein und dasselbe Wort, das unseren Alltag von morgens früh bis abends spät, prägt, gleichzeitig ein ganzes System von Verhaltensmustern schafft.«
Meine Mutter schwieg, und die Herren waren in ihrer eigenen Welt, also sprach Farah weiter: »Wir Perser leben von Ta’arof. Wir möchten immer, dass der andere teilnimmt an dem, was wir haben, und bieten es an oder tun wenigstens so und der andere muss es annehmen, aber nie beim ersten Angebot. Das ist sogar so, wenn wir einkaufen gehen, oder? Wenn du den Verkäufer nach dem Preis einer Bluse fragst, sagt er dir nicht sofort den Preis, er sagt vielmehr: Ich bitte Sie, die Bluse ist nichts wert. Nehmen Sie sie als Geschenk des Hauses! Kein Mensch auf der Erde versteht das. Aber kein Mensch käme bei uns auf die Idee, diese Redewendung wörtlich zu nehmen und mit der unbezahlten Bluse aus dem Laden zu laufen. Wir insistieren so lange, bis er uns den Preis nennt. Und dann fangen wir an, zu verhandeln und den Preis nach unten zu drücken – von einem Extrem ins andere. Stimmts oder nicht? Und wenn ich dir ein Stück Kuchen anbiete, sagst du nie beim ersten Mal: Ja danke, ich nehme gerne ein Stück. Sondern du sagst: Nein danke. Dann biete ich dir den Kuchen so oft an, bis du ihn nimmst. Selbst eine Braut darf nicht bei der ersten Frage, ob sie den Mann heiraten wolle, ja sagen. Sie muss dreimal gefragt werden, bis sie ja sagt, nicht wahr?«
Alle schwiegen.
Da ergriff Tante Farah wieder das Wort: »Das könnte ein Zug der persischen Seele sein, das verstehen die Ausländer nicht, da hast du recht. Aber dieser Zug findet sich auch in unserer Sprache wieder, in den vielen Wiederholungen und Spielereien mit den Gegensätzen und im Umstand, dass wir vieles metaphorisch zum Ausdruck bringen, also mit einer gewissen Distanz zu den Dingen.«
»Du willst sagen, wir haben das Ta’arof nur, weil unsere Sprache so veranlagt ist.«
»So ganz hundertprozentig kann man das nicht behaupten, aber ich will sagen, dass viele Haltungen, die du Seele nennst, aus der Sprache hervorgehen. Wir kennen diese uns vertrauten Haltungen und Zustände, andere kennen wiederum andere.«
»Was soll ich sagen?«, seufzte meine Mutter. »Aber dann musst du zugeben, dass unsere Sprache doch mehr Seelenstoff anbietet als andere. So falsch lag ich also doch nicht mit meiner These.«
»Nein, so falsch ist deine These nicht, aber ich wollte dir nur erklären, dass es auch andere geistig-seelische Haltungen gibt, die uns nicht auf Anhieb vertraut sind.«
»Wie auch immer! Ich für meinen Teil muss einfach gestehen, dass mir die ausländische Poesie nicht gefällt, was auch immer der Grund dafür sein mag. Man kann sich doch nicht zwingen, etwas zu mögen.«
»Liebe Philosophinnen, jetzt reicht’s! Lasst uns den Arak genießen!«, verkündete mein Vater. »Ihr habt beide recht, die persische Sprache hat mehr Seele, und andere Sprachen haben auch eine Seele. Und jetzt trinken wir auf die Liebe, die ist wichtiger als die Seele.«
Dass wir Kinder bei diesen Anlässen mit dabei sein durften, war normal. Kinder sind im Iran immer dabei und werden nie ausgeschlossen. Ich kann mich an etliche Einladungen erinnern, an denen um Mitternacht viele Kinder liegend oder sitzend auf den Stühlen eingeschlafen waren und zu noch späterer Stunde, von den Eltern geweckt, halb schlafend ins Auto taumelten. Oft schliefen wir Kinder im Auto erneut ein und mussten eine weitere Tortur über uns ergehen lassen, weil ja der Transfer vom Auto ins Bett noch ausstand. Bei allem hierarchischen Denken, das die persische Kultur prägt: Den Kindern wird immer mit viel Liebe und Respekt begegnet, und da die Gemeinschaft über allem steht, ist es keine Frage, dass man die Kinder nicht alleine lässt – und deshalb sind sie immer dabei.
So waren auch wir bei Tante Farahs nächtlichen Zusammenkünften fast immer zugegen, und während meine jüngere Schwester irgendwann auf dem Boden einschlief, trug ich eine Schlacht gegen den Schlaf aus, da ich, obwohl mir vieles schleierhaft war, nichts verpassen wollte. Einzelne Sätze oder Worte, deren Sinn mir zwar nicht verständlich war, die mich aber beeindruckt hatten, wiederholte ich für mich, da ich das Gefühl hatte, dass sie wichtig waren.
Oft stellte ich tags darauf solche Diskussionen vor dem Spiegel nach. Dabei war die Rollenverteilung klar: Ich spielte Tante Farah, während meine Mutter nur als Off-Stimme an der Debatte teilnahm. Da ich vor dem Spiegel unbedingt die magischen fremden Wörter auf der eigenen Zunge spüren wollte, waren die Sätze, die ich mit diesen Wörtern nachbildete, oft merkwürdig. Das kam mir jedenfalls so vor. Ein seltsames Gefühl, Sätze zu bilden, die man selbst nicht versteht! Aber darum ging es ja nicht. Es ging um den Geschmack eines Wortes wie System oder Verhaltensmuster. Das Wort Philosoph liebte ich besonders. So stand ich also vor dem Spiegel und deklamierte: »Es kommt auf die Verhaltensmuster der Philosophen an.« Oder: »Das ist ein kompliziertes System, das man nicht hundertprozentig erklären kann.«
Oder: »Auch die Ausländer haben eine Seele.«
Diese Übungen fanden im Schlafzimmer meiner Eltern statt, da der Frisiertisch meiner Mutter den einzigen großformatigen Spiegel in der Wohnung hatte. Manchmal nahm ich auch eine Bürste zur Hand, die mir als Mikrofon diente, und brachte der Bürste das Wort Kultur bei. Die alte Plastikbürste, ein Relikt jener legendären Europareise, war geduldig und nahm alles hin. Gelegentlich kam es vor, dass meine Mutter den Kopf in ihr Schlafzimmer steckte, um zu schauen, was ihre Tochter dort machte. Als sie meine merkwürdigen Sätze registrierte, schüttelte sie den Kopf. »Hast du sonst nichts zu tun im Leben?«
Ich antwortete leise: »Offensichtlich nicht.«
Aber sie ließ mich gewähren. Sie selbst hätte keine bessere Idee gehabt, was ich im Leben tun sollte.
Es gab noch etwas, was Tante Farah mir flüsternd mit auf den Weg gab.
»Vergiss nicht, ihr werdet wie Prinzessinnen behandelt – und dann wie Viehfutter irgendeinem Mann vorgeworfen. Es liegt ganz an dir, das nicht geschehen zu lassen. Do you understand me?«
Ich verstand sie halbwegs. Die Ungerechtigkeiten, mit denen man Mädchen und Frauen behandelte, waren selbst für ein Kind offensichtlich. Wie oft hatte ich den Satz gehört, dass eine Frau, die nur Töchter hatte, eine Unglückliche war. Man nannte sie so: die Unglückliche. Meine Mutter gehörte also zu dieser Kaste.
Zu allem Überdruss war sie auch noch die Mutter dreier Töchter geworden und blieb in diesem Punkt im Vergleich zur ersten Frau meines Vaters für immer im Rückstand. Diese hatte ihm von sechs Kindern immerhin drei Söhne geschenkt.
Ich verstand daher Tante Farah sehr wohl, aber ihr ging es um mehr. Tante Farah ging es um die Liebe. Und wann immer sie mit mir über die Liebe sprach, flüsterte sie mir ins Ohr. Ich glaube, sie hatte sonst niemanden, mit dem sie über Liebe hätte sprechen können. Ein junges Mädchen von neun Jahren war das einzige Wesen, dem Tante Farah sich anvertrauen konnte.
»Listen! Never say no to love! Hast du verstanden? Aber nimms nicht zu ernst!«
Ich nickte wie ein braves Pferd, und obwohl wir alleine waren, flüsterte auch ich ihr ins Ohr: »Aber warum? Why?«
»Because they all lie. Psssst!«
»Wer?«
»Alle, auch die, die Liebesromane schreiben.«
Von heute aus betrachtet, hatten wir nicht so lange mit Tante Farah zu tun, höchstens zwei Jahre dürften es gewesen sein, danach zogen wir in einen anderen Stadtteil und verloren bald den Kontakt zu ihr. Aber sie blieb der Leuchttum meiner Kindheit.
Dezennien später fragte ich eines Tages meine Mutter, ob sie je wieder etwas von Tante Farah gehört hätte. Meine Mutter antwortete kühl: »Farah? Sie hat sich vor Jahren das Leben genommen.«
Meiner zugeschnürten Kehle entkam zunächst kein Ton. Zu groß war der Schock darüber, wie meine Mutter über den Tod der einstigen Freundin sprach. Nur ein leises »Warum?« kroch aus mir heraus.
»Was hätte sie sonst tun sollen?«, sagte sie ruhig. »Das war doch kein Leben.«
3.
Das war doch kein Leben. Aber was war es denn, das Leben? Meine Mutter erweckte den Eindruck, eine Antwort auf diese Frage zu haben, die sie mir aber nicht verriet. Das Leben schien jedenfalls etwas zu sein, das auch bei uns nicht vorkam, das hörte ich immer wieder von ihr, dass es kein Leben war, was wir führten. Das Leben war immer woanders. Es war die ordentlich getragene Schuluniform einer Klassenkameradin, die Reise einer Nachbarin in die USA, der nette Ehemann einer Bekannten – das Leben war etwas, was einer Mutter zuteil wurde, die Söhne hatte und von diesen verwöhnt wurde, auch das.
Das Leben war nicht bei uns und für mich fand es immer dort statt, wo ich nicht war. Ich fing mit sieben oder acht an, nach dem Leben zu fragen, und meinte schon bald, es dort zu finden, wo mir fremde Geschichten erzählt wurden. Das schien das Leben zu sein: eine unbekannte Geschichte.
Ich weiß nicht, ob man mit acht Jahren schon 1001 Nacht lesen muss, nur weil man in einem orientalischen Land lebt. Aber eine Auswahl aus 1001 Nacht war das erste Buch, das ich zum Geburtstag von mir unbekannten Gästen geschenkt bekam. Ein interessantes Buch, wie sich herausstellte, da ich jedes zweite Wort der in gehobener Sprache verfassten Geschichte nicht richtig entziffern konnte und so gezwungen war, mir verschiedene Alternativen für den Werde- und Ausgang einer Geschichte vorzustellen. 1001 Nacht wurde in meiner Hand zu einer Art Multiple Choice und ich weiß bis heute nicht, ob das, was ich gelesen habe, auch wirklich mit jenem Text zu tun hat, der sich 1001 Nacht nennt.
Ich las gerne, obwohl mir nicht klar ist, woher ich diese Behauptung nehme, denn im Primarschulalter gab es für mich nicht viel zu lesen. Zudem war ich wie alle anderen Schulkinder so sehr mit den unmenschlich vielen Hausaufgaben beschäftigt, dass mir keine Zeit blieb, nebenbei noch Bücher zu lesen. Für die Schule mussten wir dauernd ganze Texte, während der Schulferien nicht selten sogar ein ganzes Buch abschreiben. Wir mussten so viel abschreiben und auswendig lernen, dass die wenigsten nebenbei noch Zeit fanden, ein Kinderbuch zu lesen. Uns las auch keiner je vor. Kein Wunder, dass unser Schulbuch aus dem Persischunterricht für mich lange Zeit das größte Vergnügen bedeutete. Ich hatte meistens am Anfang des Schuljahres das neue Buch schon ganz gelesen. Vor allem Jahre später, als das Schulbuch nicht mehr der Rechtschreibung gewidmet, sondern eine bunte Quelle der Literaturvermittlung war, verschlang ich all die Texte und rezitierte sie vor dem berühmten Spiegel, als seien sie eigene Vorträge gewesen. Richtige Bücher kamen erst mit zwölf in mein Leben.
Außer jener ominösen Sammlung aus 1001 Nacht besaß ich als Kind keine Bücher. Dafür lagen etliche Frauenzeitschriften und zweimal am Tag die Zeitung bei uns herum. Die Frauenzeitschriften gehörten einem Lesezirkel, weshalb man sie äußerst behutsam in die Hand nehmen musste. Viermal in der Woche war gegen 17 Uhr nachmittags zunächst der brummige Lärm eines Motorrads, das vor unserem Haus anhielt, und danach das Knallen der Zeitschrift auf dem Korridorboden zu hören. Dann eilte meine Mutter jedes Mal wie ein Kind zu ihrem Glücksobjekt. Die Zeitschriften waren bunte Botschaften jenes Lebens, das sich bei uns nicht ereignen wollte.
4.
Es war nicht klar, was das Leben war, aber das Leben hatte einen Duft. Diesen Duft verströmte es immer während der persischen Neujahrsfeierlichkeiten, Noruz, die mit dem Jahreswechsel am 21. März begannen. Vor diesem Fest fand stets der große Frühlingsputz statt. Nebenbei wurden die Vorbereitungen des Festes in Angriff genommen. Beim Jahreswechsel deckt man einen Tisch, den man Haftssin, also sieben »s«, nennt, weil auf ihm sieben vorgeschriebene Sachen zu stehen haben, die alle mit dem Buchstaben »s« beginnen. Bei unserem Haftssin-Tisch kamen selten die sieben Sachen zusammen, oft fehlte der eine oder andere s-Gegenstand, aber auch wir deckten den rituellen Tisch, der während der Feiertage so stehenbleibt. Das Schönste an den Feiertagen war, dass die Mutter uns neue Kleider nähte und wir neue Schuhe bekamen. Welche Aufregung! Meine roten, höchst unbequemen Lackschuhe, die ich zu einem der Neujahrsfeste bekommen hatte, mochte ich so sehr, dass ich mit ihnen auch nachts ins Bett ging.
Auf den Haftssin-Tisch kommen ein paar weitere Requisten dazu, die eine symbolische Bedeutung haben, wie ein Spiegel, ein heiliges Buch und Goldfische. Wir Kinder liebten die Goldfische. Meist bekamen sie von mir und meinen Schwestern Namen, und von diesem Moment an gehörten sie zur Familie. Wir verbrachten viel Zeit vor der Bowle mit den kleinen Fischen und redeten sogar mit ihnen. Für mich waren sie ein willkommener Anlass, meinen jüngeren Schwestern selbsterfundene Geschichten über Goldfische zu erzählen. Aber wehe, wenn eines der kurzlebigen Tierchen unerwartet früh das Zeitliche segnete! Das war eine Tragödie, die wir Kinder mit einer würdigen Beerdigung gut zu spielen wussten. Keine von uns hatte je einer Beerdigung beigewohnt. Was wir da nachspielten, kannten wir von Fernsehfilmen. Wir beerdigten den Goldfisch nach christlich-amerikanischem Brauch. Wir legten ihn in eine Streichholzschachtel, die wir zuerst mit Stoffresten, die von den Näharbeiten meiner Mutter übrig waren, tapezierten. Ich trug als Älteste den Pseudosarg auf der Handfläche und meine Schwestern folgten mir feierlich in den Garten, wo wir unserem Goldfisch in einer kleinen Grube die letzte Ruhe gewährten. Am Grab des Fisches wurde ein mit Ästen oder mit Streichhölzern gebasteltes Kreuz angebracht. Ein Begräbnis hatte in unserer Fantasie christliche Züge. Nicht selten wurde die Grabstelle auch einige Zeit nach der Beisetzung noch einmal feierlich aufgesucht, bis auch dieses Ritual sich mit der Zeit auflöste.





























