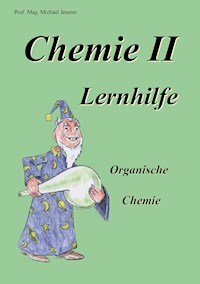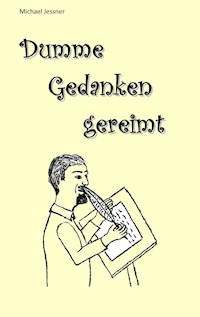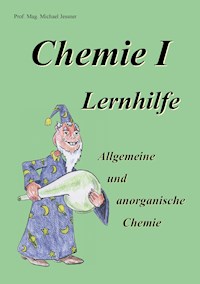
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
„Chemie I Lernhilfe“ ist ein übersichtlich gestaltetes Büchlein zur „Allgemeinen und anorganischen Chemie“. Konzipiert für OberstufenschülerInnen eines Gymnasiums, MedizinstudentInnen … Jenen, die schon Chemieunterricht haben oder hatten, wird es wegen seiner gerafften und anschaulichen Art - ohne dabei oberflächlich zu sein - das Lernen deutlich erleichtern. Auch Studierenden, die bisher trotz Mühen keinen Zugang zur Chemie fanden, wird diese Lernhilfe durch einfache Skizzen und verständlichen Text den Weg ebnen. Es soll jedoch keineswegs einen Chemieunterricht ersetzen, sondern als Begleitmaterial dienen. Weniger geeignet für „Chemie-Anfänger“!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichniss
Allgemeines
Einteilung der Chemie
Aufbau der Materie
Trennverfahren in der Chemie
Papierchromatografie
Atomaufbau
Atommodelle
Streuversuch von Ernest Rutherford
Isotope
Atommassen
Absolute Atommasse
Relative Atommasse
Mengenangaben in der Chemie
Mol
Chemische Grundgesetze
Die chemische Formelsprache
Chemische Gleichungen
Radioaktivität
Zerfallsreihe, Halbwertszeit
Bau der Elektronenhülle
Welle - Teilchen Dualismus
Orbital
Pauli - Prinzip
Hundsche - Regel
Das Periodensystem der Elemente (PSE)
Ordnungsprinzipien
Einteilung
Die chemischen Bindungen
Atombindung
Ionenbindung
Metallbindung
Kräfte zwischen Molekülen
Lösungen
Hydratation
Anomalie des Wassers
Wasserhärte
Wasser als Lösungsmittel
Osmose
Oxidationszahlen (OZ)
Name der Verbindungen.
Energieumsatz bei chemischen Reaktionen
Reaktionsenthalpie (ΔH)
Satz von Hess
Reaktionsentropie (ΔS)
Gibbssche Energie
Aktivierungsenergie (E
A
)
Das chemische Gleichgewicht
Das Massenwirkungsgesetz
Änderung der Gleichgewichtslage
Das Haber - Bosch - Verfahren
Das Boudouard - Gleichgewicht
Wichtige Nichtmetalle
Wasserstoff H
2
Sauerstoff O
2
Peroxide (- O - O -)
Ozon O
3
Luft
Redoxreaktionen
Wichtige Metalle
Vom Erz zum Metall
Eisen und Stahl
Corexverfahren
Stahlherstellung
Aluminium
Chemie und elektrischer Strom
Galvanische Elemente
Die Standard - Wasserstoffelektrode
Das pH - Meter
Korrosion
Stromspeicher
Primärzellen (Batterien)
Sekundärzellen (Akkumulatoren)
Die Brennstoffzelle
Elektrolyse
Säuren und Basen
Protolyse
Stärke von Säuren und Basen
Der pH - Wert
Pufferlösungen
Säure - Base ndikator
Neutralisation
Titration
Einige Gruppen und Elemente
Edelgase
Halogene
Schwefel S
Schwefelwasserstoff H
2
S
Schwefeldioxid SO
2
Schwefelsäure H
2
SO
4
Stickstoff N
Ammoniak NH
3
Stickstoffoxide NO
X
Salpetersäure HNO
3
Kohlenstoff C
Fullerene
Diamant
Grafit
Kohle
Aktivkohle
Kohlenmonoxid CO
Kohlendioxid CO
2
Kohlensäure (H
2
CO
3
)
Carbide
Silicium Si
Siliciumdioxid SiO
2
Kieselsäuren, Silicate
Glas
Zement
Keramische Stoffe
Silicone
Chemie und Umwelt
Stichwortverzeichnis
Periodensystem
Allgemeine und anorganische CHEMIE
Chemie ist die Lehre von den Stoffen, ihrem Aufbau, ihren Eigenschaften und ihren Umwandlungen!
Geschichtliches
Die Anfänge sind unbekannt. Schon in der Eiszeit wurden Feuer unterhalten (Stoffumwandlung i chemischer Vorgang!).
Mit dem Feuer kam die Zubereitung der Nahrung.
Später erlernte der Mensch die Töpferei, Gerberei und die Herstellung einfacher Genussmittel wie alkoholische Getränke, Essig ...
An Metallen gab es anfangs nur die Edelmetalle. Um ca. 3500 v. Chr. konnte Kupfer aus Malachit gewonnen werden. Aus Kupfer und Zinn fertigte man bald darauf Bronze. Um 1500 v. Chr. gab es auch schon Eisenwerkzeuge, jedoch sicher nicht in heutiger Qualität!
Das Färben von Stoffen mit Indigo (Bluejeans!) war in Ägypten bereits um 1700 v. Chr. bekannt!
Ca. 400 v. Chr. verwendete Demokrit den Begriff atomos (i Atome) und 50 Jahre später benannte Aristoteles vier Elemente:
Wasser, Feuer, Erde, Luft
Im Mittelalter suchten die Alchemisten nach dem Stein der Weisen. Paracelsus heilte im 16. Jahrhundert nicht nur mit Pflanzen, er stellte Arzneimittel auch chemisch her.
Die Trennung der Chemie von der Physik fand im 17. Jahrhundert statt:
Chemie eine eigene Wissenschaft!!!
Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren die meisten Elemente schon bekannt und im Periodensystem der Elemente geordnet.
1919 gelang die erste Elementumwandlung: Stickstoff i Sauerstoff! Der „Stein der Weisen“ war gefunden!
Und die Entwicklung bleibt nicht stehen. Man erzeugt neue Elemente, neue Farbstoffe, immer bessere Kunststoffe, wirksamere Medikamente, neue Hygieneartikel ...
Einteilung der Chemie
(nach hauptsächlichen Aufgabenbereichen)
* Allgemeine Chemie: allgemeine chemische Grundlagen wie Bindungsarten, Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften, Atombau ...
* Anorganische Chemie: Chemie der „unbelebten” Materie wie Luft, Wasser, Elemente, Metalle, Minerale ...
* Organische Chemie: Stoffe, die in der „belebten” Natur gebildet werden und deren Folgeprodukte.
* Biochemie: erforscht die Vorgänge in lebenden Organismen.
* Physikalische Chemie
* Analytische Chemie
* Theoretische Chemie
* Pharmazeutische Chemie ...
Die einzelnen Teilbereiche sind übergreifend und keineswegs als isolierte Wissenschaften anzusehen!
In der Industrie teilt man oft nach hergestelltem Produkt ein:
Farbstoffchemie, Kunststoffchemie, pharmazeutische Chemie ...
Aufbau der Materie
Der Physiker nennt alles Körper, der Chemiker alles Stoff.
Heterogene Gemenge erkennt man als Gemenge, homogene sehen wie ein Reinstoff aus.
Reinstoffe haben einen Schmelz- (Fp) und Siedepunkt (Kp), das heißt, dass auch bei weiterer Energiezufuhr die Temperatur nicht steigt! Sie steigt erst wieder, wenn alles geschmolzen oder verdampft ist.
Gemenge haben einen Schmelz- und
Siedebereich (ΔKp):
Temperatur
Temperatur
Trennverfahren in der Chemie: Extraktion, Filtration, Destillation, Adsorption, Zentrifugieren ... Chromatografie (je nach Trägermaterial): Gaschromatografie, Dünnschichtchromatografie ...
Papierchromatografie:
Ein spezieller Papierstreifen (Filterpapier) taucht in ein Lösungsmittelgemenge. Die Flüssigkeit steigt auf und nimmt dabei die verschiedenen Bestandteile der Substanz verschieden rasch mit. Nach einer bestimmten Zeit ist der Ausgangsstoff aufgetrennt. Lässt man daneben bekannte Stoffe „mitlaufen”, kann man so einzelne Stoffe oft schon identifizieren!
Achtung:
Gemenge werden durch physikalische, Verbindungen durch chemische Vorgänge getrennt! Zum Beispiel Eisen und Schwefel:
Das Gemenge kann durch einen Magneten getrennt werden,
die Verbindung nur noch durch chemische Vorgänge!
Den Aggregatzustand der Stoffe bestimmen die Anziehungskräfte zwischen den einzelnen Teilchen:
Feststoffe:
starke Anziehungskräfte - Ordnung über weite Bereiche:
→Fernordnung
Flüssigkeiten:
schwächere Anziehungskräfte - Ordnung begrenzt:
→Nahordnung
Gase:
extrem schwache Anziehungskräfte - keine Ordnung:
→ Unordnung
Atomaufbau
Da Atome extrem klein sind (ca. 10 -10 m!), kann man mit technischen Tricks (Rastertunnelmikroskop) höchstens ihre Oberfläche darstellen. Zu ihrer näheren Beschreibung verwendet man äußerst komplizierte mathematische Formeln. Um unser Vorstellungsvermögen trotzdem zu befriedigen, schaffen wir uns Modelle.
Doch Achtung: Es gibt keine „richtigen” Modelle!
Ein Modell kann nur dann „stimmen”, wenn es ausschließlich dazu verwendet wird, wozu es auch geschaffen wurde. Jedes Modell läuft Gefahr, „falsch” zu sein, wenn man es „zweckentfremdet”!
Man könnte einem Außerirdischen anhand eines Modellautos sehr wohl erklären, wie ein Mercedes aussieht, jedoch nur schwer, wie er funktioniert: Gas, Kupplung, Bremse, Gangschaltung ...!
Atommodelle
Demokrit (ca. 400 v. Chr.):
Nur scheinbar hat das Ding eine Farbe, nur scheinbar ist es süß oder bitter, in Wirklichkeit gibt es nur Atome und den leeren Raum.
John Dalton (1803):
Die chemischen Elemente bestehen aus sehr winzigen unteilbaren Materiepartikeln, Atome genannt, die ihre Individualität bei allen chemischen Vorgängen bewahren.
In einem angesehenen Lexikon von 1890, Stichwort Atome:
... hypothetische Teilchen, deren Existenz nicht nachgewiesen werden konnte.
Streuversuch von Ernest Rutherford (~ 1911):
Ergebnis:
die meisten Strahlenteilchen gehen ungehindert durch (→ der Großteil der Atome ist leerer Raum)
einige werden abgelenkt (→ es gibt Ladungen)
wenige werden reflektiert (→ es gibt „feste” Bereiche)
Atomaufbau
Name
Ladung (As)
Masse (kg)
Kern
Proton p
+
+ 1,6.10
- 19
1,673.10
- 27
Neutron n
0
1,675.10
- 27
Hülle
Elektron e
-
- 1,6.10
-
19
9,11.10
-
31
Die Kernbauteile nennt man Nukleonen.
Kerndurchmesser: ~ 10 % - 15 m
Hüllendurchmesser: ~ 10 % - 10 m
Kennzeichnung der Atome:
Atome eines Elementes haben immer dieselbe Ordnungszahl, jedoch nicht immer die gleiche Atommasse:
Isotope
Isotope sind Atome eines Elementes (gleiche Protonenzahl) mit verschiedener Neutronenzahl und damit unterschiedlicher Masse. So gibt es zum Beispiel drei verschiedene Wasserstoffisotope:
Radioaktive Isotope, gekennzeichnet durch Sternchen (*), haben große Bedeutung in der Medizin, bei Altersbestimmungen, für Materialprüfungen ...
Radioaktive Stoffe zerfallen mit einer ganz bestimmten Halbwertszeit:
Das ist jene Zeit, nach der die Hälfte des Stoffes zerfallen ist und deshalb nur mehr die Hälfte des Stoffes vorliegt!
Aufgetrennt werden die Isotope aufgrund der unterschiedlichen Ablenkung der ionisierten Isotope durch ein Magnetfeld (unterschiedliche Masse!).
Atommassen
Absolute Atommasse:
Masse der Atome in (Kilo) Gramm.
Relative Atommasse:
Einheit: 1u.
1u entspricht dem Zwölftel der Masse des Kohlenstoffisotops 12 C:
Da die Masse der natürlichen Kohlenstoffisotope (13 C, 14 C*) eingerechnet wird, hat Kohlenstoff nicht genau die Masse 12,0000 u!
Die Molmasse (bei Ionenverbindungen die Formelmasse) ist die Summe der Atommassen einer Verbindung: z. B.: Traubenzucker C8Hl206
Mengenangaben in der Chemie
Massenprozent:
wie viele mg eines Stoffes sind in 100 mg Substanz
Volumenprozent:
wie viele ml sind in 100 ml Lösung
Promille:
vom Tausend. Bei Alkohol im Blut in Massenteilen (mg/g) angegeben.
ppm (parts per million):
Teilchenzahl unter einer Million Teilchen (ein Münchner in München!)
ppb (parts per billion):
Teilchenzahl unter einer Milliarde Teilchen (sechs bestimmte Menschen auf der Welt!)
Molarität:
Anzahl der Mol pro Liter Lösung
Äquivalentkonzentration (Normalität):
Anzahl der Mol pro Liter, dividiert durch die Menge dessen, worauf es bei einer bestimmten Reaktion ankommt:
z. B.: Anzahl der übertragenen H+ oder e- pro Verbindung ...
Die Salzsäure (HCl) kann ein H+ abgeben, während die Schwefelsäure (H2SO4) zwei H+ pro Molekül abspalten kann!
Die Menge ein Mol entspricht:
der Menge von
6,022 . 10
23
Teilchen 1 Avogadro (Loschmidt) - Zahl
der relativen Atommasse (Mol-, Formelmasse) in Gramm
22,4 Liter
eines idealen Gases unter Normalbedingungen
(1013 mbar, 273 K).
Dies bezieht sich jedoch immer auf die Teilchen!
Diese Teilchen können jedoch auch Moleküle sein: