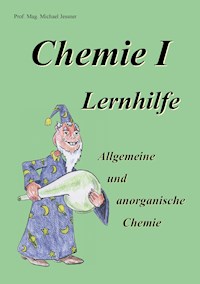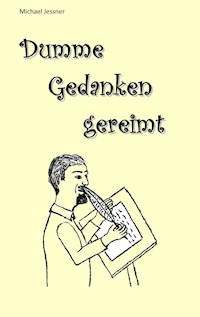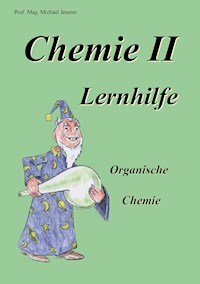
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
„Chemie II Lernhilfe“ ist ein übersichtlich gestaltetes Büchlein zur „Organischen Chemie“. Konzipiert für OberstufenschülerInnen eines Gymnasiums, MedizinstudentInnen … Jenen, die schon Chemieunterricht haben oder hatten, wird es wegen seiner gerafften und anschaulichen Art - ohne dabei oberflächlich zu sein - das Lernen deutlich erleichtern. Auch Studierenden, die bisher trotz Mühen keinen Zugang zur Chemie fanden, wird diese Lernhilfe durch einfache Skizzen und verständlichen Text den Weg ebnen. Es soll jedoch keineswegs einen Chemieunterricht ersetzen, sondern als Begleitmaterial dienen. Weniger geeignet für „Chemie-Anfänger“!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Bau organischer Verbindungen
Hybridisierung
Isomerie
Die Kohlenwasserstoffe
Alkane
IUPAC – Nomenklatur
Alkene
Alkine
Halogenkohlenwasserstoffe
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Kondensierte Aromaten
Kohle
Erdgas - Erdöl
Sauerstoffderivate der Kohlenwasserstoffe
Alkohole
Phenole
Ether
Aldehyde
Ketone
Carbonsäuren
Optische Aktivität
Ester
Fette und Öle
Seifen und Waschmittel
Kohlenhydrate
Monosaccharide
Disaccharide
Polysaccharide
Stickstoffderivate der Kohlenwasserstoffe
Amine
Nitroverbindungen
Amide
Aminosäuren
Proteine (Eiweiß)
Vitamine
Fettlösliche Vitamine
Wasserlösliche Vitamine
Kunststoffe
Farbstoffe
Periodensystem der Elemente
ORGANISCHE CHEMIE
Die organische Chemie beschäftigt sich hauptsächlich mit den Verbindungen, die von lebenden Organismen gebildet wurden und werden.
Da alle organischen Verbindungen Kohlenstoff enthalten, nennt man die organische Chemie auch noch die Chemie der
Kohlenstoffverbindungen.
Außer Kohlenstoff sind in organischen Verbindungen nur wenige andere Elemente zu finden: hauptsächlich H, O, N,
seltener Halogene(X), P, S …
und sehr selten Metalle wie Fe, Mg …
Die wichtigsten anorganischen Kohlenstoffverbindungen wurden in der allgemeinen und anorganischen Chemie behandelt:
Diamant, Grafit, Fullerene, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Carbonate, Hydrogencarbonate, Carbide …
Die Trennung zwischen anorganischer und organischer Chemie ist historisch bedingt. So war noch 1810 Berzelius davon überzeugt, dass zur Herstellung organischer Verbindungen die „vis vitalis“ nötig ist.
1828 gelang es einem seiner Schüler, dem Chemieprofessor Friedrich Wöhler, erstmals aus einem anorganischen Salz einen organischen Stoff herzustellen, und dies ganz ohne „Lebenskraft“, nur durch Erhitzen:
Bau organischer Verbindungen
Die Vielfalt in der organischen Chemie kann auf zwei besondere Fähigkeiten des Kohlenstoffes zurückgeführt werden:
Er kann
vier Atombindungen
eingehen
Er kann sich gut
mit sich selbst
verbinden
Neben Kohlenstoff wäre nur Silicium als Basis für organische Stoffe denkbar. Da jedoch ihre Bindungsenergie bedeutend geringer ist, sind sie auch viel unbeständiger:
C – C 347kJ/molSi – Si 226 kJ/mol
Organische Verbindungen können kettenförmig, verzweigt oder ringförmig sein. Wird der Ring nur aus Kohlenstoff gebildet, ist die Verbindung isocyclisch. Sind Fremdatome am Aufbau des Ringes beteiligt, ist sie heterocyclisch.
Die vorherrschende Bindungsart ist die
Atombindung
Diese bewirkt:
relativ
lange
Reaktionszeiten
eher
niedrige
Schmelz- und Siedepunkte, wobei bei stärkerem Erhitzen Verkohlung eintritt
Wasserlöslichkeit
nur
bei Vorhandensein von
polaren Gruppen
.
Zum besseren Verständnis sei nochmals die Elektronenanordnung des Kohlenstoffes angeführt:
1s22s22p2
Zur Erinnerung:
1, 2 … beziehen sich auf die Energieniveaus K, L …
S, p … bezeichnen den Orbitaltypus: kugelförmige s - Orbitale, hanteiförmige p - Orbitale …
S2 … die Hochzahl gibt die Menge der Elektronen in den Orbitalen an.
Eigentlich könnte auch ein CH2 - Molekül (analog: Kohlenmonoxid CO!) relativ stabil sein, doch der Kohlenstoff ist hauptsächlich 4 – bindig!
Hybridisierung
Die Elektronenanordnung des Kohlenstoffes nach steigender Energie (ls2 2s2 2p2):
im
Grundzustand:
im
angeregten Zustand:
im
hybridisierten Zustand:
Bei der Hybridisierung wird ein Elektron aus dem 2s - Orbital in das dritte 2p(z) - Orbital gehoben. Die neu gebildeten Orbitale der 2. Energiestufe bilden nun vier gleichwertige Hybridorbitale. Man spricht von sp3 – Hybridisierung.
Bei einer sp2 - Hybridisierung entstehen aus einem 2s - Orbital und zwei 2p - Orbitalen drei gleichwertige Hybridorbitale, wobei das dritte p - Orbital für eine weitere Bindung (π – Bindung; siehe Seite →!) zur Verfügung steht.
Bei einer sp - Hybridisierung kommt es zu einer Kombination eines 2s - mit einem 2p - Orbital. Dabei bleiben zwei p - Orbitale (pz + py) für zwei π – Bindungen übrig.
Der Winkel zwischen den Hybridorbitalen (weiß) beträgt:
Isomerie
In der anorganischen Chemie schreibt man für Verbindungen meist Summenformeln, in der organischen Chemie jedoch meistens Strukturformeln, da verschiedene organische Stoffe dieselbe Summenformel haben können:
Zwei verschiedene Stoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften!
Auch das Butan (C4H10) gibt es in zwei verschiedenen Formen:
geradkettiges n – Butan (Kp: - 0,5 °C)
verzweigtes iso – Butan (Kp: - 11,7 °C)
Kann man für eine Summenformel verschiedene Strukturformeln schreiben, die sich nur in der Anordnung der Atome unterscheiden, spricht man von Isomeric
Bei Molekülen mit Doppelbindungen tritt auch noch eine E – Z (früher: cistrans) Isomerie auf, da die freie Drehbarkeit im Gegensatz zur Einfachbindung aufgehoben ist: (siehe auch Seite →: Alkene!):
Die Kohlenwasserstoffe
Je nach Bindungsart zwischen den Kohlenstoffatomen unterscheidet man:
Alk
an
e mit nur Einfachbindungen
Alk
en
e mit Doppelbindungen zwischen den C – Atomen
Alk
in
e mit Dreifachbindungen
aromatische Kohlenwasserstoffe (siehe Seite
→
!)
Alkane
Alkane haben nur Einfachbindungen. Sie bilden eine homologe Reihe (Verbindungen einer homologen Reihe unterscheiden sich nur durch die Anzahl von CH2 – Gruppen!) mit der SummenformelCnH2n+2.
Ringförmig aufgebaute Alkane nennt man Cycloakane. Sie haben die Summenformel:CnH2n
Am stabilsten sind Ringe aus 5 bis 7 C – Atomen. Bei geringerer C - Zahl muss der Bindungswinkel zwischen den sp3 - Hybridorbitalen (normal 109°, siehe Seite →!) stark deformiert werden. Dazu benötigt man Energie.
Energiereiche Verbindungen sind jedoch nicht sehr stabil und können deshalb relativ leicht gespalten werden.
Reaktionen der Alkane
Gewaltsame Oxidation
(Verbrennung):
Diese Reaktion liefert 880 kJ/mol Verbrennungswärme.
Längerkettige Alkane haben einen noch höheren Wert.
Radikalische Substitution:
Zur Erinnerung: Radikale nennt man Verbindungen mit einfach besetzten Orbitalen
Die radikalische Substitution verläuft in drei Schritten:
Startreaktion:
Bildung von Radikalen (z. B. durch UV – Licht):
Kettenreaktion:
Die Radikale reagieren mit Molekülen, wobei immer wieder neue Radikale entstehen:
Kettenabbruch:
Aus zwei Radikalen wird ein Molekül:
oder:
Der große Nachteil dieser Reaktion:
Einerseits reagieren Chlorradikale mit schon gebildeten Halogenalkanen, andererseits können sich beim Kettenabbruch alle vorhandenen Radikale verbinden. So entstehen dabei immer Gemenge, die oft nur schwer zu trennen sind. Deshalb meidet man diese Reaktion und geht, wenn es möglich ist, andere Wege.
Eigenschaften der Alkane
Alkane sind relativ reaktionsträge, worauf auch ihr Trivialname hinweist:
Paraffine (parum affinis: wenig beteiligt)
Da Alkane unpolar sind, lösen sie sich in unpolaren Lösungsmitteln. Sie haben verhältnismäßig niedrige Schmelz- und Siedepunkte (nur geringe Anziehungskräfte zwischen den Molekülen!): Bis Butan sind sie bei Raumtemperatur gasförmig, vom
Pentan bis zum Hexadecan (Schmelzpunkt Fp: +18 °C) flüssig und ab
Heptadecan (Fp: +22 °C) fest.
Vergleiche H2O (polar!): Molmasse 18 u → Kochpunkt (Kp): +100 °C
CH4: 16 u → Kp: – 164 °C
Sie sind lipophil („fettliebend“) und hydrophob („wasserfürchtend“).
Die Viskosität (Zähflüssigkeit) nimmt mit der Kettenlänge zu. Sie steigt von Benzin über Diesel zu den Schmierölen.
Methan CH4
Methangas entsteht bei der Zersetzung organischer Stoffe und ist folglich Hauptbestandteil im Erdgas, Grubengas, Sumpfgas, Deponiegas …
Auch aus Klärschlamm kann es gewonnen werden und die von einer Rinderherde produzierte Menge ist ebenfalls beträchtlich. Methan fördert den Treibhauseffekt!
Es dient wie die meisten Alkane hauptsächlich der Energiegewinnung.
Nur ca. 5 % braucht man für Synthesen: z. B. Rußherstellung:
Wasserstoff - Synthesegas (Gemenge: Kohlenmonoxid und Wasserstoff) - Herstellung:
Propan C3H8 und Butan C4H10
werden durch Druck verflüssigt als Heizgase (Camping, Feuerzeug …) verwendet. In Spraydosen ersetzen sie die früher eingesetzten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs zerstören die Ozonschicht!). Der Nachteil der Kohlenwasserstoffe:
Brennbarkeit („Flammenwerfer“), Explosionsgefahr!
Längerkettige Kohlenwasserstoffgemenge sind Benzin, Petroleum, Diesel, Heizöle, Hydrauliköle, Schmiermittel …
Nomenklatur organischer Verbindungen
Viele organische Verbindungen haben Trivialnamen (alltäglich, allgemein bekannt), die sich auf ihre Herkunft oder Eigenschaften beziehen (Citronensäure …).
Die IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) bemüht sich um eine einheitliche, weltweit gültige Nomenklatur in der Chemie.
Diese internationale Vereinigung tritt alle zwei Jahre in Genf zusammen und stellt für alle verbindliche Regeln auf. Auch Chinesen und Japaner verwenden in der Chemie dieselben Zeichen wie wir.
IUPAC – Nomenklatur
Man nummeriert die längste durchgehende Kohlenstoff kette und beginnt damit von der Seite, dass die Kohlenstoffe mit „Anhängsel“ eine möglichst kleine Nummer bekommen, oder wo hochrangige Gruppen (siehe unten!) hängen
Bei Säuren ist der Kohlenstoff der COOH – Gruppe die Nummer 1. Die Menge der nummerierten Kohlenstoffe bestimmt die Stammsilbe des Namens.
Nach der Stammsilbe kommt je nach den Bindungsarten im Molekül
-an
,
-en
oder
-in
(Einfach-, Zweifach- oder Dreifachbindungen).
Bei Doppel- und Dreifachbindungen stellt man vor die Silbe -en oder -in