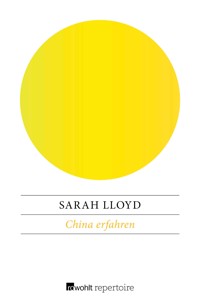
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Daß sie die hohe Kunst des Reisens – vorurteilsfrei und ich-bewußt sich Fremdem öffnen zu können – wie nur sehr wenige Autoren in der langen Geschichte der Reiseliteratur beherrscht, das hat Sarah Lloyd bereits in «Eine indische Liebe» bewiesen. «Ich stieg durch den Zaun und betrat eine andere Welt», so beginnt sie ihr Buch über China. Dank Sarah Lloyds instinktsicherer Kontaktfähigkeit erfahren wir, wie eine «alte Jungfer» und eine Dame des ehemaligen Großbürgertums, ein Straßenkehrer, ein Arzt und eine Intellektuelle im modernen China denken; wie Touristen und Schwarzhändler aus dem Westen sich in dem Land benehmen; wie Chinesen die Zeit, persönlichen Besitz, Freundschaft und das Unglück anderer verstehen. Wenn es so etwas gibt wie einen persönlichen Blick für kulturelle Strukturen – Sarah Lloyd besitzt ihn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Sarah Lloyd
China erfahren
Ein Reisebericht
Aus dem Englischen von Petra Post und Andrea von Struve
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Daß sie die hohe Kunst des Reisens – vorurteilsfrei und ich-bewußt sich Fremdem öffnen zu können – wie nur sehr wenige Autoren in der langen Geschichte der Reiseliteratur beherrscht, das hat Sarah Lloyd bereits in «Eine indische Liebe» bewiesen. «Ich stieg durch den Zaun und betrat eine andere Welt», so beginnt sie ihr Buch über China. Dank Sarah Lloyds instinktsicherer Kontaktfähigkeit erfahren wir, wie eine «alte Jungfer» und eine Dame des ehemaligen Großbürgertums, ein Straßenkehrer, ein Arzt und eine Intellektuelle im modernen China denken; wie Touristen und Schwarzhändler aus dem Westen sich in dem Land benehmen; wie Chinesen die Zeit, persönlichen Besitz, Freundschaft und das Unglück anderer verstehen. Wenn es so etwas gibt wie einen persönlichen Blick für kulturelle Strukturen – Sarah Lloyd besitzt ihn.
Über Sarah Lloyd
Sarah Lloyd, als Landschaftsarchitektin ausgebildet, hat sich seit ihrer englischen Schulzeit nie länger als ein Jahr an einem Ort aufgehalten.
Inhaltsübersicht
Für meinen Vater
Vorbemerkung
Wenn ich könnte, würde ich gern jene Chinesen mit Namen nennen und ihnen danken, die mir vertraut haben und ihre Geschichten erzählten. Aber ich kann ihnen nur im Herzen danken. Es gab Chinesen, die wegen antikommunistischer Überzeugungen und entsprechenden Äußerungen Ausländern gegenüber in Arbeitslagern festgehalten oder erschossen worden sind. Mag solches unter dem gegenwärtigen Regime auch unwahrscheinlich sein, könnte doch bei einem politischen Umschwung die Sicherheit der Betroffenen gefährdet sein. Außerdem möchte ich meinem Lektor und meinem Agenten danken, meinen Freunden in Hongkong, die mich untergebracht haben, und dem Ausländerexperten Jan, der ebenfalls einen andern Namen erhalten mußte. Von den Namen, die in diesem Bericht häufiger erscheinen, ist (mit Ausnahme bekannter politischer Gestalten) nur der von Rosy der wahre.
Die chinesische Währungseinheit ist der Yuan; drei Yuan entsprechen etwa einem amerikanischen Dollar. Ein Yuan sind 10 Jiao oder 100 Fen. Ausländische Besucher erhalten in China sogenannte Foreign Exchange Certificates (FEC), die ein zweites Währungssystem darstellen und für den ausschließlichen Gebrauch von Ausländern gedacht sind. Dieses Geld trägt dieselben Bezeichnungen wie gewöhnliches «Volksgeld», renminbi genannt.
Prolog
Ich kletterte durch den Zaun und betrat eine andere Welt. Es war wie ein Traum, als eine alte, schwarzgekleidete Frau leicht schwankend den Weg entlang kam, gebeugt unter der Last ihrer Schultertrage. Sie bog nach links in ein Feld ein – eine Erscheinung aus vergangenen Zeiten mit ihrer seitlich geknöpften Jacke, den wadenlangen Hosen und dem ausladenden Strohhut auf dem Kopf. Das schmale, schwarze Baumwolltuch an der Krempe ihres Hutes wehte sanft im Wind und schützte ihre Augen vor der Sonne.
Ihr Gesicht lag im Schatten. Sie war bemüht, mir den Rücken zuzukehren, während sie die jungen Pflanzen wässerte, als könnten Augen, ebenso wie Kameras, eines Menschen Seele stehlen. Sie stützte die großen Holzeimer mit den Händen, die Nackenmuskeln wie Seile gespannt. Wasser floß in bogenförmigen Rosetten dahin und fing die Sonnenstrahlen ein wie ein silberner Faden.
Den ganzen Tag, den ersten, den ich in Asien verbrachte, streifte ich an der Küste dieser abgelegenen, zu Hongkong gehörenden Insel umher. Ich folgte schmalen Pfaden durch Felder hindurch, erklomm die Landspitzen und stieg wieder zum Meer hinab, das einen salzigen Geruch verströmte. Die Wellen klatschten träge auf den felsigen Strand, schwappten gegen drachenförmige Gebilde aus rotbraunen Meeresalgen, welche die Flut angeschwemmt hatte. Eine Gruppe von Männern flickte Netze; einige Jungen wateten im seichten Wasser und versuchten Fische aufzuspießen.
Ich durchstreifte Dörfer; die umliegenden Felder umgab ein Dickicht aus hohem Gras und Bambus. An den sich anschließenden Hügelketten lagen, wie willkürlich verstreut, die Gräber der Vorfahren. Die niedrigen, grauen Häuser mit ihren flachen, glasierten Ziegeldächern scharten sich eng aneinandergedrängt am Wege; zugleich Durchgangsstraße und Wohnzimmer, öffentlich und privat und von schattenspendenden Matten bedeckt, dienten sie als Erweiterung für Küche, Vorratskammer und Hof. Die Häuser standen so dicht, daß ich mir wie ein Eindringling in eine häusliche Szenerie vorkam. Ich ging schnell und leise hindurch, um nicht die alte Frau beim Nähen und den Mann beim Holzhacken zu stören oder das Mädchen, das Kohlblätter auf Schnüre zog, um sie zum Trocknen aufzuhängen, und die Kinder, die mit Steinen spielten. Vögel sangen in Bambuskäfigen; Wäsche baumelte an Bambusstangen. An den Mauern lag Brennholz aufgestapelt, davor standen große, runde Körbe, Taubenschläge, Blumentöpfe, Tische und Stühle. Die Häuser wurden durch Miniaturschreine mit Weihrauchgaben, Bildern von Schutzgöttern und den verblaßten, roten Bannern vom letzten Neujahrsfest beschützt. Schweine grunzten im Koben; Hühner gackerten im Auslauf; Hunde machten mit Gebell darauf aufmerksam, daß es sich um Privateigentum handelte.
Die Häuser selbst wirkten geheimnisvoll. Zwar waren die Türen nur angelehnt, aber die Räume blieben im Dunkeln und verrieten nichts über ihre Einrichtung. Die Fenster waren klein und mit einem Staubschleier bedeckt. In meiner Vorstellung sah ich Hausaltäre, Ahnentafeln und Schriftrollen und sehnte mich danach, einen Blick hineinzuwerfen.
Ich durchstreifte Gemüsefelder – das am sorgfältigsten bearbeitete und am intensivsten genutzte Land, das ich je gesehen hatte, lange Streifen Erde, erhöht wie Schokoladenriegel, dazwischen etwa dreißig Zentimeter breite Pfade, die Ränder sorgsam abgedichtet. Frauen jäteten Unkraut mit Hacke oder Händen; Männer brachten Wassereimer an Schultertragen von Brunnen. Es war eine Gartenlandschaft, ein Wandteppich, aus dem Grün der Pflanzen gewebt. Kürbisse wuchsen an Pergolen, Erbsen an Reisiggerüsten, Pfeilkraut und Wasserbrotwurzeln in von Wasser überfluteten Feldern, Sellerie und Karotten mit ihrem fedrigen Grün. Zwischen den einzelnen Beeten gab es Komposthaufen, Wasserspeicher und glasierte Kübel, in denen menschliche Exkremente aufbewahrt wurden. Es gab Vogelscheuchen auf Stöcken mit schwarzen Bauernhemden und rosa Plastikfetzen, die an Bindfäden flatterten. Vögel zwitscherten im Dickicht und balancierten auf Leitungsdrähten. Es gab Schreine für die Erdgötter mit Trögen für Weihrauchstäbchen. Wassergeister wohnten in Quellen; Erntegötter herrschten über Felder. Es gab große Tempel mit Figuren auf dem Dachfirst und Tüchern aus verblaßtem, rotem Satin, mit Blumen bestickt. Die Gräber, Schreine und Tempel sahen auf das Meer hinaus.
Die Melaleucabäume biegen sich im Wind. Die Berge sind entweiht, ihr Inneres aufgerissen von zerstörerischen Maschinen. Hinter Sheung Shui betreten wir Sperrgebiet. Hier gibt es Beete mit Brunnenkresse und Flüsse und Teiche. Der Zug hält: die Menschen staunen über den Regen. Güterwagen warten auf einem verlassenen Rangiergleis, zum Bersten voll mit quiekenden Schweinen. Dann kommt Lo Wu. Ein Pfeil weist nach China. Ich betrachte die Gesichter, als wir die Grenze überqueren, Soldaten in Grün, rundbäckig und verlegen dreinblickend, junge Mädchen mit großen Schirmmützen, die die Pässe kontrollieren. Ihr harmloses Aussehen ist seltsam beängstigend, es verrät weder etwas von ihrer Vergangenheit noch von dem Land, das vor mir liegt.
Unterwegs
Es war noch nicht ganz hell, als wir den Fluß überquerten und Kanton hinter uns ließen. Die städtischen Wohnsiedlungen gingen allmählich in ländliche Anbauflächen über. Wir fuhren durch eine Art Niemandsland, geprägt von einem lebhaften Wechsel aus Beton und Ackerland, eine merkwürdige Verschmelzung, ungeplant und vorübergehend. Die Wolken hingen tief, grau und kalt. Es war Anfang Februar, Chinesisch Neujahr.
Der Morgen dämmerte über den Stoppelfeldern. An einem Teich hütete ein Hirte seine Entenschar. Auf einem abgeernteten Zuckerrohrfeld weidete eine Büffelherde. Abseits der Straße gab es traditionelle Dörfer mit enggedrängten Häusern, um kleine Gassen und dichte Bambushaine geschart. Abgesehen von den schlanken Baumreihen entlang der Straße, hätte dies auch China vor der Befreiung sein können. Vieles ließ erkennen, daß die Menschen arm waren: die Mauern aus Lehmziegeln und die Hütten aus Schilfmatten, die von Hand bestellten Felder und die zerbeulten Strohhüte. Die durchhängenden Hausdächer, die Komposthaufen, die von Wagenrädern durchfurchte Erde am Straßenrand trotzten jeglicher Ordnung und Kontrolle. Als wir an den Fluß kamen, hielten wir an. Wir stiegen aus dem Bus und überquerten das Wasser in einem Boot.
Die zwölfstündige Fahrt in Richtung Süden nach Zhanjiang führte uns abwechselnd durch sanfte, vereinzelt mit Kiefern bewachsene Hügel und terrassenförmig angelegte Reisfelder, die sich wellenartig kräuselnd auszudehnen schienen. Dieses Bild sollte typisch für einen Großteil Südchinas sein, eine harmonische Landschaft von menschlicher Größe und Gestaltung. In den ersten Tagen folgten meine Augen wie gebannt dem Puzzle aus uneingezäunten Gärten, verweilten kurz bei den eleganten, rotbraunen Gräsern, den salatgrünen Farnen und den dunklen Rhododendren, die wie Flaum die Hügel unterhalb der Kiefern bedeckten. Diese standen in so großen und unregelmäßigen Abständen und waren so kümmerlich gewachsen, daß ich zunächst dachte, sie hätten sich selbst ausgesät. Ihre Äste waren so spärlich, daß mein Blick über mehrere wellige, gefurchte Hügelketten dahinwanderte, bis er in der Ferne an den Kronen winziger Kiefern hängenblieb, die sich dunkel, schablonenhaft, gegen den Himmel abzeichneten. Viertausend Jahre lang hatten diese Hügel die Ebene ernährt, hatten ihre Kräuter sammeln und ihre Erde abtragen lassen, um die ausgelaugten Äcker wieder fruchtbar zu machen.
Nur ein einziges Mal an diesem Tag wurde meine westlich geprägte Vorstellung von China durch ein Landschaftsbild bestätigt: kiefernbewachsene Bergkämme, die sich im Dunst verloren, und Bambus, der wie riesige Farne die Ufer des breiten, silbrigen Flusses säumte, auf dem Flöße aus Bambusrohr und Sampans wie Insekten auf einer Glasscheibe dahinglitten. Die Landschaft erinnerte mich vor allem an Indien. Ich fühlte mich wieder nach Pandschab versetzt, umgeben von Reisfeldern und Raps und hoch aufragendem Zuckerrohr; ich spürte die trockene, braune Erde und die kraftvoll-grobe Beschaffenheit des Lehmbodens, der mit der Hand umgegraben wurde. Es gab dort die gleichen Baumarten, die gleichen Tümpel am Wegrand und die gleichen buntscheckigen Hirtenstare, die in der Erde pickten. Aber hier herrschte ein Überfluß an Grün, der in Indien fehlte; der Ackerbau wurde sorgfältig betrieben, die Hänge waren bewaldet und die Teiche fischreich.
Die Ähnlichkeit mit Indien kam für mich genauso überraschend wie die Anmut des Baustils, der ein sicheres Gespür für Rhythmus und Harmonie ausdrückte und sich von Stunde zu Stunde änderte. Ich bemerkte wokförmige Giebelwände an ehemals öffentlichen Gebäuden, Drachenornamente auf Gesimsen und mit Holzschnitzereien verzierte ehemalige Tempel; ich sah ganze Ortschaften mit nach oben geschwungenen Dächern, jenem bewußt angewandten Kunstgriff, einen Eindruck von Licht und Erleuchtung zu vermitteln, Heim und Himmel miteinander zu verbinden, yang durch eine Geste mit yin in Einklang zu bringen.
Das hatte ich nicht erwartet. Auf revolutionären Wandzeitungen wurde das Landleben immer als Inbegriff von vollkommener Ordnung und selbstloser Produktion hingestellt, als ein Netz aus Kanälen, Strommasten und Überlandleitungen, ein Land, das streng in Kommunen unterteilt war, in dem die Menschen in weißgetünchten Gebäuden auf engstem Raum zusammenlebten. Diese Darstellungen verfälschten die Wirklichkeit der natürlich gewachsenen Dörfer und unregelmäßig angelegten Felder und schufen statt dessen ein Bild von emsigen, rotwangigen Arbeitern, die sich die abgezirkelten Felder vornahmen, von Traktoren, die den idealen Boden bearbeiteten, und von Anhängern, vollbeladen mit den geernteten Kohlköpfen, von Fabriken für Agrarprodukte und modernen Wasserkraftwerken; sie waren genauso naiv und idealisierend wie die Reklame für eine Pauschalreise. Während der gesamten acht Monate meines Chinaaufenthalts sah ich kein einziges Mal, daß Traktoren zur Feldarbeit eingesetzt wurden; statt dessen wimmelte es auf den Straßen von kleinen, zweirädrigen Handtraktoren, die, mit einer Lenkgabel versehen, den Transport von Lasten übernahmen. Nie sah ich eine dieser Kommunen, wie sie auf Plakaten geschildert wurden. Die Felder waren klein und lagen brach. Die rotwangigen Genossen bekam ich nie zu Gesicht.
In dem Begriff «Kommune» schwingt im Westen immer noch ein drohender, unheilvoller Unterton mit, obwohl er in China offiziell gar nicht mehr benutzt wurde. Eine Kommune war keine sichtbare Einheit, sondern ein Verwaltungsbezirk, in dem vierzig-, fünfzig- oder auch hunderttausend Einwohner zusammengefaßt waren und dessen Zentrum ein Ort mit Marktrecht war. Die einsame Hütte auf dem fernen Hügel war möglicherweise zwanzig Meilen von der nächsten Behausung entfernt, gehörte aber dennoch einer Volkskommune an. Wäre ich mit einem Fallschirm hier gelandet, hätte ich zunächst nicht sagen können, in welchem Land ich mich befand oder um welches Wirtschaftssystem es sich handelte – es hätte ebensogut ein feudalistisches mit Grundherren, Pächtern und Leibeigenen sein können. Auf dem Land war der Kommunismus so wenig erkennbar, als wäre Chinas jüngste Geschichte nur ein Traum gewesen.
Auf den gesamten vierhundert Kilometern zwischen Kanton und Zhanjiang, einer Hafenstadt im Süden von Guangdong – und die Hauptstadt dieser Provinz –, sah ich kaum eine Stadt. Daß vier Fünftel der Bevölkerung auf dem Land lebten, war augenfällig. Dort, wo das Land bebaut wurde, lagen die Dörfer etwa einen Kilometer voneinander entfernt und waren durch schmale Feldwege miteinander verbunden. Es gab keine Straßen, keine Straßenschilder und keine Straßengräben. Es gab nur wenig Verkehr, ein paar Busse und Fahrräder und gelegentlich einen tiefgrünen Lastwagen der Volksbefreiungsarmee. Diese Hauptverkehrsverbindung zwischen zwei Großstädten war gerade so breit wie ein englischer Feldweg.
Obwohl wir numerierte Sitzplätze hatten, gab es Panik beim Einsteigen. Alle schubsten und drängelten in den Bus, ohne vorher die Fahrkarten vorzuzeigen, und wurden dann wieder am Rockzipfel hinausgezerrt, auf eine für Reisende und Schaffner gleichermaßen unwürdige Weise. Dann stürmte jeder zu seinem Sitz, Sack und Pack wurden im Gang aufeinandergetürmt, während Fahrer und Beifahrer, beide in mehrere Lagen blauer Baumwolle gehüllt und mit weichen Schirmmützen auf dem Kopf, sich vorn im Bus aus einer Kiste für die Füße und einer schmuddeligen, wattierten Decke ein Lager herrichteten. Während der eine fuhr, machte es sich der andere gemütlich und zog genüßlich an seiner bong, einer Wasserpfeife aus Bambusrohr, die dann vorn herumgereicht wurde.
Die meisten Mitreisenden waren Männer. In ihrer sackartigen, proletarischen Einheitskleidung in Blau-Grün-Grau wirkten sie auf mich alle gleich, nicht voneinander zu unterscheiden. Sie rauchten, redeten oder dösten vor sich hin, mit dem Kopf an den Vordersitz gelehnt. Ich saß hinten, neben einer jungen Bauersfrau mit struppigem Haar und einem Baby auf dem Rücken. Als das Baby unruhig wurde, löste sie die Bänder des Tuchs, worin es eingewickelt war, entfernte den Tragriemen, schob meine Knie beiseite und hielt es ab, damit es sein Scherflein zu den bereits vorhandenen feuchten Häufchen aus Erdnußschalen, Melonenkernen und Zigarettenkippen beitragen konnte. Der Bus roch nach Kot und Nikotin, Knoblauch und – unvermittelt frisch – nach Mandarinen.
Vor mir saß ein pensionierter Lehrer, der mit seiner Frau nach Zhanjiang unterwegs war, um die Neujahrsfeiertage gemeinsam mit seinem Sohn zu verbringen. Er konnte etwas Englisch – oder hatte vielmehr vor vierzig Jahren einmal Englisch gelernt, wie er sogleich richtigstellte. Die Stirn vor Konzentration gerunzelt, kramte er in seinem nachlassenden Gedächtnis nach Worten, und nachdem er drei, vier passende gefunden hatte, präsentierte er sie mir wie ein Geschenk. Ich hielt mich indessen krampfhaft an seiner Rückenlehne fest, da der Fahrer ungeachtet der Straßenverhältnisse aufs Gaspedal trat und wir hinten in die Luft geschleudert wurden und unsanft, unter Flüchen, wieder auf unseren Sitzen landeten. Nur die letzten siebzig Kilometer war die Straße ungeteert – aber angenehm glatt.
Um neun Uhr hielten wir zum Essen an. Da ich annahm, daß wir noch öfter Rast machen würden, verzichtete ich auf die Mahlzeit und schaute mir lieber das hinter fahlbraunen Feldern gelegene Dorf an – ein Fehlschluß, wie sich herausstellen sollte. Sogar der Lehrer, der sich wie alle anderen reichlich mit Klößchen und Klumpen von gedämpftem Reis eingedeckt hatte, beschwerte sich nachmittags bei seiner Frau: «Was ist bloß mit diesem verfluchten Fahrer los? Hat er denn überhaupt keinen Hunger?»
Aber mein Ausflug ins Dorf hatte sich gelohnt. Das dunkle, holzkohlengeschwärzte Mauerwerk war mit Farbklecksen übersät, mit scharlachroten Neujahrswünschen links und rechts der Türen und Glücksbringern darüber: eine Laterne, ein Mandarin und eine welke Frühlingszwiebel. Ein Konfetti aus abgebrannten Feuerwerkskörpern sprenkelte die Straßen, eine Frau kniete vor einem Schrein. Am Ufer eines Flüßchens standen wacklige Hütten auf Pfählen, und auf den Sampans zogen die Bewohner den Fisch zum Trocknen auf Schnüre auf.
Kurz nach unserer Rast kamen wir durch eine Gegend mit engverschachtelten Dörfern, von turmähnlichen Gebäuden überragt. Bis zum dritten oder vierten Stockwerk schlicht, fast wie eine Festung, entfalteten sich diese im fünften oder sechsten Stock zu einer Blüte aus Balustraden, Kuppeln und Gewölben und sogar Türmchen in der Art fürstlicher Burgen. Ich hielt sie für Wachtürme, zur Verteidigung gegen Banditen und die Armeen eroberungswütiger Kriegsherren, war mir aber nicht sicher. In diesem Moment drehte sich der Lehrer wieder zu mir um und fixierte mich mit schwermütiger Miene. Ich erwiderte seinen Blick in der Hoffnung, von ihm etwas über die Geschichte dieser Häuser, die einer so märchenhaft gespenstischen Phantasie entsprungen schienen, zu erfahren.
«Das ist Land», verkündete er mit Nachdruck, «nicht Stadt.»
Während wir in diesem alten, arg mitgenommenen Bus dahinholperten, spürte ich eine Verbundenheit mit dieser Landschaft, die sich auf einer Zugfahrt nie einstellen könnte. Ein Zug führte ein Eigenleben, das ihn von dem Leben jenseits der Fenster abschnitt. Aber der Bus war ein Teil des Landes, durch das er fuhr, hatte eine Beziehung zu den Menschen auf der Straße – alte Männer, zu Fuß unterwegs, die Hosenbeine mit Schnur zusammengebunden, junge Männer auf Fahrrädern oder einen Handkarren hinter sich her ziehend, Mädchen mit Rattenschwänzen, zu zweit oder dritt – und paßte sich unter Hupen und Ausweichmanövern den geographischen Gegebenheiten an. Züge folgten dem Weg des geringsten Widerstandes, schlängelten sich durch Tunnels, umfuhren Ortschaften und Städte, rumpelten auf Bahndämmen entlang – ein künstliches Netz über einer jahrhundertealten Landschaft aus Hügeln und Flüssen, Kanälen und Feldern, in die sich die Straße einfügte. Im Bus gab es keine Gemeinschaft: die Fahrt war laut, die Straße holprig, die Sitze unbequem, die Aufmerksamkeit richtete sich auf das Land.
Das chinesische Wort für Landschaft ist shan-shui, Berge und Wasser. Es ist ein weit bescheidenerer Begriff als der deutsche, da «Landschaft» auch Mensch, Betrachter, Besitzer mit einschließt – christliches Herrschaftsprinzip im Gegensatz zur taoistischen Lehre vom Einswerden mit der Natur.
Während westliche Nationen sich inzwischen bemühten, den letzten Rest unzerstörter Natur zu bewahren, schienen es die Chinesen paradoxerweise auf die Ausbeutung der ihren abgesehen zu haben. Da nur ein Achtel Chinas landwirtschaftlich nutzbar ist, und das auch nur mit Hilfe künstlicher Bewässerung (die übrige Fläche besteht aus Gebirge, Wüste und Hügelketten), muß um jedes Fleckchen Boden gerungen werden. Wo Ackerbau betrieben wird, haben Vieh, Schafe oder gar Naturschutzgebiete keinen Platz. Ebensowenig können es sich die hoffnungslos armen Bauern leisten, ihre Ernte mit Vögeln und wilden Tieren zu teilen. In den fünfziger und sechziger Jahren zog die Partei gegen die sogenannten vier Plagen zu Felde: Fliegen, Moskitos, Ratten und Spatzen. Jeder lief mit einer Fliegenklatsche herum, und die Vögel wurden von einer mobilisierten, auf Töpfe und Pfannen einschlagenden Bevölkerung so lange herumgescheucht, bis sie vor Erschöpfung tot zu Boden fielen.
Noch nie hatte ich so wenig Vögel gesehen. Es gab Nistplätze zwischen den Feldern – Tümpel und Flußufer, Klippen und Gestrüpp –, aber die Lüfte waren leer, die Gewässer still. Immer noch wurden Vögel abgeschossen: ich sah sie reihenweise gerupft in den Nudelbuden liegen. Sie wurden als musikalische Zierde in Käfige gesperrt, und die Verwendung von Insektenvertilgungsmitteln war weit verbreitet.
In den botanischen Gärten in der Nähe von Kanton hatte ich mich über die fehlenden Schildchen gewundert. Ich fragte einen der Botaniker, einen Mann mit borstigem Haar und spitzbübischem Grinsen, mit Namen Yao.
«Früher hatten wir Porzellanetiketten», gab er zur Antwort, «aber die Leute haben sie zerschossen.»
«Zerschossen?»
«Na ja, früher kamen sie hierher, um Vögel zu schießen, hauptsächlich, um sie zu essen, aber auch nur so zum Spaß. Als die Partei dann verbot, Tiere in Parks oder anderen Schongebieten zu erlegen, ärgerten sie sich und schossen statt dessen auf die Etiketten.» Anderswo gab es keine Möglichkeit, diese Vorschrift durchzusetzen. Geschützte Pflanzen wurden herausgerissen, um sie als Zierpflanzen zu verkaufen, und einige Arten waren schon fast ausgestorben. «Dann benutzten wir Aluminiumetiketten», erzählte Yao weiter, «aber die wurden gestohlen. Und jetzt haben wir welche aus Plastik. Die will niemand.»
Sogar die Bäume mußten in China strammstehen, sozialistische Bäume in Reih und Glied oder in Regimentern in staatlichen Schonungen: fremde Arten in verfremdenden Formationen. Von dem heimischen subtropischen Wald mit seinen Fischschwanzpalmen und Bambusgewächsen, den riesigen Schachtelhalmen, Schilfpalmen und Farnen, den ich an den Hängen westlich von Kanton gesehen hatte, war entlang der Hauptstraße Richtung Süden und in ganz Südostchina nichts mehr übrig. Keine Blumen blühten, selbst Insekten waren rar. Nichts war sicher, weder Pflanze noch Vogel noch Fisch noch sonstiges Getier – und auch nicht der Mensch, wie ich später feststellen sollte.
Inzwischen wurde ein Amt für Umweltschutz innerhalb des Land- und Forstwirtschaftsministeriums eingerichtet, und langsam begann man umzudenken. Aber 1984 herrschte die weitverbreitete Meinung, daß die Natur nur zum Nutzen der Menschen existierte. Die einzige Ausnahme, der Pandabär, der in den Bergen West-Szetschuans lebte, war eine Frage internationalen Prestiges. Nur etwa tausend blieben übrig, wovon die Hälfte vom Aussterben bedroht war, als der Pfeilbambus, die Hauptnahrungsquelle des Panda, nach seiner Blüte abstarb. Zoologen versuchten, den Panda in einer anderen Gegend anzusiedeln, hätten dann aber auch eine unwillige tibetische Bevölkerung umsiedeln müssen. Währenddessen hielt man die Pandas mit Schafsköpfen und Schweinefleisch, dem Lieblingsgericht der dortigen Bevölkerung, am Leben.
1905 segelte ein amerikanischer Bodenspezialist, Dr. F.H. King, auf dem damaligen Hauptverkehrsnetz, einem weitverzweigten System von Wasserwegen, durch China. Seine Beobachtungen hielt er in dem Buch Farmers of Forty Centuries fest. Seit damals hat sich wenig geändert. Die Bauern wendeten noch dieselben landwirtschaftlichen Methoden wie vor 4000 Jahren an. Fast jede Arbeit wurde mit der Hand verrichtet. Kanalufer, Straßenböschungen und Feldränder wurden zusätzlich zu den Äckern bebaut, aufbereitete Tümpel zur Fischzucht genutzt. Jedes Blatt und jeder Halm wurde kompostiert und wieder untergepflügt. Man sammelte Kräuter in den Bergen, pflückte Wasserhyazinthen von den Teichen, fegte jedes heruntergefallene Blatt von der Straße auf, fischte Wasserpflanzen aus den Seen und dem Meer. Alles wanderte auf den Kompost: Schlamm aus Kanälen, Stroh von undichten Dächern, Ziegel von eingestürzten Lehmmauern, Dung und Holzasche und Getreidestoppeln und Samen und jede Menge menschlichen Abfalls. Am Straßenrand sah ich Sammelbehälter für Altpapier, Metall, Plastik und Glas. Federn wurden zu Staubwedeln, Lumpen zu Papier, Flicken, Mops und gepolsterten Sohlen von Stoffschuhen, Knochen zu Knöpfen, wollene Strickjacken (aufgezogen und neu gestrickt) zu langen Unterhosen, Haare zu Perücken, Kohlenstaub zu Briketts. Der Kot der Seidenraupe ergab Dünger und Medizin, die Schmetterlingspuppen wurden verspeist, und der Abfall an Seide zu Steppdecken verarbeitet – Mehrzweckernten, mehrfach geerntete Felder, jede Möglichkeit wurde wahrgenommen.
1905 erforderte die Armut noch größere Anstrengungen, um das Äußerste aus dem Boden herauszuholen. Die Gegend um Kanton brachte damals jährlich vier Ernten hervor, und ein Sechstel eines fruchtbaren Morgen Lands reichte aus, um einen Chinesen zu ernähren. Dr. King sah, wie Bauern die Erde von Reisfeldern und Obstgärten austauschten, in dem Glauben, daß beide Böden davon profitierten. Er sah fast zwei Meter hohe Stapel frisch geschnittenen Klees, der zwischen Lagen von Schlamm in Fäulnis überging. Er sah Böden, dick bedeckt mit Schlick aus dem Kanal, und terrassenförmig angelegte, kaum serviettengroße Felder.
Damals war die Straße kaum mehr als ein Feldweg, gerade breit genug für einen Karren, von Sänften und Kulis, Bauern und Händlern mit Schultertragen und einrädrigen Handkarren bevölkert, die zur Steigerung der Antriebskraft mit Segeln ausgestattet waren. (Berichten zufolge immer noch in Gebrauch.) Abholzung wurde schon seit Hunderten von Jahren betrieben, nur wenige Bäume spendeten den schmalen Feldwegen Schatten, und die Hügel standen gerodet und kahl da. Tempel und kleine Schreine waren über die Felder verstreut, Grabhügel überzogen wertvollen Ackerboden. Der durchschnittliche Grundbesitz einer Bauernfamilie betrug damals einen Morgen Land, zwang die Armen zur Kindestötung und die Ärmsten der Armen, als Banditen herumzuziehen. Der Überlebenswille rief Brutalität hervor: Sippen bekämpften einander, Banditen plünderten, Kriegsherren waren darauf aus, ihren Machtbereich auszudehnen.
Jahrhundertelang hatten die Chinesen geglaubt, die Natur wimmelte von übersinnlichen Kräften, die sie verehrten, besänftigten und fürchteten. Die Welt besaß eine Seele: Bäume, Teiche, Felsen, Quellen, sogar der Erdboden lebte. Nach der überlieferten Wissenschaft des feng-shui, wörtlich «Wind-Wasser», durchzogen Energieströme das Universum und beeinflußten das Schicksal der Menschen. Durch geschickte Manipulation der äußeren Lebensbedingungen, angefangen bei der Lage einer Stadt, in der die Menschen lebten, über den Standort ihrer Gräber, bis hin zur Anordnung der Möbel in ihren Wohnungen, und die zeitliche Abstimmung von Ereignissen, konnte man das Gute anziehen und das Böse abwenden. Doch wenn ich danach fragte, ob feng-shui immer noch praktiziert wurde, erhielt ich nur eine schroffe Abfuhr, oder man leugnete seine Existenz. Während der Kulturrevolution war der alte Volksglaube verboten, die sogenannten Erdwahrsager wurden verfolgt und flohen nach Taiwan oder Hongkong. Gebildete Chinesen hatten keine Zeit für feng-shui, einer Antithese zur Philosophie des wissenschaftlichen Denkens, der man inzwischen allgemein huldigte.
«Wie kann es sein», spottete mein botanischer Freund Yao, «daß man allein dadurch, daß man seine Großmutter an einem günstigen feng-shui-Ort zum richtigen Zeitpunkt beerdigt, wohlhabend wird? Feng-shui ist weiter nichts als das blinde Vertrauen in abergläubische Bräuche, die weder auf einer wissenschaftlichen Grundlage noch auf gesundem Menschenverstand basieren. Der Respekt der Leute davor war früher rein materialistischer Natur. Und was das yin-yang-Prinzip betrifft, so kann man das auf alles beziehen. Wenn man lacht, ist es yang. Wenn man weint, ist es yin. Was soll das für einen Sinn haben?»
Schließlich erfuhr ich doch, welche bedeutende Rolle feng-shui im alltäglichen Leben der Bauern noch spielte, obwohl mir keiner der Erdwahrsager Näheres erzählen wollte. Statt dessen suchte ich nach einem sichtbaren Zeichen in der Anlage und Gestaltung von Dörfern entlang der Straße – ein ebenso illusorisches Unterfangen wie die Suche nach der legendären Musterkommune. Nichts in den Dörfern wies darauf hin, daß sie nach den Angaben des ortsansässigen Geomanten gebaut worden waren, maßgebend schienen allein Topographie und Schutzfunktion gewesen zu sein. Die Erfordernisse des feng-shui deckten sich häufig mit praktischen Erwägungen, was auch immer Yao und die Pragmatiker glauben mochten, und stimmten mit planerischen Entwürfen überein: Grabstätten an trockenen Berghängen und Wohnstätten, durch Nadelgewächse oder Hügel vor kalten Nordwinden geschützt, den Eingang Richtung Süden und fließendes Wasser in der Nähe. Wurde mittels feng-shui etwas offenbart, das der Landschaftsplaner intuitiv erfaßte? Gründete sich des Planers Analyse auf eine Kenntnis lebensspendender Kräfte, deren Existenz er wahrscheinlich abstreiten würde?
Fahlbraune Felder von unterschiedlicher Form und Größe säumten die Straße. Wir verlangsamten unser Tempo und umfuhren eine kleine Neujahrsprozession, die sich durch ein Dorf bewegte, um künftiges Unheil abzuwenden. Ihr Anführer trug eine Drachenmaske, und hinter ihm sprang ein Dutzend Menschen sich windend und krümmend herum, schwang einen Schweif aus schäbigem Flickwerk auf Stangen hin und her. Andere schwenkten Fahnen, schlugen auf Trommeln, schmetterten Becken, ließen Knallfrösche los und drohten mit Dreizacken und Speeren. Ihre stampfenden Füße wirbelten Staubwolken auf – wie die Hufe galoppierender Pferde.
Ich hatte das Chinesische Neujahrsfest oder Frühlingsfest, wie es richtig hieß, in Kanton verbracht. Als am Silvesterabend die Dämmerung hereinbrach, lagen die Straßen wie ausgestorben da. Durch die älteren Wohnviertel kreuzten und schlängelten sich Gassen, an grauen Ziegelmauern und holzverkleideten Wänden vorbei. Die letzten Einkäufer eilten nach Hause, junge Mädchen mit frischen Dauerwellen, eine Frau mit einem Huhn, das an einer Schnur baumelte. Ein Mann war gleich mit dem Streichen seiner Tür fertig. Läden und Verkaufsstände waren geschlossen und verrammelt, wie zur Sperrstunde in einer belagerten Stadt. Knallfrösche knatterten in festlicher Verschwendung, ihre erschöpften Überreste wie Blütenblätter des Klatschmohns über die Steine verstreuend. Ein Geruch von Schießpulver lag in der Luft.
Der Himmel war purpurfarben. Von den Dächern reckte, dunkel und stachelig, die Königin der Nacht ihre langen Kaktusglieder über graue und weiße Mauern. Jede Tür war von willkommenheißenden Neujahrsversen eingerahmt, golden auf scharlachrotem Grund. Durch die offenen Fenster sah ich Familien in neuen, leuchtenden Kleidern um ein Festmahl aus Gans oder Ente versammelt, in frisch mit Papier ausgekleideten, mit farbenprächtigen Scherenschnitten und Neujahrsbasteleien geschmückten Räumen, überquellend von Schalen süßlich duftender Narzissen und reich mit Früchten beladenen Kumquatbüschen, von ausladenden Pfirsichbäumchen, blaßrosa Blüten an kahlen Zweigen. Der Duft von Blumen und gebratenem Fleisch vermischte sich an den Türschwellen mit dem würzigen Geruch von Weihrauch. Den Göttern wurden Früchte als Opfergaben dargeboten, den Ahnen zu Ehren Papiergeld verbrannt. Entlang des Kanals schimmerten die vielen Scheiben der Sprossenfenster wie bunte Weingummirhomben. In dieser Nacht würde niemand schlafen gehen.
Am Neujahrstag drängten sich Scharen herausgeputzter Menschen in den Straßen, kauften Kekse und Süßigkeiten, ließen sich im Strom puffender, schwerfälliger Schlangen dahintreiben. Daß sich Menschen an einem kalten, nassen Tag so voller Begeisterung durch die Stadt schoben, in den Pavillons der Parks für Aufnahmen posierten, die Blumen an den Eingängen der Restaurants bewunderten, lediglich von der Erinnerung an das Festmahl vom Vorabend und der Vorfreude auf die kommenden drei Feiertage berauscht, ließ die Mühsal ihres täglichen Lebens erahnen.
Nach Zhanjiang zu färbten sich die grauen Dörfer rosa, und die Erde wurde rot und trocken. Wellenförmig ausgewaschen, befanden sich in den Senken hier eine Sisal- oder Ölpalmenplantage, dort eine Hecke aus Krummholzkiefern. Verglichen mit der Erinnerung an das neujährliche Kanton, erschien hier alles arm und mager: das Land, die Menschen, die Ernte, die Bäume. Nur die Schweine waren rund und rosa und wühlten mit ihren Rüsseln in steinigen Feldern nach Knollen.
Bei Einbruch der Dämmerung erreichten wir Zhanjiang. Nachdem ich zehn Tage lang Kanton erkundet hatte, eine für China untypische, da vom Ausland am stärksten beeinflußte Stadt, freute ich mich darauf, endlich das wahre China, das China Maos, kennenzulernen. Aber ich wurde schnell eines Besseren belehrt. Das totalitäre System offenbarte sich auf einen Schlag: breite, leere Straßen, die von großen, grauen Gebäuden und gestutzten Bäumen flankiert wurden, eine Platzverschwendung, die der chinesischen Tradition intensivster Bodennutzung zuwiderlief, und die rosigen Plakate über die Ein-Kind-Familie, die voller Zuversicht in eine geistig erneuerte Zukunft blickte. Das für ausländische Gäste obligatorische Hotel stand wachsam und dominierend am Ende der Straße, groß und abstoßend wie alle anderen Gebäude auch, aber mit einer Reihe flatternder roter Fähnchen versehen.
Sogar innerhalb der wenigen, Touristen zugänglichen Hotels galten unterschiedliche Vorschriften für «ausländische Freunde» und gewöhnliche Chinesen. Während Chinesen zwischen verschiedenen Unterkünften wählen konnten, mußten westliche Touristen Zimmer der oberen Preiskategorie nehmen und für dieses Privileg weit mehr als jeder andere – ob ausländischer Experte, Student oder hochgestellter Chinese – bezahlen. Eines Abends in Szetschuan, Monate später, war ich darüber besonders verärgert, da sämtliche Ausländern zugeteilte Betten belegt waren und mir nichts anderes übrigblieb, als mich nachts quer durch die Stadt zu einem noch teureren Etablissement zu begeben. Ein Chinese hingegen, der kurz nach mir angekommen war, hatte einen der begehrten Schlafplätze (für ein Viertel des Preises) ergattert. Neugierig folgte ich ihm einen Gang entlang, um eine Ecke herum, über einen Hof, einige Stufen hinauf, nach rechts, dann links, dann wieder links in ein anderes Gebäude und in einen Raum, in dem sich einhundertzehn Betten und sieben Fernseher befanden. Mindestens achtzig Betten waren noch unbelegt – ich wäre für jedes dankbar gewesen.
Aber bei meiner Ankunft in Zhanjiang war das Hotel noch halb leer. Vom Fenster aus blickte ich auf einen öden, viereckigen Hof, von gefängnisähnlichen Mauern umschlossen. Die Unterkunft war spartanisch, aber ausreichend, ein Prototyp der noch folgenden fünfzig Hotelzimmer. Ein hartes Holzbett, eine zusammengelegte Steppdecke diagonal über dem Fußende. Ein Kopfkissen, mit einem Handtuch bedeckt und mit Laub gefüllt. Ein Moskitonetz, das in einem Knoten von der Decke hing. Weißgetünchte Wände voller zerquetschter Moskitos. Terrazzofußboden und blaue Gummischuhe. Ein Schreibtisch mit Stuhl, ein Eimer, ein Spucknapf, ein Spiegel, ein Aschenbecher, ein Ventilator (aber kein Heizofen), eine Wäscheleine, ein paar Teetassen, eine Thermoskanne und eine Emailleschüssel.
Was chinesische Gepflogenheiten anbetraf, so sprach das Hotelzimmer Bände: Maos Aufruf zu Genügsamkeit, traditioneller Lerneifer, propagierte Hygiene und Sparsamkeit, die nationale Vorliebe für Tee und Tabak. Das Bettzeug zusammenzufalten rührte aus jener Zeit, als Betten aus Platzmangel im Wohnzimmer standen und Besuchern als Sitzgelegenheiten dienten. Steppdecken wurden so drapiert, daß ihre Drachen-Pfingstrosen-Stickereien zur Geltung kamen. Schuhe waren in einem Land allgegenwärtig verdreckter Fußböden, das von Bilharziose heimgesucht wurde, unbedingt erforderlich. Fußboden wurde mit Erdboden gleichgesetzt und bespuckt, mit Abfall überhäuft, aber selten gründlich geputzt. Möbel im rechten Winkel zur Wand anzuordnen ging auf die konfuzianische Tradition von Sittlichkeit und Ordnung zurück. Die Lässigkeit westlicher Arrangements wirkte auf die meisten Chinesen immer noch anstößig. Die Kargheit des Mobiliars – nichts «feudalistisch» Altes, nichts «bürgerlich» Elegantes, nichts «sinnlich» Bequemes – symbolisierte Disziplin und gediegene Zweckdienlichkeit, zwang zum Denken und Handeln in enggesteckten Bahnen.
Die meisten Gäste waren Männer. Sie reisten in staatlichen Geschäften und, nicht daran gewöhnt, von zu Hause fort zu sein, machten einen seltsam gehemmten und verlorenen Eindruck. Während westliche Touristen ein Zimmer wirklich bewohnten, ihre Habseligkeiten ausbreiteten, die Möbel entsprechend ihren Bedürfnissen zurechtrückten und sich so benahmen, als wären sie zu Hause, verhielten sich Chinesen im Hotel zurückhaltend und wußten nichts Rechtes mit ihrer Zeit anzufangen. Sie lehnten an der Rezeption, blätterten in den Propagandazeitschriften, studierten eifrig die Zeitungen in den Glasvitrinen, schlurften mit leeren Thermoskannen den Gang entlang, hingen auf ihren Betten oder lümmelten auf dem Treppenabsatz vor dem Fernseher herum. Ihre Türen waren angelehnt, unabhängig von der Temperatur oder dem Lärm draußen. Vielleicht fühlten sie sich einsam. Vielleicht wollten sie zeigen, daß im Zimmer nichts Verdächtiges vor sich ging. Vielleicht sollte auch nur der Rauch abziehen.
Der Krach war sogar bei geschlossener Tür unerträglich. Stimmen drangen durch die offenen Lüftungsgitter, Wasser rumorte in den Rohren neben meinem Bett, Schritte von eisenbeschlagenen Schuhen hallten durch den Gang, und lebhaftes Kartenspiel tobte im Nebenraum. Erst um Mitternacht wurde es endlich ruhig. Um vier Uhr morgens begann der Spektakel von neuem: Aufstehen, Kofferpacken und den Bus erwischen; Hupen, Lautsprecher, Radios, Motoren und am lautesten und scheußlichsten die Knallfrösche zu Neujahr.
Ich befand mich schließlich in einem kommunistischen Land. Obwohl ich davon weder in Kanton selbst noch auf meiner Reise Richtung Süden viel zu spüren bekam, machte das Hotelpersonal in Zhanjiang und anderswo doch deutlich, daß es nicht dazu da war, die Gäste zu bedienen oder zu hofieren, sondern nur eine vom Staat auferlegte Pflicht zu erfüllen hatte. Wenn mein Chinesisch nicht ausreichte, so war es mein Problem, nicht ihres. Morgens um sieben kam das Zimmermädchen, ohne anzuklopfen, herein, obwohl ich noch im Bett lag. Während ich schlief, pochte sie an die Tür, um mich daran zu erinnern, sie auch richtig abzuschließen. Ließ ich sie offen, wenn ich heißes Wasser holte, wurde ich wegen meiner Nachlässigkeit gerügt. Bekam ich das Schloß nicht auf, erwiderte das Mädchen leichthin, sie könne mir auch nicht helfen, und ließ mich hilflos im Gang stehen. Sehr oft konnte ich überhaupt nicht ins Zimmer, weil das Mädchen mit den Schlüsseln nirgends zu finden war. Dann marschierte ich den Gang auf und ab und schlug gegen Türen, bis sie schließlich am Ende des Ganges auftauchte und gemächlich, bedächtigen Schrittes, auf mich zukam, einen Stapel Spucknäpfe oder einen Mop aus Lumpen in den Blaus und Olivgrüns chinesischer Einheitskleidung unter dem Arm.
Nach zwei trostlosen Nächten unter klammen, muffigen Steppdecken und zwei Regentagen in unfreundlichen, grauen Straßen, von Raps und Reis zehrend, fuhr ich weiter Richtung Süden. Es war der bisher graueste, dunstigste und nieseligste Tag. Während der sechsstündigen Fahrt zur Halbinsel Leizhou konnte ich wenig von der vorbeiziehenden Landschaft erkennen, nur die in Nebel gehüllten Bäume, ärmliche Dörfer aus Lehm und Stroh und weite Flächen kargen Lands. An der Spitze der Halbinsel ging ich an Bord eines Tankschiffs und trat die zweistündige Überfahrt nach Haikou an, einer Stadt im Norden der Insel Hainan.
Ich fuhr nach Hainan, um das kalte Wetter, das das Festland heimsuchte, gegen die tropischen Strände der Südküste dieser Insel einzutauschen. Aber von Haikou abgesehen, sei die Insel immer noch verbotenes Gebiet, teilte man mir auf der Behörde lächelnd und Tee trinkend mit. Sie könnten mir jedoch einen Wagen mit Fahrer zur Verfügung stellen, für 100DM pro Tag, und einen besonderen Vermerk in mein Visum eintragen, was sie gerne für mich erledigen würden. An der Busstation weigerte man sich, mir einen Fahrschein für den normalen Bus zu verkaufen, weil ich keine Genehmigung besaß, doch schließlich entdeckte ich eine Mini-Busgesellschaft, die sich nicht um irgendwelche Vorschriften scherte, solange ich den Fahrpreis bezahlte.
Als wir die Ostküste entlang Richtung Süden fuhren, kündigte die Vegetation bereits das tropische Klima an. Braungelbe Felder wurden von Ananasgewächsen und Pfeffersträuchern abgelöst. Senken erhoben sich zu kautschukbedeckten Hügeln, an die sich eine Ebene fruchtbarer, schwarzer Erde anschloß, wo mattschwarze Büffel und aus Basalt gebaute Dörfer im Silberdunst schimmerten und junge Reispflänzchen ihre dünnen Halme emporreckten. Weiter südlich wurden die Reissetzlinge in schneckenspurähnlichen Reihen gepflanzt, und Bauern in blauen Hemden und konischen Hüten waren tief über lichtüberflutete Felder gebeugt.
Auf der anderen Seite der Bucht, gegenüber dem kleinen Hafen von Sanya, wo Frauen in schwarzen Sarongs Fische am Kai trockneten, begann die private Welt des Gästehauses. Ringsum durch Mauern abgeschirmt, öffneten sich die Zimmer zur Veranda hin, von Kokospalmen beschattet und von hochrangigen Kadern (Parteifunktionären) und ausländischen Gaststudenten, die hier ihre Ferien verbrachten, frequentiert. Während der Kulturrevolution hatte die ganze Anlage zum Privatbesitz der Mao-Witwe Qiang Qing gehört. Sie büßte nun für die Missetaten der Vergangenheit in einem Pekinger Gefängnis, wo es ihr immer noch besser als den meisten Chinesen ging.
Durch die zerzausten Fransen der Kasuarinen sah man die weiße Sichel eines Korallenriffs die graugrünen Wellen zerteilen. Kader kamen in Gruppen und standen in ihren hochgeknöpften Anzügen am Rand des Wassers. Sie blickten aufs Meer, drehten sich zu ihren Genossen um, fuchtelten mit den Armen, tauschten Platitüden aus und gingen weiter. Ausländer streckten sich auf dem scharfkantigen, weißen Strand aus und röteten ihre Glieder unter unbarmherzig glühenden Wolken. Die Menschen vom Dorf aber machten sich das Meer zu eigen, fingen Fische von geflickten Booten, pflückten Strandschnecken von Korallenbänken und gruben nach Herzmuscheln im Watt. Ganz aus Knien und Strohhüten bestehend, kauerten sie an der Küste, bewegten sich, ohne sich aufzurichten, weiter – wie eine Kolonie Krebse.
Dorf und Gästehaus trennte eine fast zwei Meter hohe Mauer, Symbol für die im ganzen Land herrschende Kluft zwischen Reich und Arm, Privilegierten und Nicht-Privilegierten. Die Kader im Gästehaus nahmen sechsgängige Menüs zu sich, Schlange und Seepolyp, Entenei und Aubergine, Huhn und Garnele, während die Dorfbewohner einfachen gekochten Reis aßen. Jedes Zimmer hatte einen eigenen Schlüssel – im Dorf hingegen gab es nichts zu stehlen. Es war ein freundlicher Ort mit palmwedelgedeckten Lehmhütten, sein Rhythmus vom Baldachin der Palmen bestimmt, der bewegliche Schattenrosetten auf den Sand warf. Die fehlenden Mauern zeugten von Vertrauen; Früchte hingen zum Verzehr an den Bäumen. Wären nicht die Strohhüte gewesen, die asiatischen Gesichter und die Neujahrswünsche, die die Türen einrahmten, hätte dies eher Haiti als China sein können. Hier gab es die gleiche Vegetation, die gleichen sonnenversengten Hügel, den gleichen trägen Zyklus eines Lebens, an Farbe und Wärme und den Früchten des Landes und des Meeres reich gesegnet. Ich berührte die Pflanzen, fühlte die gegen die nahende Kälte gespeicherte Wärme, saugte den Geruch des Meeres ein und lauschte dem Aufklatschen der Wellen am Strand – schon bald würde ich all dies verlassen müssen.
Nach drei weiteren Tagen im klapprigen Bus über holprige Straßen erreichte ich Nanning, die Hauptstadt der Provinz Guangxi. Schon lange vor der Stadtgrenze kündigte sich ihre Nähe durch breitere Straßen, qualmende Schornsteine und große Flächen Ödlands an. Dann kamen Fabriken, Stromleitungen, Menschenschlangen an Bushaltestellen und Rohbauten inmitten von Gemüsefeldern. Graue Wohnblocks folgten auf brachliegende Felder, folgten auf Telegraphenmaste, folgten auf Geröllhaufen, folgten auf staubige Pfade, folgten auf armselige Hütten. Menschen drängten sich um Essensbuden und wühlten in den städtischen Müllhaufen. Aber im Zentrum von Nanning herrschte ein farbenprächtiges, geschäftiges Treiben, und tintenschwarze Bäume standen Spalier.
Es war Winter in Nanning und regnete schon seit einem Monat. Die Feuchtigkeit hatte die gesteppten Decken durchdrungen, und die Menschen grauten sich davor, ins Bett zu gehen, tranken mao tai, einen wodkaähnlichen Schnaps, um einzuschlafen, lagen aber trotzdem steif da und wurden nicht warm. Doch ich – im Vorübergehen – genoß den Regen, die glänzenden Straßen, die sich in Pfützen spiegelnden Gebäude und Fahrräder, die tropfenden Bäume, die wie frisch gespülte Flaschen funkelten, die Plastikregencapes in hinreißenden Pastelltönen – Rosa und Hellblau und Aquamarin –, die wie Opale in einer silbergrauen Unterwasserlandschaft glitzerten. Ich setzte meine Kapuze auf und planschte ungesehen zum großen offenen Markt, mit seinem Angebot an schillernden Schuhen und hauchdünnen Tüchern wie Feenflügel, gestreiften Plastiktaschen, Mänteln, Bändern, Knöpfen und Socken, deren Farbenpracht es mit jedem Regenbogen aufnehmen konnte. Und Schnüre und Säcke und Sägen und Sättel und Fischnetze. Und gekochter Reis, in Bananenblätter gerollt, und Gongs und Zimbeln, Münzen und Armreifen aus Jade und gesalzene Gemüse in Plastikschüsseln. Und die chinesischen Hackklötze aus Baumstämmen und Eier, Fleisch, Fisch und Früchte, Hunde und Hühner, Enten und Affen, Tauben und Schildkröten, Eulen und Eidechsen, Schlangen und Katzen und Schuppentiere. Und nach einem Monat kam die Sonne hervor. Eine Brise wehte die Blätter in einem Schauer von den Bäumen, und ein Mann stand alleine auf dem Dach des höchsten Gebäudes und schaute in die Sonne. In Nanning war der Frühling eingezogen.
Bei Xiuying zu Hause
Es klopfte an meine Zimmertür. Ein junges Mädchen mit Rattenschwänzen stand im Gang und blickte mich unsicher an.
Ein Wortschwall brach über mich herein. «Es tut mir leid, Sie zu stören – ich übersetze gerade eine Kurzgeschichte aus einer Zeitschrift, aber da gibt es Wörter und Ausdrücke, die nicht in meinem Wörterbuch stehen. Ich arbeite in der Universitätsbibliothek – sehen Sie, hier ist mein Ausweis.» Sie zog die Karte aus einer leuchtendroten Hülle und hielt sie mir vor die Nase. «Ihr Name stand im Hotelregister, aber sie versuchten, mich davon abzuhalten, zu Ihnen hochzukommen. ‹Was willst du von einer Ausländerin?› fragten sie mich. Da erzählte ich ihnen, wie dringend ich Hilfe brauche und daß Sie meine letzte Rettung sind. Ich war verzweifelt, verstehen Sie?»
«Komm herein», sagte ich. Wir setzten uns nebeneinander auf mein Bett. Sie legte eine Mappe auf ihren Schoß, eine Sammlung von Geschichten aus dem Asian Magazine, von einem Freund in Peking kopiert. Sie stellte sich mir als Yen Xiuying vor. (Yen ist der Familienname, Xiuying wird ‹Chiuing› ausgesprochen.)
«Das ist das einzige Material, das ich zum Übersetzen habe.» Sie blätterte hastig die schmieriggrauen, schlechtgedruckten Seiten durch und verzog das Gesicht. «Seit der Kulturrevolution ist in China keine neue Literatur mehr entstanden, nur Bücher, in denen die politischen Fehler der Ultralinken analysiert werden. Die Welt muß voller guter Bücher sein, nur wir können hier keine bekommen. Als die Bücher meiner Eltern beschlagnahmt und verbrannt wurden, war ich noch ein kleines Kind.» Die jüngste Kampagne fand im Herbst 1983 statt, als man in einem Feldzug gegen die «geistige Verschmutzung» in China, mit anderen Worten, gegen die korrumpierenden westlichen und feudalistischen Einflüsse, Bibliotheken und Buchläden schloß und nach Romanen und anderem konterrevolutionären Material durchsuchte. Westliche Kleidung, westliche Diskomusik und westliche Gepflogenheiten – kurze Röcke, Schnurrbärte und Schriftsteller, die sich mit menschlichen Problemen befaßten – waren gleichermaßen verpönt in diesem vorübergehenden Wiederaufleben des Maoismus.
«Es gab ein paar vernünftige Taschenbücher in den Hotelbuchläden in Kanton», fiel mir ein. «Aber wahrscheinlich würden sie dich dort nichts kaufen lassen.»
«Ja», stimmte sie mir zu, «sie würden uns nicht hereinlassen. Sie glauben, wir würden irgend etwas anstellen.»
«Was denn anstellen?»
«Wir könnten die ausländischen Gäste stören. Manche Chinesen würden sie um ausländische Währungen oder Exchange Certificates bitten.» Foreign Exchange Certificates waren die Währung, mit der Besucher bezahlen sollten. Die meisten Touristen tauschten sie mit großem Gewinn gegen die einheimische Währung, renminbi. «Sie meinen, wir machen die Sofas und Teppiche schmutzig und werfen Zigarettenkippen auf den Boden», fuhr sie fort. Dann kam sie auf den eigentlichen Grund zu sprechen. «Es gibt Mädchen, die für Geld mit Ausländern schlafen.» Diese Eröffnung wurde später von einem Neuseeländer bestätigt, der sich von einem dieser Mädchen den Tripper geholt hatte.
Xiuyings Offenheit überraschte und beeindruckte mich. Ich war erstaunt, daß sie den Mut hatte, das Thema Sex überhaupt anzusprechen; in ihrer sprichwörtlichen Prüderie durften junge Frauen gar nicht wissen, daß es so etwas gab. Nicht, daß man ihnen erzählte, Sex sei schlecht, man erzählte ihnen überhaupt nichts. Aber diese Offenbarungen kamen erst später. Wir verbrachten die ersten zwei Stunden unserer Bekanntschaft damit, daß wir den Übersetzungstext durchgingen, eine Geschichte über einen jungen indischen Einwanderer in Kuala Lumpur und seine Schwierigkeiten, an der Universität aufgenommen zu werden, die nur einen geringen Prozentsatz an Ausländern zuließ. Die Geschichte stammte von 1962.
Xiuying wollte nicht nur die genaue Bedeutung jedes einzelnen Wortes und jedes Satzes wissen – an sich schon keine einfache Aufgabe, da im Text Ausdrücke in Malaiisch und die Namen von Hindufesten vorkamen, ebenso Verweise auf archaische Prüfungsordnungen und Begriffe wie «Hamburger», zu deren Erläuterung es Zeichnungen und zehnminütiger kulturgeschichtlicher Exkurse bedurfte, weil sie ganz sichergehen wollte –, sie wollte auch den tieferen Sinn der Geschichte verstehen. Jedesmal, wenn sie etwas Neues begriffen hatte, lächelte sie und freute sich. «Du bist meine Retterin!» rief sie aus. Aber wenn sie mich darum bat, ausführlicher auf das malaiische Bildungssystem einzugehen oder zu erklären, warum sich Chandra ärgerte, als er keinen Studienplatz bekam, schien sie mit meinen Antworten weniger zufrieden.
«Warum sollte er studieren dürfen, wenn seine Noten nicht gut genug sind?» fragte sie naserümpfend.
«Seine Ergebnisse waren nicht schlecht, sondern die Konkurrenz zu groß, und es gab zu wenig Plätze für Ausländer.»
Chandras Lehrer hatte ihm geraten, den Eingangstest zu wiederholen, woraufhin Chandra seinen Lehrer beschimpfte. Diese Reaktion war Xiuying völlig unbegreiflich.
«Er ist einfach faul», wiederholte sie.
«Nicht unbedingt», erwiderte ich. «Der Autor will damit sagen, daß das System ungerecht ist.»
«Aber er war nicht gut genug, um hineinzukommen», beharrte sie. Mir war klar, daß sie an Chandras respektlosem Verhalten und seinem Mangel an Fleiß Anstoß nahm. Aber sie empörte sich vor allem darüber, daß Chandras Chancen, wie gering auch immer, doch weit größer waren als ihre eigenen. Yen Xiuying war in dem Bewußtsein aufgewachsen, daß nur drei von hundert Schülern Zugang zu höherer Schulbildung hatten und daß sie dafür mit Leib und Seele arbeiten mußten, Tag für Tag mit an Besessenheit grenzender Hingabe. Manche, die das Ziel nicht erreichten, begingen Selbstmord, weil das Lernen seit zweitausend Jahren mit das Wichtigste im Leben war: die Leiter zum Erfolg. Sie empfand kein Mitgefühl für Chandra.
Nur eine sehr beherzte und entschlossene Chinesin hätte den Schneid, ein großes Hotel zu betreten und an die Tür einer Ausländerin zu klopfen. Nur eine Bauersfrau oder eine aufmüpfige Natur würde ohne jede Förmlichkeit und Vorrede gleich zur Sache kommen. Das imponierte mir an ihr, und wir kamen sofort gut miteinander aus.
«Bist du verheiratet?» wollte sie wissen.
«Nein, ich bin nicht verheiratet.»
«Glaubst du denn nicht an die Ehe?»
«Schon, aber nicht unbedingt für mich. Ich weiß, daß es für dich etwas anderes ist.»
«In China heiratet fast jeder. Sogar Blinde und Taube. Nur die mit einer körperlichen Mißbildung will niemand. So wie mich.»
Sie berührte ihr Gesicht. Ein graubraunes Muttermal bedeckte die ganze linke Gesichtshälfte. Es war das erste, was mir ins Auge fiel, als ich die Tür öffnete, aber nachdem ich mich mit ihr unterhalten und angefreundet hatte, nahm ich ihre Ehrlichkeit und Lebenskraft wahr, ihre mandelförmigen Augen und ihre pfirsichweiche Haut, jeder ihrer Züge in perfekter Harmonie zueinander. Ihr Muttermal zählte nicht länger.
Der Anti-Schönheitskult wurde immer noch vom kommunistischen Regime betrieben, aber Xiuying wollte nichts davon wissen. In staatlichen Zeitschriften wie Women of China ließen sich Bauernmädchen und unscheinbare Arbeiterinnen im grellen, wenig schmeichelhaften Scheinwerferlicht photographieren. Maos Verherrlichung der kräftigen, sonnengebräunten Bäuerin verfehlte ihre Wirkung bei den intellektuellen Klassen, die dem westlichen Schönheitsideal nacheiferten. Ein heller Teint bedeutete Status, außer bei Ausländern, und blieb nach wie vor ein Hauptschönheitsmerkmal.
«Du hast ein sehr hübsches Gesicht, Xiuying. Aber selbst wenn es nicht so wäre, würde man dich schon allein wegen deiner Persönlichkeit heiraten.»
«Nein», widersprach sie, «Männer wollen eine schöne Frau, die sie vorzeigen können. Aber das ist mir egal!» fuhr sie trotzig fort. «Ich werde nicht heiraten. Ich werde mich ganz auf meine Arbeit konzentrieren.»
«Erzähl mir von der Bibliothek.»
«Ich werde dir erzählen, wie es dazu kam, daß ich dort arbeite. Nach der Schule wurde ich, wie alle anderen auch, aufs Land geschickt. Wir fanden es schrecklich. Ich hatte das Glück, daß ich von der Feldarbeit befreit wurde, um den Kindern im Dorf Englisch beizubringen. Danach studierte ich Englisch an der Universität. Meine Lehrer waren alle Chinesen, deshalb ist mein Englisch auch voller Fehler», fügte sie entschuldigend hinzu. Ich widersprach ihr, wie es von mir erwartet wurde. Xiuying blickte starr geradeaus, auf die weißgetünchte Wand. «Ich wollte Englischlehrerin werden. Meine Noten waren gut genug, aber die Kader in meinem Fachbereich sagten, ich könne keine Lehrerin werden wegen meines Aussehens.»
«Das haben sie wirklich in deiner Gegenwart gesagt?»
«Sie sagten, mein Muttermal sei unattraktiv. Sie behaupteten, mir einen Gefallen zu tun, indem sie mir eine Stellung in der Bibliothek gäben. Würden sich die Leute in England über mich lustig machen?»
«Ein paar würden dir vielleicht auf der Straße etwas Unfreundliches nachrufen.»
«Das passiert hier auch.»
«Und die Bibliothek?»
Hätte ich Xiuying vor acht oder sogar nur fünf Jahren gefragt, ob ihr der Beruf Spaß macht, hätte sie geantwortet: «Mein Land braucht mich für diese Arbeit.» Sie hätte nicht zuzugeben gewagt, daß ein Beruf dem anderen vorzuziehen sei. Heute gestand sie ein: «Der Job ist langweilig. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, interessieren mich nicht, deshalb konzentriere ich mich ganz aufs Übersetzen. Wenn die anderen im Wohnheim abends zusammensitzen und schwätzen, übersetze ich Geschichten, damit andere sie auch lesen können.»
«Wie denken die anderen Mädchen darüber?»
«Sie halten mich für hochnäsig, weil ich mich zurückziehe. Aber ich mag diesen Tratsch nicht, so gehässig und immer dasselbe, wer was über wen gesagt hat und was in den Familien der Kollegen abläuft.» Die Geschlechter unternahmen selten etwas gemeinsam. Während die Jungen spielten oder auf ihren Instrumenten übten, strickten die Mädchen Pullover und unterhielten sich. Über jedes ihrer Opfer wurde in allen Einzelheiten hergezogen, über Charakter, Verhalten, aber vor allem über das Aussehen. Ein Mädchen war «fett», wenn es runde Wangen hatte oder wenn es etwas dicker war als eine andere. Das Asian Magazine war erschöpft, und Xiuying brauchte neue Geschichten zum Übersetzen. Spontan fiel mir nichts ein. Sie hatte einmal einen Amerikaner kennengelernt, der ihr Exemplare von Reader’s Digest geschickt hatte. «Aber dann hörte er einfach auf damit», sagte sie schmollend, «ich weiß nicht warum.»
Am nächsten Tag regnete es. Ich fuhr mit dem Bus durch die Vororte hinaus zur Universität, um mich mit Xiuying dort zu treffen. Teenager kommandierten die Fahrgäste mit der Autorität eines Feldwebels herum und schrien: «Kaufen Sie Fahrkarten! Kaufen Sie Fahrkarten! Wer hat noch keine? Es ist ein ausländischer Gast im Bus, paßt auf, daß ihr ihn nicht zerquetscht!» Diese Schaffnerinnen, die wachsam an den Türen saßen, bestimmten, ob und wann diese geöffnet wurden, um immer noch mehr Menschen zu erlauben, sich hochzuhieven und ihren Weg ins Innere zu erkämpfen. In der Menge eingepfercht, konnte ich wenig von der Stadt erkennen.
Die Bibliothek war ein imposantes Gebäude, das man durch ein Tor und einen tristen Garten voller herabgefallener Blätter betrat. Marx, Engels, Lenin und Stalin blickten starr aus dunklen Rahmen auf eine lange, leere Eingangshalle hinunter: Porträts von Männern, die entschlossen ihr Ziel verfolgten, Männer, die nicht zögerten, alles niederzumähen, was sich ihnen in den Weg stellte. Ich stieg die breite Treppe zu den oberen Stockwerken hinauf. In einem Raum befand sich der Titelkatalog, in dem eine Handvoll Studenten herumsuchte; in einem weiteren ein Schalter, mit einer Schlange von Entleihern davor, die Bestellzettel ausfüllten. Der dritte war ein Lesesaal mit Zeitungen und Zeitschriften, alle offensichtlich veraltet. Ich überflog einige der fünfzehnhundert Titel: Stomatologie, Magazin für Onkologie, Zeitschrift für Otorhinolarynologie, Mikrocomputeranwendungen, Geophysikalische Studien und eine der wenigen populärwissenschaftlichen Publikationen: Speisepilze. Es gab nichts Schöngeistiges. Kunst und Geisteswissenschaften wurden ignoriert, Naturwissenschaften vergöttert.
Im Vorübergehen sah ich einen verschlossenen Raum am ersten Treppenabsatz mit der Aufschrift: «Exspozicio Esperantajo», ein Hinweis darauf, was einige Chinesen immer noch für die Weltsprache der Zukunft hielten, dann betrat ich den letzten Saal, wo ich zum erstenmal Bücher entdeckte. Sie waren nicht auf Regalen offen zur Schau gestellt, sondern lugten verstohlen hinter einem Ausgabeschalter hervor. Ein Buch mußte bestellt werden, alles wurde genau notiert. Wenn man nichts von der Existenz eines Buches wußte, warum sollte man es dann ausleihen wollen?
Der Lesesaal war groß und still, die traubengrünen, gerafften Vorhänge siebten das Licht der hohen Kirchenfenster. Studenten betraten dieses Heiligtum auf Zehenspitzen, hängten ihre Taschen über die Stuhllehnen, setzten sich in ihren wattierten Mänteln an Tische und vertieften sich in ihre Bücher. In dieser geweihten Stätte des Wissens, kühl wie eine Gruft, sprach niemand. Es bemerkte auch niemand die Anwesenheit einer Fremden. Niemand unterbrach seine heilige Kommunion mit dem Text, um müßig umherzuschauen, um zu sehen, wer hereingekommen war, oder um aus dem Fenster zu gucken. So viel Gelehrsamkeit: ein wahrer Seligkeitsrausch. Lernen um des Lernens willen, um der Realität zu entfliehen und der Kälte zu trotzen.
Der nächste Tag war Sonntag, und Xiuying fuhr nach Hause. Die Woche über wohnte sie auf dem Campus, um nicht täglich eine Stunde mit Hin- und Herfahren zu vergeuden.
«Du mußt kommen und meine Familie besuchen», erklärte sie bestimmt. «Meine Mutter wird für dich kochen.»
«Hat sie keine Angst, eine Ausländerin im Haus zu haben?» Während der zehn Jahre der Kulturrevolution war den Chinesen der Umgang mit Fremden untersagt. Selbst jetzt noch waren Einladungen selten.
«Sie wird dich herzlich willkommen heißen. Nur die anderen Leute finden es vielleicht ungewöhnlich.»
Es war mehr damit verbunden als ein Verbot. Ich erinnerte mich, von einer Familie in Hongkong gehört zu haben, die ein englisches Mädchen, die beste Freundin ihrer Tochter, bei sich zu Gast hatte. Unter anderen Umständen, so erzählten sie später, würden sie nie eine Fremde zu sich nach Hause eingeladen haben, schon wegen der unterschiedlichen Sitten, Gebräuche und Ansichten.
«Denk daran, daß du versprochen hast, uns zu besuchen», erinnerte mich Xiuying.
Ihr Haus befand sich in einem alten Stadtviertel und bereitete mit seinem betagten Mauerwerk und den verwitterten, selbstgebrannten Ziegeln einen liebenswürdigen Empfang. Ich stieg eine Treppe hinauf zu einem Hof im ersten Stock, von triefender Wäsche unter Wasser gesetzt. Frauen putzten an einem Wasserhahn Gemüse für die Fünf-Uhr-Mahlzeit. In der Mitte des Hofs ermöglichte ein Lichtschacht den Ausblick auf ähnliche Tätigkeiten eine Etage tiefer.
Xiuying kam mir entgegen, um mich zu begrüßen, und klatschte in die Hände vor Vergnügen.
«Wie mutig, daß du ganz allein hierhergekommen bist», lachte sie und führte mich in die Küche, damit ich ihre Mutter kennenlernte. Ihr Vater arbeitete fünfhundert Kilometer entfernt.
Rußgeschwärzt vom Kochen der drei Familien, die sich die Küche teilten, verloren sich die Wände in höhlenähnlicher Düsternis. Woks und Hackmesser schimmerten in dunstgeschwängertem Licht. Siebe und Körbe webten einen Wandteppich aus Bambus. Ein antiker Tisch stand staubig in der Ecke, mit eingemachtem Gemüse und Kohlesäcken beladen. Reis brodelte in Kochtöpfen, und Frauen in Schürzen strahlten zur Begrüßung.
«Das ist ein furchtbar schmutziger Ort», bemerkte Xiuying. Hätte ich ihr eine blitzblanke, hygienische Musterküche aus einer westlichen Frauenillustrierten gezeigt, sie hätte sie sicher fälschlicherweise für ein chemisches Labor gehalten. Sie zog mich schnell fort, über einen Hof zum Wohnbereich ihrer Eltern, einem der vielen kleinen Zimmer gegenüber. Schäbige Holzmöbel drängten sich auf engstem Raum, ein Schränkchen neben dem Kleiderschrank, ein Tisch, der Speisevorräte barg, in lässiger Unordnung mit Dingen vollgestellt. Hinter einem Vorhang befand sich der Schlafplatz ihrer Eltern, eine fensterlose Zelle, kaum größer als das Bett. Xiuying entschuldigte sich wieder.
«Meine Mutter würde sich gerne mit dir unterhalten. Aber sie kann kein Englisch.» Mit dieser charakteristischen chinesischen Geste wies sie mit dem Kinn auf ihre Mutter. Diese stand lächelnd in der Türöffnung, und mit ihrem kurzen, mit Klammern zurückgehaltenen Haar, den sackförmigen Baumwollhosen, der blauen Schürze und den Ärmelschützern verkörperte sie den Inbegriff chinesischer Mutterschaft: warmherzig, hart arbeitend, ihre anspruchslose Würde ein Ergebnis jahrelanger Disziplin und Selbstbeherrschung. Groß geworden in einer Zeit, in der die Entfaltungsmöglichkeiten der Frauen äußerst beschnitten waren, wirkte sie ruhig und zufrieden und fand Erfüllung in ihrer Familie.
«Sag ihr bitte, daß ich mich auch gerne mit ihr unterhalten hätte.» Was hätte Xiuyings Mutter mir nicht alles über ihre privilegierte Kindheit, ihre Verheiratung als Fünfzehnjährige mit einem wildfremden Mann und die politischen Umschwünge seit der kommunistischen Machtübernahme erzählen können. Sah man sie heute in ihrer bescheidenen Umgebung, konnte man sie sich schwer als Teenager vorstellen, das Haar geölt und mit Nadeln aufgesteckt, das Gesicht weiß gepudert und die Wangen rot geschminkt, in bestickte Seidengewänder gehüllt, wie sie eine Ehe einging, die ihr bestenfalls ein Leben in Unterwürfigkeit bescherte, schlechtestensfalls einen Alptraum aus Oberflächlichkeit und Langeweile, Glücksspiel und Klatsch, Mah-Jong und Opium und die Beaufsichtigung der Dienerschaft, wo sie ihren Mann mit Huren und Konkubinen teilen mußte (die westliche Praxis, erst die alte Frau loszuwerden und dann eine neue zu nehmen, betrachtete man als unpraktisch), eine Sklavin im Dienst an Ehemann und Schwiegermutter, Geschlechtskrankheiten und Sex ausgeliefert (gegen den alle «tugendhaften» Ehefrauen einen Widerwillen empfanden) und den nervtötenden Nettigkeiten der sozialen Etikette. Während Männer yang waren und als positiv, leidenschaftlich, lebendig und aktiv galten, waren Frauen yin: dunkel, weich, feucht, kalt, ruhend, negativ und tödlich. Unwissenheit war eine weibliche Tugend.
Xiuyings Großmutter hatte in dem Haus, in dem ihre Nachkommen heute zwei kleine Zimmer bewohnten, tatsächlich wie eine Gefangene gelebt. Wenn sich männliche Besucher ankündigten, mußte sie sich zurückziehen, und während ihre Töchter normale oder «große Füße» hatten, waren ihre noch gebunden worden.
Jetzt war es an mir, schockiert zu sein. Ich hatte bisher noch keine gebundenen Füße gesehen, da der Süden ein relativ fortschrittlicher Teil Chinas war.
«Hast du ihre Füße jemals unverbunden gesehen?»
«Ja», antwortete Xiuying traurig, «es war schrecklich. Ihre Zehen waren ganz verkrüppelt.» Zur Veranschaulichung verschränkte sie die Finger, krümmte sie, bis sie knirschten, und preßte sie gegen die Handfläche. «Von den jahrelangen Bandagen sah die Haut ganz weiß und ungesund aus.»
«Wie empfand das deine Großmutter?»
«Als sie fünf Jahre alt war und ihre Mutter und Großmutter damit anfingen, ihr die Füße zu verbinden, schrie sie ununterbrochen. Aber sie zwangen sie. Ihr taten die Füße jahrelang weh, aber als ich sie kennenlernte, hatte sie sich damit abgefunden. Man sagt, man hätte es getan, weil Männer kleine Füße attraktiv fanden und um die Frauen daran zu hindern, das Haus zu verlassen.»
In den fünfunddreißig Jahren nach 1949 hatte sich das Leben der chinesischen Frauen radikaler gewandelt als in den vorangegangenen fünfundzwanzig Jahrhunderten. Ihre Emanzipation, wie unzureichend auch immer, stellte möglicherweise die größte Errungenschaft der Kommunisten dar. Das Ehegesetz von 1950 gab Frauen das Recht zu heiraten, wen sie wollten, und – theoretisch – auch das Recht, sich scheiden zu lassen. In den nächsten Jahren wurden die Verlobung von Kindern, Mädchenhandel, Kindestötung, Prostitution, Polygamie und Konkubinat verboten, alles ehemals gängige Praktiken und seit langem von westlichen Missionaren verurteilt. Frauen erhielten Anspruch auf sechsundfünfzigtägigen Mutterschaftsurlaub, auf kostenlose Krippen und Kindergärten und das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 1953 wurde ein Netz von Frauenverbänden aufgebaut, um dem Widerstand gegen diese radikalen Neuerungen durch gemeinsame Umerziehung von Frauen und Männern zu begegnen. Die Frauenverbände betonten die Gleichheit der Frau, ermutigten Männer, im Haushalt mitzuhelfen, und Frauen, ihre Rechte wahrzunehmen. Später konzentrierten sie sich auf Geburtenkontrolle und Haushaltshygiene, bevor sie dann 1978 aufgelöst wurden.





























