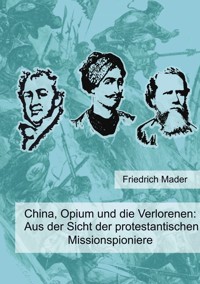
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Anfänge der protestantischen Mission in China fielen in die Blütezeit des indobritischen Opiumhandels und hatten vor dem Hintergrund der Abschottung Chinas nach außen einerseits und den Folgen des Opiumkonsums vieler Chinesen zwangsläufig zahllose Berührungspunkte. War es nicht offenkund, dass Gott sich des britischen Weltreiches bediente zur Verwirklichung seiner geistlichen Pläne? Nutzte nicht der Allmächtige England als Türöffner nach China für den Einzug seines Evangeliums? Wer aber ist der Mensch, dass er sich den Ratschlüssen Gottes widersetze? War nicht die Förderung des Fortkommens des British Empire geradezu Forderung? Und schließlich, wenn es dem liebenden Schöpfer, der alles zum Guten wenden kann, nicht missfiel, zu diesem Zweck selbst den Opiumhandel, in den England durch die East India Company verwickelt war, zuzulassen, konnten dann nicht auch die von ihm bestellten Diener getroßt sein, dass die freizügige Wahl ihrer Mittel ebensolche Sanktifikation durch Gott erfahren würde? Für die meisten von ihnen konnte daran mit Nunacen und unterschiedlicher Gewichtung kein Zweifel bestehen. Die Spannweite der Darstellung deckt grob ein Jahrhundert ab, ist aber in den vorgenommenen Betrachtungen im Wesentlichen auf die drei prominenten Missionarspersönlichkeiten Robert Morrison, Karl Gützlaff unf Hudson Taylor begrenzt, deren außerordentlichen Eigenschaften es aber als passendes Pendent zu der Ereignisfülle in ihrem Wirkraum an nichts mangelte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1. Einleitung
a) Was geschehen war...
b) 350 Millionen Seelen
2. Robert Morrison
3. Karl Gützlaff
4. Hudson Taylor
5. Morrison und die EIC
6. Gützlaff und die EIC
7. Der Erste Opiumkrieg und seine Folgen
8. Gützlaff im Ersten Opiumkrieg
9. Die
Chinese Union
10. Der Zweite Opiumkrieg
11. Yang-chow
12. Widerstand formiert sich
13.
China’s Millions
14. Kampagne, nicht Primärziel
15. Das Chefoo-Abkommen
16. Jenseits missionarischer Kreise
17.
General Conference of the Protestant Missionaries of China
18. Siebente Hauptversammlung der Evangelischen Allianz
19. Londoner Missionskonferenz
20.
Royal Commission on Opium
21. Das Ende des indo-chinesischen Opiumhandels
22. Fazit
Anhang 1 Beginn der Protestantischen Mission
Anhang 2 Împerialismus und Kolonialismus
Anhang 3 Der Begriff „Zivilisation“
Anhang 4 Die römisch-katholische Mission in China
Anhang 5 Der theologisch-theoretische „Unterbau“
Anhang 6 Die
East India Company
Anhang 7 Vom Opiumhandel und amerikanischen Missionaren
Anhang 8 Abbildung 1
Anhang 9 Abbildung 2
Anhang 10 Abbildung 3
Anhang 11 Abbildung 4
Literatur
Vorwort
Ziel des vorliegenden Textes ist es, den Spannungsbogen seit dem Beginn der protestantischen Mission in China bis zum Ende des indobritischen Opiumhandels und deren Zusammenhänge sowie wechselseitige Abhängigkeiten nachzeichnen.
Allerdings soll es nicht bei einem historischen Abriss der protestantischen Chinamission im Kontext der imperialistischen Bestrebungen des britischen Emperiums bleiben. Den missionarischen Pionieren jener Zeit ist häufig vorgehalten worden, sie hätten unter dem Vorzeichen einer vermeintlich überlegenen Zivilisation, der sie angehörten, das Christentum als ihr höchstes Exportgut in alle Welt verschifft. Dabei hätten sie sich bedenkenlos ihren Regierungen angebiedert, die als Kolonialisten und Ausbeuter fremde Länder und Völker unterjochten. Vor allem am Beispiel Chinas, das von westlichen Nationen, allen voran England, mit Opium überflutet wurde und Widerstand mit Kanonenbooten begenete, sei dies augenfällig. Dort hätten die Missionare sich zum Mittäter gemacht. Wenngleich die Missionare vieles mit ihren Landsleuten und anderen Westlern gemein hatten, neben Kultur und Religion nicht zuletzt auch idiologische Überzeugungen, und sich gegenseitig Hilfestellung leisteten, unterschieden sie sich doch in einem wesentlich voneinander. Für die einen war es der Zweck, für die Missionare das Mittel: Während alle anderen in China waren, weil sie sich davon einen Vorteil versprachen oder es sie aus politischem Anlass dorthin verschlagen hatte, kamen die Missionare aus nur einem Grund, nämlich zur Verkündigung des Evangeliums, das sie als den einzigen Weg für alle Menschen heraus aus der ewigen Verdammnis am Ende des irdischen Lebens ansahen. Das war ihre Gewissheit, dafür traten sie ein, dafür arbeiteten sie ohne Unterlass, dafür beschritten sie neue Wege, dafür setzten sie ihr Leben ein, dafür nutzten sie alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, die nicht konträr zu ihrem Glauben standen – vor dem Hintergrund ihrer Zeit.
Wer die jeweiligen Umstände, eine Konstante die die in Rede stehende Zeit bedingte und die teilweise bis in die Gegenwart hineinreichen, mit einbezieht in die Betrachtung, wird zu einer anderen Bewertung der Ereignisse und des Vorgehen der protestantischen Missionare gelangen ohne dabei auszublenden, dass es schon damals kritische Stimmen gab. Der „Zeitgeist“, das heißt die vorherrschenden religiösen, gesellschaftsethischen und politischen Überzeugungen und Empfindungen mit all ihren Überschneidungen, dieser Geist, dem damals wie allezeit sich zu entziehen so schwierig ist, bildet gewissermaßen den Rahmen in dem sich das Original des Bildes in jener Zeit präsentierte – eine Neurahmung nach anderen Standards ist nicht mehr das Original. Zu diesen erwähnten Umständen oder dem Hintergrund, vor dem die Geschehnisse beurteilt werden müssen, gehörte das nahzu allgegenwärtige britische Imperium, dessen Einfluss als größte Kolonialmacht sich nicht nur auf das Selbstverständnis seiner Staatssubjekte auswirkte oder gar übertrug, sondern auch die gegenseitige Wahrnehmung der christlichen und nichtchristlichen Umwelt (mit-)prägte und Wirkung bis hinein in das nach außen hermetisch abgeriegelte chinesische „Reich der Mitte“, uralte Hochkultur und selbst (noch) Kolonialmacht, zeitigte. War nicht offenkund, dass Gott sich dieses Weltreiches bediente zur Verwirklichung seiner geistlichen Pläne? Nutzte nicht der Allmächtige England als Türöffner nach China für den Einzug seines Evangeliums? Wer aber ist der Mensch, dass er sich den Ratschlüssen Gottes widersetze? War nicht die Förderung des Fortkommens des British Empire geradezu Forderung? Und schließlich, wenn es dem liebenden Schöpfer, der alles zum Guten wenden kann, nicht missfiel, zu diesem Zweck selbst den Opiumhandel, in den England durch die East India Company verwickelt war, zuzulassen, konnten dann nicht auch die von ihm bestellten Diener getroßt sein, dass die freizügige Wahl ihrer Mittel ebensolche Sanktifikation durch Gott erfahren würde? Für die meisten von ihnen konnte daran mit Nunacen und unterschiedlicher Gewichtung kein Zweifel bestehen.
Die Spannweite der Darstellung deckt grob ein Jahrhundert ab, ist aber in den vorgenommenen Betrachtungen im Wesentlichen auf die drei prominenten Missionarspersönlichkeiten Robert Morrison, Karl Gützlaff unf Hudson Taylor begrenzt, deren außerordentlichen Eigenschaften es aber als passendes Pendent zu der Ereignisfülle in ihrem Wirkraum an nichts mangelt.
Neben dem beschriebenen Ziel, einen relativistischen Zugang in die Welt der Pioniere der protestantischen Chinamission zu eröffnen, ist es außerdem die Hoffnung des Autors, dass trotz aller gehegter Kritik am partiellen Opportunismus, dem teils überschießenden Enthusiasmus für die christliche Sache oder der Einsatz dieser kühnen Verkündiger beim Leser dieser Arbeit wahrhaft inspirierend wirken möge.
Aufbau der Arbeit
Je nach Phase der protestantischen Mission in China und parallel zu den Entwicklungen des Opiumhandels sind es drei Namen, die herausstechen und deren Einsatz den anvisierten Zeitraum abdeckt:
Robert Morrison erreichte 1807 als erster protestantischer Missionar das chinesische Festland. Sein Aufenthalt in China war eng verbunden mit der East India Company, die den britischen Opiumanbau in Britisch-Indien als Monopol für den Handel mit China betrieb. Sein Leben und Wirken stehen deshalb am Anfang der Arbeit.
Der preußische Missionar Karl Gützlaff trat seinen Missionseinsatz nicht für eine britische, sondern niederländische Missionsgesellschaf an. Da er sich jedoch recht bald von seiner Entsendegesellschaft löste und fortan selbständig agierte, aber in enger Bindung an die britischen Aktivitäten in China tätig war, nachdem er mit einiger Begeisterung für die Arbeit Morrisons seine Vorliebe für China entdeckt hatte, wird anhand seiner Person den Entwicklungen in der protestantischen Chinamission und den Zusammenhängen zum Opiumhandel weiter nachgegangen.
Auch Hudson Taylor hatte sich mit der Arbeit Gützlaff, vor allem dessen Missionsansatz, vertraut gemacht und wollte diesen für sich fruchtbar machen. Taylors Einsatz in China fiel in die zweite Hälfte des 19. sowie den Anfang des 20. Jahrhunderts und reichte damit an das Ende des Opiumhandels. Mit seiner starken Persönlichkeit baute er nicht nur die China Inland Mission auf und mit ihr die bis heute erfolgreichste protestantische Missionsgesellschaft in China, sondern er war auch ein ausgesprochener Gegner des Opiums. Aus diesem Grund wurde Taylor mit seiner Lebensgeschichte als dritte Persönlichkeit in dieser Arbeit herangezogen.
Die thematischen Nebenaspekte sind zahlreich und vieles könnte ohne eine erklärende Kurzdarstellung der Umstände unklar oder missverständlich sein. Deshalb ist zunächst in der Einleitung der Versuch unternommen worden, einen „Panoramablick“ auf die wesentlichen Sachzusammenhänge und die den Verlauf der Entwicklungen des 19. Jahrhunderts in Großbritannien bedingenden Faktoren zu geben. Außerdem sind im Anhang der Arbeit einige weitere Punkte, die in Verbindung mit dem British Empire und der protestantischen Mission in China wichtig erschienen, eigenständig erörtert worden.
Vor allem die protestantischen Missionare beschäftigten sich ausgiebig mit der chinesischen Sprache, Gesellschaft und Topografie. Dabei wurden auch chinesische Ortsnamen so transkribiert, wie es dem Original nach dem Empfinden des Verfassers am nächsten kam, woraus es in der Folge häufig eine verschiedene Schreibung desselben geographischen Ortes ergab. Aus diesem Grund sei auf die Umwandlungstabelle chinesischer Ortsnamen mit alter und moderner Transkription bei ARCHIE, Christianity, S. XLIIIff., verwiesen.
Das gesichtete Material besteht aus Primär- und Sekundärliteratur. Dabei sind einerseits ein Großteil von Morrisons, Gützlaffs und Taylors Schriften herangezogen worden, andererseits wurde der Absicht gefolgt, mit einem möglichst breiten Spektrum verschiedener Gattungen aus der Georgianischen (etwa ab 1720) und Viktorianischen Epoche (etwa ab 1840) einen möglichst realistischen Gesamteindruck aus der Anfangszeit der protestantischen Mission in China zu geben. So sind neben Periodika vor allem aus dem Kreis der Chinamission auch Dokumente der parlamentarischen Debatten des britischen Unter- und Oberhauses sowie Reporte in parlamentarischem Auftrag über den Opiumhandel und die indische Kronkolonie einbezogen worden, wo diese Aussagen im Zusammenhang von Chinamission und Opium machten. Schließlich wurde eine Fülle neuzeitlicher Fachliteratur zu diesem Thema für die Analyse und Einschätzung der Ereignisse aus der Vergangenheit in der Gegenwart herangezogen.
Wo Debatten des britischen Parlaments angeführt werden, erfolgen Angaben durch Verweis auf die Sammlung von Hansar, dem der Hinweis auf das House of Commons (HC) beziehungsweise das House of Lords (HL) folgt.
Bei allen mehrbändigen Werken wird der Band, auf den Bezug genommen wird, nach dem Titel mit römischer Ziffer oder dem Jahrgang angegeben.
Hervorhebungen des Verfassers werden mit den Initialen „FM“ abgekürzt.
1. Einleitung
a) Was geschehen war...
Am 1. Januar 1949 verließ der letzte Generalinspekteur des amerikanischen Seezollamtes in China das Land auf einem Dampfer der britischen Handelsgesellschaft Jardine Matheson & Co. – damit endeten fast zwei Jahrhunderte direkter westlich-imperialistischer Einflussnahme auf das „Reich der Mitte“.1 Und mit dem Auszug des Westens hielt die Selbständigkeit der jungen Volksrepublik China Einzug. Der ehemals größte Opiumhändler jener Zeit, Jardine Matheson & Co., würde wiederkommen, jedoch ohne Opium; China aber würde sich fortan als gleichberechtigte Nation seine Handelspartner selbstbestimmt wählen und seine Stellung in den internationalen Machtstrukturen zu einer führenden im Zeitalter der Postmoderne vorantreiben.
Davor war China im Fokus westlicher Machtansprüche gewesen. Vor allem das britische Imperium hatte diese in einem gewissen Umfang auch verwirklichen können. Es war im Zuge dieses Expansionsstrebens Großbritanniens im asiatischen Raum, in dessen Machtzentrum sich seit langem das chinesische Kaiserhaus befand, dass die ersten protestantischen Missionare chinesischen Boden betraten.
England selbst erlebte damals Veränderungen und war mittendrin, diese bis zum Extrem fortzuführen. Wollte man die gesellschaftlichen Umwälzungen im England des 19. Jahrhunderts im Telegrammstil abhandeln, klänge dies in etwa so:
Lebenserwartung stieg – allerdings höchst ungleich […]. In ländlichen Gebieten […] Bauern und Händler 45 und Landarbeiter 36 Jahre. In den Industriestädten dagegen […] die Mittelschicht lediglich etwa 23 und die Arbeiterbevölkerung nur 17 Jahre. […] Die technischen Erfindungen, die jetzt gemacht oder ökonomisch fruchtbar werden, sind vor allem die der Schwerindustrie […]. In der zweiten Jahrhunderthälfte werden die Entfernungen der Erdteile voneinander verringert […]. Als 1851 durch Königin Victoria die Weltausstellung im neuerbauten Kristallpalast zu London eröffnet wurde, hat das Selbstbewusstsein und die Machtstellung Englands einen Höhepunkt erreicht […]. Auf England entfiel ungefähr 50% des gesamten Welthandels, die britische Flotte war mit Abstand die größte der Erde.2
Am anderen Ende der Handelskette stand das chinesische Volk, dessen für damalige Verhätnisse enorme Populationsgröße als „demographisches Mysterium“3 bezeichnet worden ist.
MERKER empfindet dies weniger als mysteriös, sondern sieht darin eine Verbindung zwischen der Ausbeutung der Neuen Welt und dem davon profitierenden Handel des Westens mit China:
Das lateinamerikanische Silber, das über die westlichen Händler nach China strömte, kurbelte die chinesische Wirtschaft im 18. Jahrhundert nachhaltig an, in der Folge verbesserten sich die Lebensbedingungen, kam es zur Bevölkerungsexplosion. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts mehrten sich jedoch bedenkliche Zeichen, und zu Beginn des 19. Jahrhundert befand sich China dann in einer tiefen ökonomischen, ökologischen und sozialen Krise. Dieses Desaster wurde durch den heraufziehenden Konflikt mit dem Westen dramatisch verschärft.4
Wie zuerst in England und dann in ganz Europa und bis nach Nordamerika die Industrielle Revolution ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den unteren sozialen Schichten durch die Veränderungen des Arbeitsmarktes ein sicheres Auskommen erschwerte, litt auch China zur Zeit der beginnenden protestantischen Mission aufgrund seines rasanten Bevölkerungswachstums an einem Überangebot vor allem gering und unqualifizierter Arbeitskräfte. Neben einer annähernden Verdoppelung des Dschunken-Handels mit dem Ausland war das Aufkommen chinesischer Tagelöhner in Südostasien, sogenannter Kulis, die für China marktfähige Produkte herstellen, das zweite Resultat der Schwemme Ungelernter gewesen.5 Nach ihrem Arbeitseinsatz bis nach Niederländisch-Indien, dem heutigen Indonesien, kehrten die Kulis wieder nach China zurück und machten dort als Konsumenten einen bedeutenden Faktor für den Opiumabsatz aus.6 Der Opiumkonsum der chinesischen Tagelöhnern habe jedoch, so TROCKI, deren Arbeitswillen nicht geschmälert, sondern die inhumanen Arbeitsbedingungen des aufkommenden Kapitalismus in Asien erträglicher gemacht, indem die Wirkung der Droge die physische Belastung durch die langen Arbeitstage, den quälenden Hunger und das mentale sowie seelische Leid gemildert habe.7
Die britische East India Company (EIC) förderte diese Entwicklungen des chinesischen Opiumabsatzmarktes, indem sie den Anbau in Indien und Vertrieb nach China systematisierte.8 Ostindien-Gesellschaften verschiedener Nationalität hatten bereits ab Ende des Mittelalters in Indien Handelsbeziehungen mit recht bald vor Ort bestehenden Handelsposten aufzubauen begonnen. Notorisch unter diesen wurde die britische, die als Reaktion auf die befürchtete niederländische Handelsübermacht gegründet worden war und deren Gründungsurkunde9 auf Silvester 1600 datiert.10
The first East India Company ships to reach Chinese waters arrived in the south in 1637. They received an unfriendly reception, but forced their way through Chinese blockades. The British persisted and by the end of the seventeenth century, the East India Company had established itself in the China trade. In 1689, following the imperial edict that opened all ports to foreign trade, the Company set up a factory at Guangzhou (Canton). […] Tea, in particular, became a major component of the trade, with exports from Guangzhou more than quadrupling between 1775 and 1785, as the British became a nation of tea drinkers.11
Nachdem sich der britische Teeexport überaus positiv entwickelt hatte, begab sich 1793 eine britische Gesandtschaft unter Leitung Lord Macartneys an den Hof in Peking, „to establish diplomatic relations and to increase the trade“12. Mit diesem Anliegen scheiterte man zwar, Europa jedoch „was flooded with books and pictures about the embassy“13. Im Licht dieser Ereignisse geriet auch China zunehmend ins Blickfeld der protestantischen Mission, die bereits in den kolonialen Gebieten des Empire große Aktivität entfaltet hatte.14 In Anhang 6 werden einige Aspekte der EIC auch in Verbindung zur protestantischen Mission vertieft.
Die protestantische Mission in China war während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stark mit den imperialen Strukturen verwoben und hätte sich anfangs nicht serlbständig entwickeln können. Das lag an den Umständen in Kanton, dem zu jener Zeit im Abendland und Nordamerika gebräuchlichen Exonym für die in einer Bucht des Südchinesischen Meeres gelegenen heutigen Millionenmetropole Guangzhou: Ausländern war der Zugang nach China damals nur zum Zweck des Handels und ausschließlich in Kanton erlaubt.15 Erst nach dem sogenannten Zweiten Opiumkrieg 1860, an dessen Ende einerseits die Legalisierung des Opiumhandels stand, war die protestantische Mission andererseits nicht länger auf Zusammenarbeit und Wohlwollen der westlichen Handelsmannschaft angewiese. Dies ergab sich aus einer Klausel im Friedensvertrag, die nunmehr die christliche Religion in China erlaubte und darüber hinaus eine Schutzgewähr durch die chinesische Regierung vorsah. Diese gewonnene Unabhängigkeit erlaubte es den Missionaren, zunehmend offen gegen die britischen Machenschaften im Zusammenhang mit dem gigantischen Opiumhandel aufzutreten, ohne ihre missionarische Tätigkeit in Gefahr zu bringen. Während die protestantische Missionsanstrengung in China mit Taylors China Inland Mission an der Spitze die medizinische Versorgung opiumabhängiger Chinesen in eigenen Krankenhäusern und Entziehungsanstalten organisierten, wuchs in England gleichzeitig der politische Druck auf die Regierung, hinter dem insbesondere Kirchen und Missionsgesellschaften standen.
b) 350 Millionen Seelen
I wish I could persuade you to accompany me.16
Mit diesen Worten brachte Morrison sein innigstes Verlangen gegenüber einem Freund zum Ausdruck, ihn als Gefährten für sein „Abenteuer“ zu gewinnen, und begründete dies weiter: „Take into account the three hundred and fifty million souls in China who have not the means of knowing Jesus Christ as Saviour.“17 Es war diese unvergleichliche Millionenzahl hoffnungsloser Menschen, die solch starke Anziehung auf die ersten „Generationen“ der protestantischen Mission in China ausübte. Je eine dieser „Generationen“ repräsentieren die Persönlichkeiten, die in dieser Arbeit wegen ihrer außergewühnlichen Stellung in der protestantischen Chinamission näher besprochen werden: Robert Morrison – als dem sanften und gelehrsamen Pionier; Karl Gützlaff – als dem sprachtalentierten und ungestümen „Krieger Christi“; und Hudson Taylor – als dem weitsichtigen Mediziner und Abolitionisten. Sie alle waren voller Glaubens und Drang, die christliche Botschaft zu den Chinesen zu bringen. Alle drei waren auch Kinder ihrer Zeit. Das heißt, sie wurden mit dem im britischen Weltreich zu jener Zeit allgemein vorherrschenden Weltbild konfrontiert und von den Wellen der Veränderungen, die wechselseitig das Empire erzeugten und von ihm erzeugt wurden, bis nach China getragen. Zu diesem Weltbild gehörten auch die theologischen Theorien, die das Zeitgeschehen mit der Providenztheorie zu begründen versuchten beziehungsweise im (entstehenden globalen) Handel das göttliche Vehikel zur Verbreitung des Christentums (Commerce and Christianity-Theorie) ausmachten.
Historisch verortet wird der Ursprung der protestantischen Mission einerseits als eine Folge der Erweckungsbewegung des 18. Jahrhunderts, den so genannten Great Revivals oder Awakenings. Zum anderen entstanden die britischen Missionsgesellschaften vor allem auch aus der Notwendigkeit, die sich aus der Providence-Theorie bzw. der Commerce and Christianity-Theorie ergab – nämlich zu handeln und die Ernte einzubringen (Mt. 9, 35ff.).
Ein kurzer Aufriss dieser Sachzusammenhänge über den Beginn der protestantischen Mission findet sich in Anhang 1 und über die zu jener Zeit die protestantische Mission befördernden theologischen Theorien in Anhang 5.
Bei der Betrachtung der missionarischen Tätigkeit Morrisons, Gützlaffs und Taylors werden gleichzeitig die größeren Zusammenhänge unter anderem mit Gesellschaft und Wirtschaft, nationalen und internationalen Beziehungen und den ideologisch unterlegten Wahrnehmungsmustern aufscheinen. Die damalige Wahrnehmung war jedenfalls auf der politischen und wirtschaftlichen Gestaltungsebene stark von dem bestimmt, was in den begrifflichen Horizont von „Kolonialismus“ und „Imperialismus“ fällt.
Die genannten Termini werden deshalb in Anhang 2 kurz besprochen und in Anhang 3 der Zivilisationsbegriff, den die britische wie auch die chinesische Seite für sich beanspruchte.
Die Geschichte der christlichen Mission in China umfasst einen langen Zeitraum. Sie reicht bis weit vor die ersten Ansätze der katholischen Mission bis zum Nestorianismus im siebten Jahrhundert zurück und hatte erste mögliche Verbindungspunkte mit dem, allerdings erst ab dem 19. Jahrhundert ausufernden Opiumhandel in ihrer Anfangszeit.
Weil das Christentum in China vor dem Auftreten der ersten protestantischen Missionare nicht unbekannt war, sondern ganz im Gegenteil eine bewegte Vorgeschichte hatte, zu der auch das Verbot per Staatsdekret gehörte, von dem auch die protestantischen Missionsanstrengungen noch berührt wurden, wird nach einigen allgemeinen Aussagen über die Geschichte des Opiumhandels in Anhang 4 ein kurzer Überblick über die katholische Mission gegeben.
Der anvisierte Kreis der Darstellung ist dementsprechend weit; aus diesem Grund wird die eingenommene Perspektive bewusst auf die Historie der Anfänge der protestantischen Mission in China gelegt, während theologische und missiologische Aspekte nur an den gegebenen Stellen durchscheinen, wo diese Verbindungslinien nachzeichnen oder der Vollständigkeit halber in der Darstellung unerlässlich erscheinen.
1 Vgl. BICKERS, Scramble, S. 1.
2 FETSCHER, Politikwissenschaft, S. 72f.
3 OPITZ, Taiping, 25.
4 MERKER, Rolle, S. 43.
5 Vgl. TROCKI, Opium, S. 44.
6 Vgl. TROCKI, Opium, S. 52ff. Taylor bestätigt für das Ende des 19. Jahrhunderts, dass in den Städten „chair bearers and coolies are nearly all opium smokers“ (Royal Commission on Opium, I, S. 31) sind; bemerkenswert ist sein „misfortune“ u. „terrible trouble“, den er mit Sänftenträgern auf langen Reisen gehabt habe, unter denen sich auch Opiumkonsumenten befunden hätten, deretwegen es zu Unterbrechungen „from one to two hours however inconvenient it may be“ (ebd.) gekommen sei, weil diese ihre Opiumsucht hätten befriedigen müssen; s. auch TAYLOR, Retrospect, S. 72, für eine weitere solche Situation.
7 Vgl. TROCKI, Opium, S. 170. Taylor bestätigt, dass ein Kuli „under the influence of the stimulant […] can do pretty hard work for that time“ (Royal Commission on Opium, I, S. 31). Vgl. ferner AUSTIN, China’s Millions, S. 199.
8 Der britische Politiker, Orientalist und Missionswissenschaftler William Muir (1819-1905) wird in einer parlamentarischen Resolutionsdebatte (Hansard, HC, CCI, 493) mit den Worten zitiert, England habe durch „over-stimulating production, over-stocking the market, and flooding China with the drug“ dem Laster Chinas zugearbeitet; Muir wird mit dieser Ansicht auch in China’s Millions, 1879, S. 75, angeführt.
9 GRÜNDER, Welteroberung, S. 315, stellt klar, dass damals weder das bei der Gründung einer privaten Handelsunternehmung beschlossene Organisationsstatut noch deren Satzung als Rechtsnorm einer modernen öffentlich-rechtlichen Körperschaften entsprachen, sondern einer „Erlaubnis“ durch die britische Krone, die mithin von Anfang an über deren Handelspraxis genaue Kenntnis besessen besaß.
10 S. PRAKASH, East India Company, S. 2, u. NAGEL, Abenteuer, S. 71ff.
11 HOARE, Embassies, S. 2.
12 HOARE, Embassies, S. 4.
13 Ebd.
14 Vgl. z. B. PORTER, Overview, S. 40ff.; das „pattern of Church-State relations, framed for British North America between 1784 and 1793, was adapted through the colonial Empire up to the 1830s” (S. 144).
15 Außerdem war er es nur männlichen Kaufleuten gestattet, mit einer kleinen Gruppe Einheimischer Handel zu treiben; nach der Handelssaison hatten sie China wieder zu verlassen; ausländische Frauen waren damals zu keinem Zeitpunkt auf chinesischem Boden zugelassen; gegen das Aufenthaltsverbot von Frauen hatte Morrison 1830 im Namen der Kaufmannschaft remonstriert (s. Appendix to the Report on the Affairs of the East India Company, II (1831), S. 152). Zu der örtlichen Beschränkung kam erschwerend das Verbot hinzu, dass Chinesen, die Ausländer die chinesische Sprache lehrten, die Todesstrafe drohte (s. zu Morrison in diesem Zusammenhang unten Fn. 204). Auch das Betragen der chinesischen Handelspartner ließ zu wünschen übrig, wie sich aus den regelmäßigen Beschwerden in den Büchern der EIC entnehmen lässt, vgl. WOOD, Britain, S. 59f; vgl. ferner MCALEAVY, History, S. 41f. Als Grund für diese massiven Handelsbeschränkungen werden die Erfahrungen angeführt, die die Qing- oder Mandschu-Dynastie (1616-1911) bis ins 17. Jahrhundert besonders mit Spaniern und Portugiesen gemacht hatte. So sollen zum Beispiel Spanier 20000 auf den Philippinen lebende und Handel treibende Chinesen aus Konkurrenzgründen massakriert, und „[b]oth the Spaniards and the Portuguese showed a ruthless combination of religious zealotry and lust for money, and when their ships put into Chinese ports they came armed to the teeth and carrying priests fired with the conviction that the Cross must be made to triumph. […] Thus to the Chinese they appeared as nothing but marauding pirates” (HUGHES, Invasion, S. 9). Eine Ausnahme vom Verbot in China Proper lebender Ausländer war „the Russian establishment at Peking, consisting of only ten persons, and a very narrow place at Canton and Macao” (Chinese Repository, I, S. 2); s. zur russischen Exklave auch Fn. 728.
16 MORRISON, Memoirs, I, S. 69.
17 Ebd.
2. Robert Morrison
Quelle: MORRISON, Memoirs, I, Frontispiz.
Robert Morrison kam als erster protestantischer Missionar nach China und war während der gesamten Zeit seines Einsatzes, der bis zu seinem Lebensende währte, bei der EIC, dem Opiumproduzenten in Britisch-Indien, beschäftigt.18 1782 in Morpeth (Northumberland) geboren und etwa 1797 der Schottischen Presbyterianischen Kirche beigetreten, bot Morrison 1804 der London Missionary Society (LMS) seinen missionarischen Dienst an. Schon im darauffolgenden Jahr fiel die Entscheidung der LMS, die Missionierung Chinas in Angriff zu nehmen. Walter Henry Medhurst (1796-1857), Morrisons späterer Mitarbeiter, beschreibt 1838 diesen Entschluss in seinem voluminösen Werk „China: Its State and Present Prospects” mit diesen Worten:
The immense population of China, and the deplorable darkness in which they were involved, let the fathers of the [London Missionary] society to arrange the plan, for bringing the light of divine truth to shine upon them moral gloom.19
Wegen des verwehrten Zugangs für Ausländer und des Verbots der christlichen Religion,20 sollte ein erster Ansatz allerdings zunächst unter den Chinesen auf der heute zu Malaysia gehörenden Insel Penang gemacht werden.21 Um diese Herausforderung bewältigen zu können, war eine Mindestbesetzung von drei bis vier fähigen Missionaren vorgesehen.22 So kam es, dass „[i]n the year 1806, two missionaries, Messrs. Morrison and Brown were appointed; and directed to turn their attention to the study of the language, assisted by […] a native of China, then in England.”23 Und außerdem, „as age is venerable in China, it was judged advisable to request Dr. Vanderkamp“24. Johannes Theodorus van der Kemp (auch Vanderkemp; 1747-1811), Hauptinitiator der 1797 in Rotterdam gegründeten Nederlandse Zendelings-Genootschap (NZG),25 der späteren Entsendegesellschaft Gützlaffs, war zu jener Zeit im Süden Afrikas für die LMS als Missionar tätig. Dieser empfand sich jedoch von Gott nur nach Afrika, aber nicht wieder dort herausgerufen, und lehnte deshalb ab. Auch Brown sah sich noch während der Vorbereitungen in London der anstehenden Aufgabe nicht gewachsen und quittierte den Dienst.26 Morrison hingegen, der umgehend mit dem Studium der chinesischen Sprache begonnen hatte, versuchte beflissentlich, die kurze verbleibende Zeit bestmöglich zu nutzen. Wie wichtig für Morrison das Erlernen der Sprache des Einsatzlandes im Allgemein und in seinem Fall des Chinesischen war, geht aus einem späteren Kommentar von ihm dazu hervor:
The fact is, that there are pious and worthy men, who go abroad as Missionaries, but who cannot bring themselves to undergo the drudgery of learning a foreign language, so dissimilar to all European languages as the Chinese is; which, by the way, however, is a great shame to them. Language is essential to the propagation of Christian sentiments.27
Neben der Sprache eignete er sich auch einige spezialwissenschaftliche Kenntnisse an, welche vom Direktorium der LMS als nützlich erachtet worden waren:
Mathematik28 und Medizin29.
Zum Erlernen der Zielsprache verwendete Morrison ein chinesisches Neues Testament aus dem Fundus des Britischen Museums, nach seinem Verfasser, dem katholischen Missionar Jean Basset (ca. 1662-1707), auch Basset-Manuskript genannt.30 Dieses Manuskript zu vervielfältigen und als ersten missionarischen Ansatz in China unter die Menschen zu bringen, war bereits 1805 von der British and Foreign Bible Society in Erwägung gezogen, aber aus Kostengründen nicht durchgeführt worden.31 Mit Hilfe seines chinesischen Lehrers kopierte Morrison dieses Manuskript wie auch ein lateinischchinesisches Wörterbuch „[b]y extraordinary application […] in the few months of his residence in London, besides pursuing with ardour the other studies“32.
Eine Fahrt von England direkt nach China wäre damals nur auf einem Schiff der EIC möglich gewesen. Da diese es jedoch im Allgemeinen ablehnte, Missionare auf ihren Handelsschiffen zu befördern,33 führte Morrisons Weg zunächst in die Vereinigten Staaten von Amerika. Von dort nahm er in New York ein Schiff mit Kurs auf Kanton. Dieser Umweg machte die ursprünglich geplante Zwischenstation in Penang unmöglich. Allerdings erhielt er so Unterstützung durch ein Empfehlungsschreiben des damaligen Außenministers und späteren vierten Präsidenten der USA, James Madison (1751-1836), an den amerikanischen Konsul in Kanton.34
In Kanton verbrachte Morrison den Rest seines Lebens. Nur gelegentlichen reiste er in die Nachbarregionen und 1824 noch einmal in die englische Heimat.35 Nur ein einziges Mal erhielt er Zugang nach China Proper, das heißt „that portion of the east of the Asiatic continent which has been possessed and permanently occupied by the Chinese people“36; das war der Fall als ihn seine umfassende Kenntnis der chinesischen Sprache37 1816 in die Dienste Lord Amhersts treten ließ, der eine britische Handelsabordnung nach Peking leitete.38
Neben seiner bezahlten Übersetzertätigkeit bestand seine Hauptbeschäftigung in der Übertragung christlicher Texte ins Chinesische.39 Zusammen mit seinem Mitarbeiter William Milne (1785-1822), den die LMS 1813 auf Morrisons dringende Bitte nach Verstärkung schickte,40 übersetzte er unter anderem die gesamte Bibel,41 den Kleinen Katechismus der Schottischen Kirche, sowie eine Vielzahl christlicher Abhandlungen.42 Mit der Übersetzung der Bibel hatte er seine zuvörderst gestellte Aufgabe erfüllt. In der chinesischen Bibelübersetzung gründete sich auch einiger Stolz seiner Entsendegesellschaft, der später in den 1830ern bei deren schon von Morrison selbst gesehenen Notwendigkeit einer Überarbeitung im Wege zu stehen drohte.43 Während Morrison bei der Veröffentlichung der chinesischen Bibelübersetzung noch finanzielle Hilfe von der British and Foreign Bible Sciety und LMS erhielt, kam er für die Kosten späterer Werke selbst auf.44
Mit seinem frühzeitigen Tod 1834 ging auch der britischchinesischen Diplomatie eine Stimme verloren, die sich nicht nur in der chinesischen Sprache ausdrücken konnte, sondern seine Kenntnis von der chinesischen Kultur und seine Erfahrungen als Vermittler zwischen den Akteuren hätten vielleicht einen indirekten Beitrag zu einem anderen Verlauf der Geschichte geben können als den der Aggression, von der sie schließlich geprägt worden ist. Dies beschreibt seine Witwe Eliza in seinen Memoiren:
Mr. Morrison was not only the medium of communication between the parties; but it appears, not unfrequently, that by his prudence and uncompromising firmness a right understanding was established; while, at the same time that he maintained the dignity of the English character, he conciliated all classes of the Chinese by his extensive knowledge of their language and manners, but especially his moderation, and well-known benevolence of disposition. 45
18 S. HUGHES, Invasion, S. 60.
19 MEDHURST, China, S. 251f.
20 KLEIN, Contact Zone, nennt 1724 als Jahr, in dem die christliche Religion in China verboten wurde. S. 226, GÜTZLAFF, Journal of Three Voyages, S. 18, z. B. erwähnt eine 1815 kaiserlich initiierte Christenverfolgung.
21 Vgl. MACGILLIVRAY, Century, S. 1f.
22 David Bogue (s. zu seiner Person auch S. 101), Gründer und Leiter des Hoxton College sowie Leiter der Gosport Academy, die beide in demselben Haus untergebracht waren, hielt mindestens zwei gemeinsam entsandte Missionare für erforderlich (und mehr als fünf für kontraproduktiv); die Gosport Academy war die Anstalt der LMS zur Vorbereitung auf den Missionsdienst, die auch Morrison und Milne, Morrisons erster Mitarbeiter, besuchten, vgl. DAILY, Morrison, S. 84f.
23 MEDHURST, China, S. 253.
24 Ebd. Vgl. ferner zur Ehrfurcht der chinesischen Gesellschaft vor hohem Alter SUN, Chinabild, S. 184.
25 Vgl. KRUIJF, Geschiedenis, S. 4f.; „[z]oo werd in Nederland op dien 19den Dec. 1797 het eerste zendelinggenootschap op het vasteland van Europa gesticht en traden wij als de tweede natie op, welke deel zou nemen aan hetgeen men gewoon is de „Nieuwere Zending“ te noemen“ (S. 5); als Vorbild für die NZG diente die LMS: „Om ook anderen daaruit te helpen had hij zich als zendeling bij een in Sept. 1795 gesticht engelsch zendingsgenootschap, later het Londensche genaamd, aangesloten, en waar van deze […] 1797 een Adres aan de godsdienstige ingezetenen der Vereenigde Nederlande was uitgegaan, had V. D. KEMP dit stuk vertaald en hier te lande verspreid“ (S. 4).
26 Vgl. MEDHURST, China, S. 253.
27 MORRISON, Miscellany, S. 51f.
28 ALCOTT, Life, S. 43f. Tatsächlich gehörten wohl Medizin, Astrologie und Mathematik zur der Standardausbildung an der Gosport Academy, während in Morrisons Fall besonders Mathematik als nutzenbringend für die Arbeit mit Chinesen angesehen wurde und entsprechenden Raum in der Vorbereitung auf den Einsatz erhielt, da bekanntermaßen schon die jesuitischen Missionare der vorangegangenen beiden Jahrhunderte damit positiven Eindruck zu erzeugen wussten (vgl. dazu auch WALLS, Mission, S. 58); aus diesem Grund erwarb Morrison auch einige technische Apparaturen, u. a. ein Teleskop und einen Sextanten, vgl. DAILY, Morrison, S. 91, 94, 97 u. 101. Auch die Berliner Missionsschule Jänickes, an der Gützlaff ausgebildet wurde, sah Mathematik im Curriculum vor, während die anschließende Ausbildung bei der niederländischen NZG ihm medizinische Kenntnisse vermittelte, s. KLEIN, Contact Zone, S. 226.
29 Einige medizinische Grundkenntnis zu haben erwies sich neben ihrer generellen Nützlichkeit in den mitunter wenig bis gar nicht erschlossenen Einsatzgebieten als vorteilhaft auch für missionarische Zwecke; so heißt es z. B. in China’s Millions, 1880, S. 90, über medizinische Kenntnisse, diese „would win the people to us in any part of the province. A medical missionary would probably find little or no difficulty in either travelling or settling anywhere“ (s. für ein weiteres Beispiel in demselben Jahrgang S. 41); ein Tagebucheintrag Margarys bestätigt dies: „[…] all foreigners are physicians in their eyes, and missionary doctors are especially successful“ (ALCOCK, Journey, S. 20); s. zur Margary-Affair unten S. 74. STUART, Fifty Years, S. XII, geht davon aus, dass „[h]istorically, the influence of the educational missionary – whether he had been an astronomer or mathematician from the Society of Jesus in the sixteenth or seventeenth century, or a learned scientist, scholar or physician from a Protestant Mission in the nineteenth century – has always been greater and more lasting and far-reaching than that of the evangelistic missionary of whatever church or denomination“. die Berichte der Missionare enthalten viele Ausführungen über die große Nachfrage von Medizin im Kampf gegen die Opiumsucht, s. nur einige Beispiele in China’s Millions, 1880: S. 15, 86, 90, 106, 110, 116, 146, 148. Die Zahl der von Missionsärzten betreuten Opium-Patienten in China habe Ende des 19. Jahrhunderts insgesamt 750000 betragen, s. LODWICK, Crusaders, S. 40.
30 Vgl. LUTZ, China, S. 156, u. ZETZSCHE, Bedeutung, S. 155.
31 Vgl. Chinese Repository, Bd. 4, S. 251f. „Our [i.e. the British and Foreign Bible Society’s] object is a very simple one. It is simply to increase the circulation of God´s Word; and, in carrying out that simple purpose, the constitution of the Bible Society is so simple that it is able to avail itself of the help of all missionaries who concur in this one great object” (John Sharp (1837-1917), Sekretär der Gesellschaft, 1881 in China’s Millions, S. 84).
32 TOWNSEND, Morrison, S. 62.
33 Noch 1869 gibt The Times bekannt, dass das britische „Parliament is not fond of missionaries, nor is the press, nor is general society”, zitiert in HUGHES, Invasion, S. 32.
34 RIDE, Morrison, S. 4, geht davon aus, dass Morrison sich diese Unterstützung von Madison in Voraussicht einer möglicherweise verweigerten Bleibegenehmigung für Kanton durch die EIC selbst organisiert hat; diese Vorahnung scheint sich erfüllt zu haben, da er zunächst in der amerikanischen Dependance in Kanton unterkam, vgl. S. 6.
35 Vgl. z. B. TOWNSEND, Morrison, S. 151f.
36 BALFOUR, Cyclopaedia, S. 178.
37 Noch 20 Jahre später waren es lediglich drei Europäer, allesamt Missionare, die der chinesischen Sprache mächtig waren, namentlich John Robert Morrison (1814-1843, Robert Morrisons Sohn), Elijah Bridgman (1801-1861) und Karl Gützlaff, s. SONGCHUAN, Information War, S. 1716. S aber auch oben Fn. 312.
38 S. HUGHES, Invasion, S. 61. S. ferner zur Amherst-Gesandtschaft unten S. 35f.
39 Bei Bogue in der Ausbildung lernte Morrison zum einen, dass die Übersetzung der Heiligen Schrift das vorrangige Ziel sei (vgl. RIDE, Morrison, S. 3) und dementsprechend ruhmvoll und zukunftsträchtig; andererseits sei die Verwendung der einheimischen Sprache und Denkweisen besonders zielführend für die Mission (vgl. z. B. DAILY, Morrison, S. 66 u. 98). Bei der Übersetzung vor allem zwischen zwei Sprachen verschiedener Sprachfamilien (hier Sinotibetisch u. Indoeuropäisch), deren soziokulturelle Konzepte sich zudem weit voneinander unterscheiden, birgt bei religiösen Texten insbesondere der in der Zielsprache verwendete Begriff Gottes Herausforderungen, die sich aus den Konnotationen, welche sich damit verbinden, ergeben können. Morrison stand seinerzeit vor der Entscheidung, entweder selbst einen Neologismus für die Bezeichnung des biblischen Gottes und folglich die sich damit verbindende judäo-christliche Dogmatik in die übersetzen christlichen Texte einzuführen; dergestalt hatten es vor ihm die römisch-katholischen Missionare mit Tien Chu, „Herr des Himmels“, getan. Oder er beschränkte sich rein auf die althergebrachte chinesische Sprache samt ihren Konnotationen und nahm damit in Kauf, dass sich für den Leser mit den Begrifflichkeiten mehr oder anderes verband, als nach der christlichen Lehre der Fall ist; Morrison entschied sich für letzteres (vgl. DAILY, Morrison, S. 132f.). MEDHURST widmete das Thema seiner Dissertation der „Theology of the Chinese, with a View to the Elucidation of the Most Appropriate Term for Expressing the Deity, in the Chinese Language“ (Mission Press, Shanghai 1847). MORRISON, Miscellany, S. 45, sieht „a portion of truth on both sides of the question; and the best way would have been to let the words go on to be employed, till they acquire a definite and correct meaning according to the Christian acceptation, from usage”. Die Auseinandersetzung um die richtige Wortwahl bei der Übersetzung des Gottesbegriffs ist als „Term Question“ (ZETZSCHE, Bedeutung, S. 157) in die Geschichte eingegangen u. wird noch 1851 von The Gleaner in the Missionary Field (II, Nr. 5, S. 40) unter den Missionaren als unentschieden angesehen.
40 Vgl. BOHR, Legacy, 173. Später würde Morrison Milne als „beloved friend and colleague” und „excellent, laborious, und indefatigable Missionary” (MORRISON, Knowledge, S. III) bezeichnen.
41 Die Kopie des Basset-Manuskripts, das Morrison in England zu übersetzen begonnen und mit nach Kanton genommen hatte, war seiner Ansicht nach eine Übersetzung der Vulgata (s. RIDE, Morrison, S. 45) u. enthielt neben einer Evangelienharmonie die Apostelgeschichte, die paulinischen Briefe und das erste Kapitel des Hebräerbriefes, s. LUTZ, China, S. 156. Die Apostelgeschichte ließ Morrison unverändert aus dem Basset Manuskript kopieren und als erstes drucken; in die Übersetzung des verbliebenen Teils des Neuen Testaments floss einige Eigenleistung, s. für die akademische Diskussion um Morrisons Anteil der Übersetzung DAILY, Morrison, S. 136ff., u. RIDE, Morrison, S. 19ff. u. 45ff.
42 Eine vollständige Bibliografie Morrisons ist enthalten in RIDE, Morrison, Appendix I (S. 43f.), u. STARR, Legacy, S. 76.
43 Vgl. ZETZSCHE, Bedeutung, S. 160ff.
44 Nachdem Druck und Distribution des Basset-Manuskripts durch die British and Foreign Bible Society (verkürzt Bible Society) von London aus nicht zustande gekommen waren, beteiligte sich diese nun mit 500 Pfund (mit 1000 Pfund nach DAILY, Morrison, S. 136, u. 2000 Pfund laut SONGCHUAN, Information War, S. 1730) an den Druckkosten, s. TIEDEMANN, Reference, S. 131. Bereits 1806 hatte der baptistische Missionar Joshua Marshman (1768-1837) in Serampore begonnen Chinesisch zu lernen mit dem Ziel, die Bibel zu übersetzen; die Bible Society bezuschusste gleichzeitig die Printkosten der Bibelübersetzung Morrisons u. Marshmans, vgl. MARSHMAN, Story, S. 94; vgl. ferner unten Fn. 207. Die LMS brachte ebenfalls 500 Pfund für Morrisons Bibelübersetzung auf, was der Höhe seines Jahresgehalts eines Übersetzers entsprach. 1831 bezog Morrison als Dolmetscher u. Übersetzter von der EIC 1000 Pfund, s. Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company, I, S. 185. In späteren Jahren vervielfachte sich Morrisons Gehalt bis auf 6500 Dollar pro Jahr. Mit diesem Geld konnte er über die Jahre unter anderem eine medizinische Bibliothek mit über 800 chinesischen Schriften und eine persönliche Bibliothek im Wert von mindestens 10000 Dollar anlegen. Ferner kam er auch mit seinem eigenen Vermögen für die Kosten der Publikation seines Buches „Domestic Instructor“ in Höhe von 1000 Dollar auf, vgl. ALCOTT, Life, S. 112ff.
45 MORRISON, Memoirs, I, S. 420. DAILY, Morrison, S. 4ff., merkt an, dass die Darstellungen der Hg., Eliza Morrison, durchaus beschönigende oder gar „hagiographische“ Elemente aufweise, was zum einen an ihrer Intention eines „richtigstellenden“ Nachrufs gelegen haben dürfte, denn während der letzten Dekade seiner Mission sei Morrisons Beziehung mit der LMS stark verkümmert (vgl. S. 4) beziehungsweise hätten deren Direktoren zwar Morrisons Erfolge als Aushängeschild für ihre eigenen Spendensammlungen genutzt, aber in Wirklichkeit ihre emotionale und finanzielle Unterstützung versiegen lassen (vgl. S. 5); zum anderen sei die Hagiographie im 19. Jahrhundert große Mode gewesen, so dass Eliza daraus kein Vorwurf gemacht werden könne, sich dieses Formats bedient zu haben (vgl. S. 7).
3. Karl Gützlaff
Quelle: Österreichische Illustrierte Zeitung, 1851, S. 168.
Man hatte schon in England miteinander Bekanntschaft gemacht;46 und zu Beginn seiner Chinamission hatte er bei Morrison Quartier gefunden; die Einschätzung Morrisons über seinen Hausgenossen war wenig schmeichelhaft: Er sei aufmüpfig, herrisch und ein schlechter Teamarbeiter.47 Die Rede ist „von dem ersten protestantischen deutschen Chinamissionar, dem aus Pyritz in Pommern stammenden Schneidermannssohn Karl Friedrich August Gützlaff“48.
1835 trat er – für immerhin 800 Pfund im Jahr – in den Dienst der britischen Regierung und wurde 1843 Sekretär der neugebildeten Kolonialregierung von Hongkong. Gützlaff ist in den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts der stärkste Propagandist einer protestantischen Mission im „Reich der Mitte“ gewesen. Eine unkirchliche Christus-Frömmigkeit und Abenteuerlust hatten ihn den Beruf eines Missionars wählen lassen.49
Dieser Abriss der markantesten Gesichtspunkte seiner Chinamission kann ahnen machen, dass die Meinungen über ihn bis heute weit auseinandergehen. Das lag und liegt insbesondere daran, dass seine Nähe zu den britischen Hauptakteuren in (legalem wie illegalem) Handel und Politik äußerst groß war und er keinen Unterschied zwischen seiner Missionsarbeit, Erwerbstätigkeit und Bediensteter des britischen Staates machte, weil seine theologischen Überzeugungen dies nicht notwenig erschienen ließen. So beschrieb ihn ein Kritiker zum Beispiel als „monströse[r] religiöse[r] Betrüger“, „preußische[r] Freibeuter“ oder „geistesgestörte[r] Abenteurer mit jesuitischer Kasuistik“50. Gützlaffs Grabstein hingegen gibt ein wesentlich anderes Bild, das Zeitgenossen von ihm hatten, wieder. Auf diesem wird ihm im Anschluss an die Bezeichnung Pauli als „Apostel der Heiden“ der Titel „Apostel der Chinesen“51 verliehen und „die repräsentative Größe des Sarkophags macht dem Betrachter […] noch heute deutlich, daß Karl Gützlaff von seinen Zeitgenossen als eine ungewöhnliche, überdurchschnittliche Person anerkannt worden ist, deren Andenken auch bei späteren Generationen gesichert werden sollte“52.
Während die chinesische Führung in ihm einen der Hauptkonspirateure gegen ihre Interessen sah,53 bezeugte sein Missionarskollege Jacob TOMLIN (1793-1880) ihm jedenfalls ein freundschaftliches Auskommen mit der einheimischen Bevölkerung:
It is delightful and amusing to see him conversing with the people. His simplicity, frankness, and benevolence, win their hearts, and fix their attention. Though yet a novice in the language, he presses onward regardless of difficulties. The people laugh at his blunders, and he, good humouredly, laughs with them. And when they observe him in straits, they kindly help him out, by supplying him with words.54
Wie Morrison, der unter dem Einfluss der Revival-Bewegung großen missionarischen Eifer entwickelt hatte, war auch Gützlaff während seiner Berliner Ausbildung in der Schule Jänickes55 mit dem Denken der pietistischen und der Erweckungsbewegung in Kontakt gekommen;56 er selbst berichtete auch von einem Erweckungserlebnis.57 Nachdem er von Berlin für eine mehrjährige Vorbereitung auf seinen Missionseinsatz nach Rotterdam, Paris und London gegangen war, wurde er 1826, nachdem eine die ursprünglich für 1824 geplante Sendung zu Morrisons anglo-chinesischen College nicht möglich gewesen war, von der NZG nach Niederländisch-Indien geschickt.58 Anfang 1827 in Batavia (dem heutigen Jakarta) angekommen, traf er auf den dort seit Jahren wirkenden Medhurst, der auf ihn großen Einfluss hatte. Im Anschluss an diesen fasste Gützlaff den Entschluss, Chinesen in den Fokus seiner Missionsarbeit nehmen.59 Wenn er sich nicht bereits vorher mit dem Gedanken der Chinamission getragen hatte, so muss Medhursts Eindruck auf Gützlaff enorm gewesen sein, denn „[w]ithin a week after landing in Batavia, Gützlaff had sent an appeal to Europe for greater support for work among the Chinese, and by April he had obtained the permission […] to transfer to the Dutch controlled Island of Bintan off Singapore“60.61 Auch gegenüber seinem späteren Kollegen Tomlin, der Gützlaff im September desselben Jahres zufällig bei einer Exkursion von Singapur aus dort traf, beklagte sich dieser darüber, „to be shut up within the bounds of a small island“, und er sehnte sich danach, „to go forth and proclaim the gospel [sic] in other regions, and especially to the millions in China“62.
Im Unterschied zu Morrison, der ganz nach den Weisungen seiner Missionsgesellschaft den Schwerpunkt auf die Übersetzung insbesondere der Bibel ins Chinesische legte,63 folgte Gützlaff seinem eigens gefassten, ehrgeizigen Plan, nach welchem sich in kürzester Zeit Millionen von Chinesen dem Kreuz Christi unterwerfen sollten. Um sich durch sein Erscheinungsbild möglichst weitgehend dem chinesischen Umfeld zu assimilieren, legte Gützlaff, anders als Morrison, dem das Tragen chinesischer Kleidung zuwider war, während seines gesamten Aufenthalts in China chinesische Tracht an. Denn Gützlaff war davon überzeugt, dass es für einen umfänglichen Missionserfolg nicht nur notwendig sei, die jeweilige Landessprache zu beherrschen, sondern sich auch äußerlich dem Missionsfeld anzugleichen und so den eigenen soziokulturellen Hintergrund weitmöglichst von der religiösen Botschaft zu abstrahieren. Dabei ging Gützlaff sogar so weit, sich als Angehöriger des Xiamener Klans der Guo aufnehmen zu lassen. Dadurch „agierte [er] innerhalb bestimmter Netzwerkstrukturen, genoß zahlreiche Privilegien und wurde schamlos ausgenutzt und übervorteilt“64.65
Die Erfahrungen, die Gützlaff vor seinem Antritt in China machte, waren für seine späteren Entwicklung prägend. TOMLIN, der 1826 von der LMS nach Malakka gesandt worden war und sich 1828 bis 1829 einige Monate in Siam (Thailand) aufhielt, beschrieb die Aufgeschlossenheit der chinesischen Seeleute für die christliche Religion,66 und wie der „well known Missionary Gutzlaff, felt called in the providence of God, after two years’ study in the Language to embark in a junk for Siam; and immediately on their arrival began to proclaim the Gospel to the Chinese, who abound there, and by whom they were gladly received; and were much blessed and prospered of the Lord.“67 Widerstand gegen die Religionsverkündigung habe es zwar auch gegeben, jedoch nicht „a tenth part of what it encounters in India“. Der Geograf Carl RITTER (1779-1859) zeichnete 1834 in dem Abschnitt über die chinesische Kolonisation in Siam seines 11-bändigen Werks “Die Erdkunde im Verhältniß zur Natur und Geschichte des Menschen“ ein geradezu dramatisches Bild von dem Anklang, den das Missionarsduo hervorgerufen habe:
Der Zulauf dieser Chinesen zu den Missionaren war in Bangkok so groß, daß er den Phra klang (Minister) und das Gouvernement in Schrecken versetzte, und einen Aufruhr befürchten ließ, denn nicht blos [sic] aus der Stadt, sondern auch vom Lande kamen sie mehrere, 2 bis 5 Tagereisen weit herbeigeeilt, um sich chinesische Übersetzungen des Alten und Neuen Testaments und andere Chinesische Tractätchen zu holen oder sich vom Arzneikundigen der Mission, von Gützlaff, curiren zu lassen.68
Diese Darstellung Ritters entspricht inhaltlich einem Brief Tomlins vom November 1828 an die „Bibelgesellschaft in London“69, zusammengefasst und angereichert durch das Detail unbekannter Quelle, das Erscheinen der Missionar habe Befürchtungen von Ausschreitungen hervorgerufen.70 Während seines Aufenthalts in Thailand von 1828-1831 heiratete Gützlaff Maria Newell (*1794). Als Maria 1831 unzeitig verstarb, hinterließ sie ihrem Gatten ein kleines Vermögen, durch das er finanziell so gestellt war,71 sich von NZG zu lösen und fortan als Freimissionar unterwegs zu sein.72 Nach seiner Rückkehr von Erkundungsfahren entlang der chinesischen Küste und der Japanreise auf der „Morrison“, die 1833 begonnen hatte, nahm Gützlaff 1834 in Macao Mary Wanstall (1799-1849) zur Frau, die ihrerseits ein kleines Vermögen mitbrachte.73





























