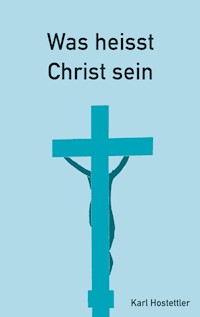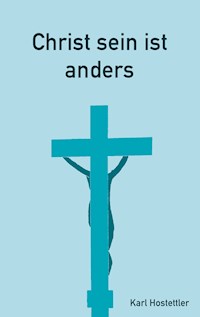
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was will unser christlicher Glaube? Unser Christentum geht auf den Juden Jesus zurück. Viele sehen ihn als den leiblichen Sohn Gottes. Viele halten ihn sogar für den Mensch gewordenen Gott. Können wir solchen Aussagen vertrauen? Ich kann es nicht. Aber ich erkenne das Neue, das Jesus in einen Glauben eingebracht hat. Der Glaube muss uns dienen, und zwar allen Menschen! Dazu ist er da.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Titelbild: Tobias Koster
Theologische Beratung: Pfarrer Urs Hostettler
Karl Hostettler, ursprünglich Ing. Agr. und Dr. sc. techn, beendete 2004 als Frührentner an Universität Zürich ein Studium der Philosophie. In diesem Zusammenhang befasst er sich intensiv mit Fragen der Erkenntnis, die auch im Glauben eine grosse Rolle spielen.
Von 1974 bis 1977 arbeitete er als Landwirtschaftlicher Berater für eine einheimische Kirche in Westborneo.
Inhalt
Worum es mir geht
Kurz zum christlichen Glauben
Zur Bibel
Der Mensch Jesus
Wissen und glauben
Was leisten Religionen?
Seele, gibt es das?
Natur und Kultur
Pflicht und Nutzen
Das Glück
Und jetzt?
Wünsche an meine Kirche
Das Glaubensbekenntnis für ein Kind bei seiner Taufe
1 Worum es mir geht
Schaffen wir gemeinsam eine möglichst gute Welt! Es ist dies das Ziel, das ich mit meiner Schrift verfolge. Ich glaube an dieses Ziel. Ich lebe für dieses Ziel. Es ist auch das Ziel des christlichen Glaubens.
Mir stellt sich ein Problem. Zwar bin ich als Christ aufgewachsen und während langer Zeit habe ich meinen christlichen Glauben nicht in Frage gestellt. Heute ist es anders. Ich frage mich: Soll ich mich als älterer Mensch noch immer zum christlichen Glauben bekennen? Doch, ich will es. Aber meine christliche Erziehung genügt mir nicht mehr. Heute stelle ich mir die Frage, ob meine eigenen Ziele und jene des christlichen Glaubens einander noch entsprechen.
Zum Verständnis meiner Aussagen muss ich erklären, wie ich denke. Ich glaube an den Verstand. Ich lehne ab, was er mich nicht gutheissen lässt. Ihm verdanke ich mein Wissen. Er sagt mir, was Wissen ist, was „wissen“ bedeutet und wie wir zu Wissen gelangen. Er sagt mir auch klar: Es gibt Wissen. Es muss Wissen geben! Denn ohne viele Kenntnisse über unsere Welt könnten wir gar nicht leben.
Mein Verstand sagt mir aber noch anderes. Ihm verdanke ich auch die Erkenntnis, dass wir nie alles wissen werden. Unser Leben zum Beispiel ist endlich. Woher wir kommen und wohin wir gehen, werden wir wohl nie sagen können! Noch nicht einmal uns selbst, uns in unserem Erleben, können wir erklären. In manchen Fällen bleibt nur der Glaube!
Um eine Antwort auf meine oben erwähnte Frage zu finden, muss ich wissen, was der christliche Glaube wirklich will. Für manche ist Christ, wer an Gott, an die Bibel und an Jesus glaubt. Manche glauben an Jesus als den leiblichen Sohn Gottes. Manche sehen ihn sogar als den Mensch gewordenen Gott! Für manche Gläubigen gehören zum christlichen Glauben neben einem gottgewollten Denken und Tun noch verschiedene religiöse Handlungen. ‒ Viele solcher Vorstellungen sind mir fremd.
Vor 2000 Jahren hat uns ein Jude mit seinen Worten und seinem Handeln das Wesentliche unseres Glaubens gezeigt. Er lehrt uns anderes. Um zu erkennen, was er wirklich wollte, müssen wir zu ihm und seinen eigenen Worten zurückgehen. Anhand der vorliegenden Berichte, kritisch betrachtet, erkennen wir es leicht: Christ sein ist anders; anders, als es sich viele Menschen vorstellen, auch Menschen, die sich für strenggläubige Christen halten! Der Frage, was Jesus wollte, geht systematisch die heutige Theologie nach. Sie sagt nicht nur, was die jüdische Religion gemäss Bibel will. Sie sagt vor allem auch, welche neuen Forderungen Jesus – als gläubiger Jude! ‒ an den Glauben gestellt hat. Das Bild der kritischen Theologie widerspricht manchem Alltagsglauben.
Was also wollte Jesus wirklich? Seine grosse Leistung: Er hat im Glauben einen Sinn gesucht. Jesus war gläubiger Jude. Aber es ging ihm nicht um ein wörtliches Einhalten der religiösen Vorschriften seines Volkes. Die Religion und ihre Regeln sollten uns Menschen dienen. Dazu sind sie da. Für Jesus waren der Wille Gottes und das Wohl der Menschen eins. Seine zweite Leistung: Er hat seinen Glauben – der jüdische Glaube galt nur für Juden unter Juden – für alle Menschen geöffnet. Es geht im christlichen Glauben also um den Sinn all dessen, was wir tun, und es geht um den gleichen Wert aller Menschen. Mit diesen Forderungen als Ziel unseres Tuns hat Jesus einen neuen Aspekt in einen Glauben eingebracht. Wichtig ist nicht in erster Linie, streng nach religiösen Vorschriften zu leben. Wichtig ist das Ziel, das wir mit einer Handlung verfolgen. Jesus hat sich vor 2000 Jahren diese Frage gestellt und das eigentliche, vernünftige Ziel jeder religiösen Forderung erkannt. Er hat auch seiner Erkenntnis entsprechend gehandelt. Wenn wir in dieser Erkenntnis das Wesentliche unseres Glaubens sehen und nach ihr zu leben versuchen, brauchen wir uns vor keiner anderen Religion zu fürchten.
In einem möchte ich Jesus ergänzen. Nach heutigem Wissen verfügen auch gewisse Tiere über Empfindungen. Für mich als heutiger Mensch bezieht sich daher die christliche Forderung nach einem Sinn jeder Handlung auf alle erlebenden Wesen.
Wir leben in einer neuen Zeit.
Heute wissen wir vieles, was zur Zeit von Jesus noch nicht bekannt war. Manche Fragen hat früher die Religion beantwortet. Doch viele Aussagen haben sich als Trug erwiesen. Heute haben wir auf manche früheren Fragen verlässliche Antworten. Wir wissen zum Beispiel, dass die Erde rund ist, dass sie sich täglich um sich selbst und jedes Jahr einmal um die Sonne dreht. Sogar über das Alter des Universums gibt uns eine Theorie Auskunft! Auch die Welt im ganz Kleinen erforschen wir. Auf manches neue Wissen können wir vertrauen, und zunehmend haben wir Mühe an Sachverhalte zu glauben, die dem wissenschaftlichen Weltbild widersprechen. Manche Menschen glauben, dass wir sogar einmal alles wissen werden, was zu wissen sich lohnt. (Ich selbst glaube es nicht.)
Wir leben heute – in der westlichen Welt – in einer neuen Zeit mit neuen Anforderungen. Dank dem technischen Fortschritt betrachten wir die Natur als gebändigt. Die Schwierigkeiten des Überlebens haben wir gemeistert. Sorge um die eigene materielle Existenz kennen wir nicht mehr. Gebannt ist auch die Gefahr des Hungers. Keine Religion muss uns noch zum Ausgleich der Widrigkeiten des Alltags Trost spenden! So haben sich denn auch unsere Lebensziele geändert. Heute leben wir vor allem um eines guten Lebens willen.
Auch unsere Auffassung über die Bedeutung des Glaubens ist eine andere geworden. Warum noch einen Gottesdienst besuchen? Manche Menschen stellen sich diese Frage. Die Kirchen bleiben weitgehend leer. Die Anzahl der Kirchenaustritte steigt. Ich will es nicht verschweigen: Auch ich selbst besuche kaum Gottesdienste. Weshalb sollte ich denn? Braucht ein Gott, ein allmächtiger, wirklich dieses Zeichen menschlicher Gefolgschaft? Ja, wir denken heute anders und wir brauchen anderes. Das betrifft auch mich.
Religion, noch aktuell?
Die Bedeutung unseres Glaubens hat sich tatsächlich verändert. Zwar mögen manche Menschen eine gewisse Religiosität noch immer als gut ansehen. Aber welche Religion soll es denn sein? Verbreitet hören wir die Auffassung, alle Religionen hätten ihr Gutes; denn stellten nicht alle an uns die Anforderung, gut zu handeln? Daher sollten wir sie alle als gleichwertig betrachten. Vielleicht werden gewisse Unterschiede eingestanden. Aber sollen diese für uns ein Problem sein? Auch dem eigenen Glauben, dem christlichen, so, wie ihn die Kirche lange Zeit gelehrt hat, kann man nicht immer folgen! Häufiger Schluss: In Glaubensfragen braucht es eben Toleranz. Jede Religion ist gut. Eine tolerante Gesinnung hilft uns über dasjenige hinwegzusehen, was uns vielleicht nicht gefällt.
Doch nun ein Einwand. Ist die Auffassung von einer angeblichen Gleichwertigkeit aller Religionen nicht gerade das Ergebnis von Gleichgültigkeit? Wollen die verschiedenen Religionen wirklich im Prinzip dasselbe? Woher wissen das die Gleichgültigen? Kennen sie überhaupt den Inhalt der verschiedenen Religionen? Es geht nicht nur um fremden Glauben. Es geht auch um den eigenen. Verfügen wir auch über ihn über hinreichende, sachlich kompetente Information?
Hat aber der christliche Glaube nicht ohnehin ausgedient? Er hat nicht. An Bedeutung verloren haben alt hergebrachte Glaubensinhalte, wie sie noch immer das Denken mancher Christen prägen. Auch die Kirchen sind gefordert. Wenn sie den christlichen Glauben erhalten wollen, müssen sie sich den Anforderungen des heutigen Lebens stellen und nicht versuchen, die heutigen Menschen den alten Vorstellungen anzupassen.
Trotz aller Wissenschaft bleiben noch immer Fragen, auch Fragen, die uns stark interessieren. Was können wir glauben? Was müssen wir glauben? Müssen wir überhaupt etwas glauben? Und: Was sollen wir tun? Was dürfen wir nicht tun? Wie rechtfertigen wir unser Handeln?
Irrglaube
Einige noch immer verbreitete Meinungen zum christlichen Glauben lehne ich ab. Eine Behauptung lautet, nur der Glaube an Jesus könne uns retten, das heisst, der Glaube an seine reale Existenz als Sohn Gottes. Manche ziehen aus dieser Aussage den Schluss, es sei daher unsere Aufgabe, möglichst vielen Menschen von Jesus zu berichten. Sollen tatsächlich all die vielen, die nie etwas von Jesus gehört haben, verloren sein? Von diesem merkwürdigen Glauben habe ich mich schon als junger Mensch verabschiedet!
Auch eine andere Aussage lehne ich klar ab. Es handelt sich um die Vorstellung, nach der die Guten – zu denen man in der Regel sich selbst auch zählt – nach dem Tod ein ewiges Leben geniessen dürfen, die Schlechten dagegen für ihre Taten büssen müssen. Davon hat Jesus nichts gesagt. In der Bergpredigt hat er jene genannt, die sich am Ende ihres Lebens freuen können: Freuen dürfen sich – unter anderem – jene, die man beschimpft und verfolgt hat und denen auch zu Unrecht alles Schlechte nachgesagt wurde. Aber die Guten? Und die Frommen? Und die Gerechten? Von all denen spricht Jesus nicht.
Zur Schrift
Die ersten Kapitel meiner Schrift enthalten kurz das nötige Wissen über unsere Religion. Es sind Bemerkungen zur Entstehung unseres Glaubens, einiges zur Bibel und schliesslich zu Jesus ‒ wer er war und was er vermutlich gewollt hat. Es handelt sich um Sachverhalte, über die nach meiner Ansicht jeder Christ informiert sein sollte. Sie widersprechen in manchen Fällen landläufigen und auch oft gehörten Meinungen. ‒ Die Bemerkungen werden ergänzt durch Gedanken zum Unterschied zwischen Wissen und Glauben und zur allgemeinen Bedeutung von Religionen.
Für mich war Jesus ein Genie. Um seine Leistung richtig würdigen zu können, müssen wir uns aber mit dem eigenen, menschlichen Wesen auseinandersetzen, und zwar ohne religiöse und andere Vorurteile. Im zweiten Teil meiner Arbeit werde ich auf solche Fragen eingehen und darzustellen versuchen, was uns als Menschen ausmacht, wo unsere realen Interessen liegen, weshalb in uns nicht nur Gutes lebt und wie wir das Schlechte hoffentlich überwinden werden. Offensichtlich hat Jesus einen grossen Teil dieses Wissen schon vor 2000 Jahren erahnt. Was sollen wir zum Beispiel als Sünde betrachten? Wir empfinden.
Empfindungen machen uns aus. Dank unseren Gefühlen können wir uns freuen. Empfindungen können uns aber auch quälen. Als Sünde müssen wir betrachten, was Leiden schafft. Gut ist dagegen, für ein gutes Leben und gegen das Leid zu kämpfen. Woher kommt aber das Übel? Es ist nicht gottgewollt. Das meiste Schlechte schaffen wir selbst! In uns leben ein Engelchen und ein Teufelchen. Wir brauchen beide! Sie machen uns zu einem widersprüchlichen Wesen. Wie gehen wir mit dieser Widersprüchlichkeit um? Ohne uns selbst zu verstehen, werden wir das Übel nicht meistern! Ein Blick auf unsere Entstehung erklärt die Herkunft unserer Widersprüchlichkeit. Er zeigt auch, weshalb wir glauben, was wir gern glauben und weshalb wir glauben müssen.
Die Schrift schliesst mit meinen Schlüssen auf einen der heutigen Zeit angepassten, christlichen Glauben.
2 Kurz zum christlichen Glauben
Wir kennen manche Religionen. Oft stellen sie Forderungen an unser Verhalten und machen Aussagen über Sachverhalte, die unserem Wissen nicht zugänglich sind. Was sie lehren, soll wahr sein. Doch die Aussagen der einzelnen Religionen unterscheiden sich. Nicht alle Inhalte können zutreffen. Heute stellen wir uns zunehmend auch ernsthaft die Frage, wie weit Religionen, so wie wir den Begriff „Religion“ verstehen, noch in die heutige Welt passen. Wir müssen uns entscheiden: Wollen wir uns zu einer Religion bekennen? Wenn ja, zu welcher? Ich habe mich entschieden. Ich zähle mich zu den Christen.
Doch uns Christen stellt sich noch immer ein Problem. Oft beachten wir es nicht. Es gibt nicht einfach ein Christentum. Die Glaubensvorstellungen der einzelnen christlichen Gemeinschaften unterscheiden sich. Auch die katholische Kirche, die sich während der längsten Zeit für die einzige wahre christliche Kirche hielt, vertritt eigene Auffassungen, die sich zum Teil nicht einmal biblisch begründen lassen. Einige dieser Auffassungen müssen wir – Rom wird es nicht gern hören – nach unserem heutigen Weltbild als esoterisch bezeichnen. Zum Glück glauben auch viele gute Katholiken nicht mehr an alles, was die Kirche offiziell noch lehrt. Unser Denken hat sich geändert! Es ist allerdings noch nicht lange her.
Dazu ein persönliches Erlebnis. Vor 60 Jahren lese ich in der Zeitung „Neue Zürcher Nachrichten“, der damaligen katholischen Zeitung Zürichs, die katholische Kirche betrachte die Reformierten nicht mehr als Sünder, nur noch als unschuldig Irrende. Meine Begeisterung für diese Toleranz hielt sich für mich als evangelischer Christ in Grenzen.
Wenn wir uns schon als einer Religion zugehörig betrachten, sollten wir auch ihre Grundlagen kennen. Das tun wir meistens nicht. Als Kind besuchte ich fleissig die Sonntagsschule, später die Kinderlehre und schliesslich den Konfirmandenunterricht. Eine Teilnahme an diesen Kursen war damals selbstverständlich. Sachliche Information gab es auch. Oder soll ich von „Indoktrination“ reden? Wir hörten etwas von Noah und seiner Arche, von den Zehn Geboten und von Nächstenliebe. Wir hörten von Jesus’ Geburt als Sohn Gottes, von seinen Wundern und seinem Tod am Kreuz. Er sei gestorben, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Wir mussten auch das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig lernen, das unter anderem von der unbefleckten Empfängnis der Maria spricht. Was man uns erzählte, galt als wahr. Wir hatten es zu glauben. Bemerkungen oder Fragen gab es nicht. Auch wir, die Schüler, verlangten nicht danach.
Die Zeit hat sich geändert. Heute sind die Fragen da. Was wissen wir eigentlich von Jesus? Hat er überhaupt gelebt? Er, der nichts Schriftliches hinterlassen hat? Was wollte er? Was hat er wirklich gesagt? Was hat er geleistet? Was können wir glauben? Was müssen wir glauben? Jesus muss ein Kind seiner Zeit gewesen sein. Welche Probleme bewegten die Menschen in seinem Umfeld? Hilft uns eine kritische Betrachtung seiner Worte und der biblischen Texte, unseren Glauben besser zu verstehen? Manches, was zu wissen wichtig wäre, hat man uns damals im Religionsunterricht nicht gesagt. Kritische Stellen, wie wir sie in der Bibel auch finden, wurden umschifft.
Bemerkungen zur Entwicklung des Judentums bis Jesus
Das Alte Testament enthält Berichte über die Geschichte des jüdischen Volkes und über die Entstehung des jüdischen Glaubens. Vermutlich waren bei den Ahnen der Juden, wie auch bei anderen urtümlichen Völkern, sogar Menschenopfer üblich. Diesen Schluss ziehen wir aus dem Bericht über Abraham, der bereit war, seinen eigenen Sohn Isaak Gott zu opfern. Die Bibel zeigt auch eine Entwicklung der israelitischen Gottesvorstellungen. Die Auffassung eines Gottes, der keine anderen Götter neben sich duldet, ist erst allmählich entstanden. Der verehrte Gott war vorerst ausschliesslich Gott der Israeliten. Die monotheistische Auffassung, die Auffassung eines einzigen Gottes aller Menschen und des ganzen Universums, hat sich erst im Verlaufe der Geschichte entwickelt.
Als Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk der Juden dient die Beschneidung der Knaben. Daneben regelt eine grosse Anzahl an Vorschriften das tägliche Leben. Die Forderungen des Glaubens, auch die moralischen wie die Zehn Gebote, bezogen sich ursprünglich nur auf den Umgang der Juden mit anderen Juden. Dasselbe gilt auch für die Forderung nach Nächstenliebe, eine Vorschrift, die wir in den Büchern Mose finden. Nächstenliebe ist also keine Erfindung