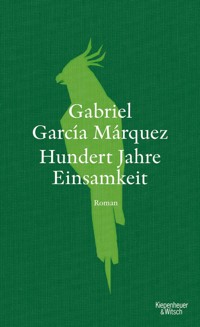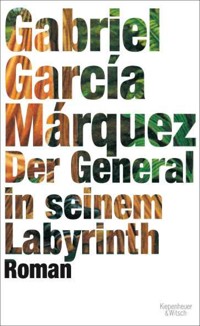9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Chronik eines angekündigten Todes: Eine schicksalhafte Hochzeitsnacht entfesselt eine Kette tragischer Ereignisse In einem kolumbianischen Karibikdorf heiratet Bayardo San Roman seine Braut Angela Vicario mit einem prunkvollen Fest. Doch in der Hochzeitsnacht bringt er sie zurück zu ihren Eltern - sie war nicht mehr unberührt. Angela nennt den Namen ihres angeblichen Verführers, und ihre Zwillingsbrüder machen sich mit Fleischermessern bewaffnet auf, die Familienehre wiederherzustellen. Jeder im Dorf weiß von der geplanten Rachetat, doch niemand greift ein, als blinder Gehorsam gegenüber starren Vorurteilen die Brüder zu einer sinnlosen Gewalttat treibt. Jahre später rekonstruiert der Erzähler akribisch die Geschehnisse jener schicksalhaften Stunden, die eine ganze Gemeinschaft in Schuld verstricken. Mit der ihm eigenen poetischen Präzision ergründet Nobelpreisträger Gabriel García Márquez in Chronik eines angekündigten Todes die menschlichen Abgründe hinter einem Verbrechen aus verletzter Ehre. Ein zutiefst bewegender Roman über die fatale Macht gesellschaftlicher Zwänge und die Tragik einer verketteten Schuld.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Gabriel García Márquez
Chronik eines angekündigten Todes
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gabriel García Márquez
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez, geboren 1927 in Aracataca, Kolumbien, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist. 1982 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Gabriel García Márquez hat ein umfangreiches erzählerisches und journalistisches Werk vorgelegt. Er gilt als einer der bedeutendsten und erfolgreichen Schriftsteller der Welt. García Márquez starb am 17. April 2014 im Alter von 87 Jahren in Mexiko-Stadt.
Der Übersetzer
Curt Meyer-Clason (1910‒2012), übersetzte aus dem Spanischen, Portugiesischen, Englischen und Französischen, u.a. Werke von Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, João Guimarães Rosa, Brendan Behan, Elie Wiesel.
Das gesamte Werk von Gabriel García Márquez ist lieferbar bei Kiepenheuer & Witsch.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In einem Dorf an der kolumbianischen Karibikküste feiert Bayardo San Roman seine Hochzeit. Ein prunkvolles Fest wird gefeiert, und dass die Braut den Bräutigam nicht liebt, scheint ein unwesentliches Detail, denn »Liebe erlernt sich«. Doch auf das Fest folgt der Skandal. Angela Vicario, die schöne Braut, wird noch in der Nacht von ihrem Ehemann ins Elternhaus zurückgebracht; sie war nicht mehr unberührt. Angela offenbart den Namen des angeblichen Täters, und mit Fleischermessern bewaffnet ziehen ihre Zwillingsbrüder los, um die Tat zu sühnen, das heißt, den Verführer zu töten. Das ganze Dorf erfährt von ihrer bitteren Pflicht. Jeder weiß, dass hier Vorurteile eine sinnlose Tat auslösen, doch niemand schreitet ein. Jahre später befragt der Ich-Erzähler alle Zeugen und rekonstruiert den Ablauf des tragischen Geschehens, die wenigen Stunden von der Ankündigung bis zur Ausführung des grausamen Verbrechens.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Crónica de una muerte anunciada
© Gabriel García Márquez, 1981
Aus dem Spanischen von Curt Meyer-Clason
© 1981 by Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Überarbeitet von Dagmar Ploetz
© 2006, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Lektorat: Bärbel Flad
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
ISBN978-3-462-30674-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Liebesjagd ist Falkenjagd
Gil Vicente
An dem Tag, an dem sie ihn töten sollten, stand Santiago Nasar um fünf Uhr dreißig morgens auf, um das Schiff zu erwarten, mit dem der Bischof kam. Er hatte geträumt, er wandere durch einen Wald von Feigwürgern, in dem ein sanfter Nieselregen fiel, und einen Augenblick lang war er im Traum glücklich gewesen, beim Erwachen aber fühlte er sich vollständig mit Vogelkot bespritzt. »Er träumte immer von Bäumen«, sagte mir Plácida Linero, seine Mutter, als sie siebenundzwanzig Jahre später die Einzelheiten jenes unglückseligen Montags beschwor. »In der Woche davor hatte er geträumt, er säße allein in einem Flugzeug aus Silberpapier, das zwischen Mandelbäumen hindurchflog, ohne anzustoßen«, sagte sie. Sie hatte den wohlverdienten Ruf einer zuverlässigen Deuterin fremder Träume, sofern man sie ihr auf nüchternen Magen erzählte, und doch hatte sie in den beiden Träumen ihres Sohnes kein unheilvolles Vorzeichen entdeckt, auch nicht in den anderen Baum-Träumen, die er ihr an den Tagen vor seinem Tod erzählt hatte.
Auch Santiago Nasar erkannte das Omen nicht. Er hatte kurz und schlecht geschlafen, ohne sich ausgezogen zu haben, und erwachte mit Kopfschmerzen und einem Geschmack wie von Messingsteigbügeln auf der Zunge, was er als natürliche Nachwirkungen des Hochzeitsgelages deutete, das sich bis nach Mitternacht hingezogen hatte. Mehr noch: Die zahlreichen Personen, denen er begegnete, nachdem er sein Haus um sechs Uhr fünf verlassen hatte und bevor er eine Stunde später wie ein Schwein abgestochen wurde, erinnerten sich seiner als etwas verschlafen, aber gutgelaunt, und zu allen hatte er beiläufig bemerkt, es sei ein sehr schöner Tag. Niemand wusste genau, ob er das Wetter gemeint hatte. Viele stimmten in ihrer Erinnerung überein, dass es ein strahlender Morgen gewesen war, mit einer Brise vom Meer, die durch die Bananenpflanzungen wehte, wie es zu jenen Zeiten in einem schönen Februar zu erwarten war. Die meisten waren sich indes einig, dass es düsteres Wetter gewesen war mit einem trüben niedrigen Himmel und einem zähen Geruch nach stehenden Gewässern und dass im Augenblick des Unglücks ein leichter Nieselregen fiel, wie ihn Santiago Nasar im Wald seines Traums gesehen hatte. Ich erholte mich da gerade in María Alejandrina Cervantes apostolischem Schoß vom Hochzeitsrummel und ließ mich nur kurz vom Dröhnen der Glocken wecken, dachte ich doch, es würde zu Ehren des Bischofs Sturm geläutet.
Santiago Nasar zog eine Hose und ein Hemd aus weißem Leinen an, beide ungestärkt, wie er sie auch am Vortag bei der Hochzeit getragen hatte. Es war die Kleidung zum gegebenen Anlass. Ohne die Ankunft des Bischofs hätte er seinen Khaki-Anzug und die Reitstiefel angezogen, in denen er montags zum »Göttlichen Antlitz« ritt, der von seinem Vater geerbten Hacienda, die er mit viel Umsicht, aber wenig Erfolg verwaltete. Im Bergland trug er eine 357 Magnum im Gürtel, deren Mantelgeschosse, wie er sagte, ein Pferd in der Mitte entzweireißen konnten. Zur Rebhuhnzeit nahm er auch seine Gerätschaften für die Beizjagd mit. Im Schrank verwahrte er überdies eine Mannlicher-Schönauer Büchse 30.06, eine 300 Holland Magnum, eine 22er Hornet Büchse mit zweistufigem Zielfernrohr und einen Winchester Repetierer. Wie sein Vater schlief auch er immer mit der Pistole im Kopfkissenbezug, doch bevor er an jenem Tag das Haus verließ, nahm er die Patronen aus der Waffe und legte diese in die Nachttischschublade. »Er ließ sie nie geladen zurück«, sagte mir seine Mutter. Ich wusste das, auch dass er die Waffen an einem Ort verwahrte und die Munition weit weg davon an einem anderen versteckte, damit nicht durch Zufall jemand in Versuchung käme, die Waffen im Haus zu laden. Das war eine weise Gewohnheit, die sein Vater eingeführt hatte, nachdem ein Dienstmädchen eines Morgens beim Wechseln der Bezüge das Kopfkissen geschüttelt hatte, und dabei die Pistole auf den Boden schlug und losging, die Kugel den Schlafzimmerschrank zertrümmerte, die Wohnzimmerwand durchdrang, mit Kriegsgetöse durch das Esszimmer des Nachbarhauses flog und einen lebensgroßen Heiligen auf dem Hochaltar der Kirche am anderen Ende der Plaza in Gipsstaub verwandelte. Santiago Nasar, damals noch ein kleiner Junge, hatte jenen Zwischenfall nie vergessen und die Lektion gelernt.
Das letzte Bild, das seine Mutter von ihm bewahrte, war sein kurzes Erscheinen im Schlafzimmer. Er hatte sie geweckt, als er in dem Arzneischränkchen im Badezimmer nach einem Aspirin tastete, sie knipste das Licht an und sah ihn, das Glas Wasser in der Hand, in der Tür stehen, so wie er ihr für immer in Erinnerung bleiben sollte. Santiago Nasar erzählte ihr dann seinen Traum, doch sie achtete nicht auf die Bäume.
»Alle Träume mit Vögeln bedeuten gute Gesundheit«, sagte sie.
Sie sah ihn von derselben Hängematte aus, in der gleichen Stellung, in der ich sie in den letzten lichten Momenten ihres Alters hingestreckt fand, als ich in dieses vergessene Dorf zurückgekehrt war, um den zerbrochenen Spiegel der Erinnerung aus den vielen verstreuten Scherben wieder zusammenzusetzen. Sie konnte auch bei Tageslicht kaum noch Umrisse erkennen, und auf den Schläfen hatte sie Heilkräuter zur Linderung der ewigen Kopfschmerzen, die ihr der Sohn bei seinem letzten Gang durchs Schlafzimmer hinterlassen hatte. Sie lag auf der Seite, hielt sich an den Hanfstricken am Kopfende der Hängematte fest, um sich aufrichten zu können, und im Dämmerlicht hing dieser Geruch nach Taufkapelle, der mich am Morgen des Verbrechens überrascht hatte.
Kaum war ich in der Türöffnung erschienen, verschmolz ich für sie mit dem Erinnerungsbild von Santiago Nasar. »Dort stand er«, sagte sie zu mir. »Er trug den nur mit Wasser gewaschenen weißen Leinenanzug, denn seine Haut war so zart, dass er das laute Schaben der Stärke nicht ertrug.« Sie saß lange Zeit in der Hängematte, Kressekerne kauend, bis sich die Illusion, der Sohn sei zurückgekehrt, gelegt hatte. Dann seufzte sie: »Er war der Mann meines Lebens.«
Ich sah ihn in ihrer Erinnerung. In der letzten Januarwoche war er einundzwanzig Jahre alt geworden, er war schlank und hatte die arabischen Augenlider und das gelockte Haar seines Vaters. Er war der einzige Sohn einer Vernunftehe, die keinen Augenblick des Glücks gekannt hatte, doch schien er mit seinem Vater glücklich gewesen zu sein, bis dieser plötzlich, drei Jahre zuvor, gestorben war, und er schien auch mit der einsamen Mutter weiterhin glücklich zu sein, bis zum Montag seines Todes. Von ihr hatte er den Instinkt geerbt. Von seinem Vater lernte er schon als Kind den Umgang mit Feuerwaffen, die Liebe zu Pferden und das Abrichten von Greifvögeln, erlernte aber auch die schönen Künste der Tapferkeit und der Besonnenheit. Untereinander sprachen sie Arabisch, nicht jedoch vor Plácida Linero, damit diese sich nicht ausgeschlossen fühlte. Nie sah man die beiden bewaffnet im Dorf, und nur ein einziges Mal hatten sie ihre abgerichteten Falken dabei, um auf einem Wohltätigkeitsbazar die Beizjagd vorzuführen. Der Tod seines Vaters hatte Santiago Nasar gezwungen, seine Ausbildung mit der Oberschule zu beenden, um die Leitung der Familien-Hacienda zu übernehmen. Aus eigener Kraft war er heiter und friedlich und hatte ein unbeschwertes Herz.
An dem Tag, an dem sie ihn töten sollten, glaubte seine Mutter, als sie ihn im weißen Anzug sah, er habe sich im Datum geirrt. »Ich erinnerte ihn daran, dass es Montag war«, sagte sie zu mir. Doch er hatte ihr seinen feierlichen Aufzug damit erklärt, dass sich die Gelegenheit ergeben könnte, den Ring des Bischofs zu küssen. Sie zeigte keinerlei Interesse.
»Er wird nicht einmal von Bord gehen«, sagte sie zu ihm. »Wie üblich wird er pflichtgemäß seinen Segen austeilen und dahin zurückfahren, woher er gekommen ist. Er hasst dieses Dorf.«
Santiago Nasar wusste, dass dies zutraf, doch Kirchenpomp zog ihn unwiderstehlich an. »Das ist wie Kino«, hatte er einmal zu mir gesagt. Seine Mutter hingegen interessierte die Ankunft des Bischofs nur insoweit, als sie fürchtete, ihr Sohn könne in den Regen kommen, denn sie hatte ihn im Schlaf niesen hören. Sie riet ihm, einen Regenschirm mitzunehmen, doch er winkte nur zum Abschied und verließ das Zimmer. Das war das letzte Mal, dass sie ihn sah.
Victoria Guzmán, die Köchin, war sicher, dass es an jenem Tag nicht geregnet hatte, wie den ganzen Februar über nicht. »Im Gegenteil«, sagte sie, als ich sie kurz vor ihrem Tod aufsuchte, »es wurde früher am Tag heiß als im August.« Umringt von hechelnden Hunden zerlegte sie gerade drei Kaninchen für das Mittagessen, als Santiago Nasar die Küche betrat. »Er sah immer wie nach einer durchsumpften Nacht aus, wenn er aufstand«, erinnerte sich Victoria Guzmán lieblos. Divina Flor, ihre kaum erblühte Tochter, hatte Santiago Nasar, wie jeden Montag, eine große Tasse Hochlandkaffee mit einem Schuss Zuckerrohrschnaps gereicht, um den Kater der vergangenen Nacht zu ertränken. Die riesige Küche mit der zischelnden Glut und den auf ihren Stangen schlafenden Hühnern atmete verhalten. Santiago Nasar kaute ein zweites Aspirin und setzte sich, um gemächlich seine Tasse Kaffee zu schlürfen, dabei vor sich hin sinnierend, ohne den Blick von den beiden Frauen zu wenden, die am Herd die Kaninchen ausnahmen. Trotz ihres Alters war Victoria Guzmán gut beinander. Die noch ein wenig ungebärdige Kleine schien am Drang ihrer Drüsen zu ersticken. Santiago Nasar packte sie am Handgelenk, als sie ihm die leere Tasse abnehmen wollte.
»Du bist schon so weit, zugeritten zu werden«, sagte er.
Victoria Guzmán zeigte ihm das blutige Messer.
»Lass sie los, Weißer«, befahl sie entschieden. »Von diesem Wasser trinkst du nicht, solange ich lebe.«
Sie selbst war in der Blüte ihrer Jugend von Ibrahim Nasar verführt worden. Mehrere Jahre hindurch hatte er sie heimlich in den Ställen der Hacienda geliebt und sie dann als Dienstmädchen in sein Haus aufgenommen, als seine Zuneigung erloschen war. Divina Flor, Tochter eines Ehemanns aus jüngerer Zeit, wusste sich für Santiago Nasars heimliches Bett bestimmt, und dieser Gedanke versetzte sie vorzeitig in Unruhe. »Ein Mann wie dieser ist nie wieder auf die Welt gekommen«, sagte sie zu mir, fett und welk, umringt von den Kindern aus anderen Liebschaften. »Er war genau wie sein Vater«, erwiderte ihr Victoria Guzmán. »Ein Scheißkerl.« Und doch konnte sie sich eines Schauders des Grauens nicht erwehren, als sie sich daran erinnerte, wie entsetzt Santiago Nasar gewesen war, als sie einem Kaninchen die gesamten Innereien herausriss und die dampfenden Därme den Hunden vorwarf.
»Sei nicht so barbarisch«, sagte er. »Stell dir vor, das wäre ein Menschenwesen.«
Victoria Guzmán hatte fast zwanzig Jahre gebraucht, um zu begreifen, weshalb ein Mann, der gewohnt war, wehrlose Tiere zu töten, plötzlich solches Entsetzen empfinden konnte. »Heiliger Gott«, rief sie erschrocken aus, »das alles war also eine Offenbarung!« Doch am Morgen des Verbrechens hatte sich bei ihr so viel Wut angesammelt, dass sie die Hunde weiter mit den Eingeweiden der anderen Kaninchen fütterte, nur um Santiago Nasar sein Frühstück zu vergällen. Das war der Stand der Dinge, als das ganze Dorf vom markerschütternden Tuten des Dampfers erwachte, mit dem der Bischof ankam.
Das Haus war ein alter zweistöckiger Schuppen aus rohen Bretterwänden mit einem Satteldach aus Weißblech, von dem aus die Geier auf Hafenabfälle lauerten. Er war in den Zeiten erbaut worden, als der Fluss so dienstwillig war, dass viele Seebarkassen und selbst einige Hochseeschiffe sich durch die sumpfigen Gewässer der Mündung hier heraufwagten. Als Ibrahim Nasar mit den letzten Arabern gegen Ende der Bürgerkriege eintraf, liefen wegen der Veränderungen des Flusslaufs keine Seeschiffe mehr ein, und der Schuppen wurde nicht mehr genutzt. Ibrahim Nasar kaufte ihn zu einem Spottpreis, um einen Importladen aufzumachen, den er aber nie aufmachte, und erst als er ans Heiraten dachte, baute er den Schuppen zu einem Wohnhaus um. Aus dem Erdgeschoss machte er einen Wohnraum, der für alle möglichen Zwecke diente, und baute im hinteren Teil einen Pferdestall für vier Tiere ein, Dienstbotenkammern und eine große Küche mit Fenstern zum Hafen, durch die zu allen Stunden der Pestgeruch des Wassers drang. Unberührt ließ er im Wohnraum nur die aus irgendeinem Schiffbruch gerettete Wendeltreppe. Das Obergeschoss, in dem die Zollbüros gewesen waren, teilte er in zwei geräumige Schlafzimmer und fünf Kammern für die vielen Kinder auf, die er zu zeugen gedachte, und auf die Mandelbäume der Plaza hinaus baute er einen Holzbalkon, auf den Plácida Linero sich an Märznachmittagen setzte, um sich über ihre Einsamkeit hinwegzutrösten. Ibrahim Nasar behielt den Haupteingang an der Frontseite bei und setzte zwei bodentiefe Fenster mit gedrechselten Gitterstäben ein. Er beließ auch die Hintertür, machte sie nur etwas höher, um hindurchreiten zu können, und behielt einen Teil der alten Mole in Gebrauch. Dieser hintere Eingang wurde am häufigsten benutzt, nicht nur, weil er der natürliche Zugang zu den Stallungen und der Küche war, sondern weil er, ohne den Umweg über die Plaza, auf die Straße zum neuen Hafen führte. Die vordere Haustür blieb außer bei festlichen Anlässen geschlossen und verriegelt. Dennoch warteten dort und nicht vor der hinteren Tür die Männer, die Santiago Nasar töten sollten, und durch diese Tür ging er auch zum Empfang des Bischofs hinaus, obwohl er ganz ums Haus herum musste, um zum Hafen zu gelangen.
Niemand vermochte das Zusammentreffen so vieler verhängnisvoller Zufälle zu begreifen. Diese beunruhigten wohl auch den Untersuchungsrichter aus Riohacha, was er sich aber nicht einzugestehen wagte, denn sein Bestreben, eine rationale Erklärung dafür zu finden, ergab sich deutlich aus der Beweisaufnahme. Die Haustür wurde mehrmals mit einer melodramatischen Bezeichnung erwähnt: Die Schicksalstür. Die einzig gültige Erklärung schien tatsächlich von Plácida Linero zu kommen, die auf die Frage mit einer mütterlichen Begründung antwortete: »Mein Sohn ging nie durch die Hintertür raus, wenn er gut angezogen war.« Diese Erklärung schien so schlicht, dass der Untersuchungsrichter sie zwar in einer Randbemerkung festhielt, aber nicht in den abschließenden Bericht aufnahm.