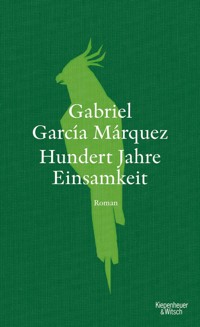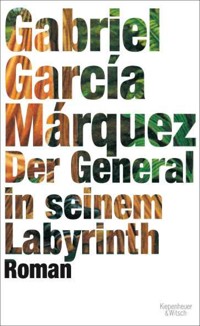7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt« – Ein bewegendes Porträt von Hoffnung und Widerstand in Zeiten der Unterdrückung In diesem meisterhaften Roman von Gabriel García Márquez, dem erfolgreichsten Erzähler Lateinamerikas, wird die Gewalt, ein Hauptthema dieses Kontinents, mit »Zorn und dessen Menschen mit Zärtlichkeit« behandelt. Der Held dieser 1956 spielenden Geschichte ist ein alter Oberst, der mit seiner Frau völlig verarmt in einem kolumbianischen Tropendorf lebt und seit fünfzig Jahren vergeblich auf seine Veteranenpension wartet. Unter der herrschenden Militärdiktatur ist der Ausnahmezustand zum Normalzustand geworden. Das Leben stagniert, doch die Bewohner warten und hoffen auf Veränderung und Befreiung – die meisten passiv, wenige aktiv. Zu den Aktiven gehören der Arzt, die Gesellen einer als Widerstandszelle getarnten Schneiderwerkstatt und schließlich auch der Oberst mit seinem Kampfhahn, einem Erbstück seines wegen Verteilung illegaler Flugblätter erschossenen Sohnes Agostin. Trotz bitterer Armut und ausbleibender Pensionszahlungen weigert sich der Oberst, den Hahn zu verkaufen. Als er sieht, wie sich der Hahn in der Arena behauptet, umjubelt von der Dorfjugend, erkennt der Oberst in ihm ein Symbol der Hoffnung – für sich selbst und die gesamte Dorfgemeinschaft. »Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt« ist ein eindringliches Porträt von Würde und Widerstandsgeist angesichts von Unterdrückung und Ausweglosigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gabriel García Márquez
Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gabriel García Márquez
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez, geboren 1927 in Aracataca, Kolumbien, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist. 1982 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Gabriel García Márquez hat ein umfangreiches erzählerisches und journalistisches Werk vorgelegt. Er gilt als einer der bedeutendsten und erfolgreichen Schriftsteller der Welt. García Márquez starb am 17. April 2014 im Alter von 87 Jahren in Mexiko-Stadt.
Der Übersetzer
Curt Meyer-Clason, geboren 1910 in Ludwigsburg, übersetzte herausragende lateinamerikanische Autoren wie Jorge Luis Borges, Pablo Neruda und Gabriel García Márquez. Sein Werk sowieso sein Engagement für die Vermittlung der lateinamerikanischen Literatur wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Curt Meyer-Clason starb 2012 in München.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
56 Jahre lang wartet der Oberst auf einen Brief, in dem die Regierung ihm seine Veteranenpension bestätigt. Doch der Brief kommt nicht. In einer Sprache »so klar, so knapp und knochendürr wie die Gestalt seines Helden«, erzählt Gabriel García Márquez die Geschichte des Oberst, der mit seiner Frau in tiefer Armut lebt und dessen einziger Besitz ein Kampfhahn ist. Doch nicht einmal der Hunger bringt den Oberst dazu, den Hahn zu verkaufen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: El coronel no tiene quien le escriba
Copyright © 1961 by Gabriel García Márquez
All rights reserved
Aus dem Spanischen übersetzt und mit einem Nachwort von Curt Meyer-Clason
© 1976, 1983, 1998, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2014, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Rudolf Linn, Köln
ISBN978-3-462-30866-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nachwort
Der Oberst hob den Deckel der Kaffeebüchse und stellte fest, daß nur noch ein Löffel voll übrig war. Er nahm den Topf vom Herd, goß die Hälfte des Wassers auf den Lehmfußboden und kratzte über dem Topf mit einem Messer die Büchse aus, bis sich mit dem letzten Kaffeepulver der Blechrost löste.
Während der Oberst, am Herd aus gebranntem Ton sitzend, in unschuldiger Zuversicht das Aufkochen des Getränks erwartete, hatte er das Gefühl, giftige Pilze und Schwertlilien wüchsen in seinen Gedärmen. Es war Oktober. Der Morgen versprach schwierig zu werden, selbst für einen Mann seines Schlages, der viele Morgen wie diesen überlebt hatte. Sechsundfünfzig Jahre lang – seit dem Ende des letzten Bürgerkrieges – hatte der Oberst nichts getan als gewartet. Der Oktober war eines der wenigen Dinge, die eintrafen.
Seine Frau hob das Moskitonetz, als sie ihn mit dem Kaffee ins Schlafzimmer treten sah. In der vergangenen Nacht hatte sie einen Asthmaanfall erlitten und war wie betäubt. Aber sie richtete sich auf, um die Tasse entgegenzunehmen.
»Und du?« fragte sie.
»Habe schon getrunken«, log der Oberst. »Es war noch ein gehäufter Löffel übrig.«
In diesem Augenblick begann das Totenläuten. Der Oberst hatte die Beerdigung vergessen. Während seine Frau ihren Kaffee trank, hängte er die Hängematte an der einen Wand aus und rollte sie an der anderen hinter der Tür auf. Die Frau dachte an den Toten.
»1922 geboren«, sagte sie. »Genau einen Monat nach unserem Sohn. Am siebten April.«
Sie schlürfte den Kaffee zwischen rauhen Atemzügen. Ihr Körper bestand nur aus weißem Knorpel auf einem gebeugten und unbeugsamen Rücken. Ihre Atembeschwerden zwangen sie, bejahend zu fragen. Als sie ihren Kaffee ausgetrunken hatte, dachte sie weiter an den Toten.
»Es muß schrecklich sein, im Oktober begraben zu werden«, sagte sie. Doch ihr Mann schenkte ihr keine Beachtung. Er öffnete das Fenster. Der Oktober war in den Innenhof eingezogen. Als der Oberst das üppig wachsende Grün betrachtete und die winzigen Löcher der Würmer im Lehm, spürte er wieder den unheilvollen Monat in den Gedärmen.
»Ich habe feuchte Knochen«, sagte er.
»Das ist der Winter«, erwiderte die Frau. »Seit es regnet, sage ich dir, du sollst mit Strümpfen schlafen.«
»Seit einer Woche schlafe ich mit Strümpfen.«
Es regnete sanft und pausenlos. Der Oberst hätte sich am liebsten in eine Wolldecke gewickelt und wieder in die Hängematte gelegt. Doch die Beharrlichkeit der zersprungenen Bronzeglocken mahnten ihn an die Beerdigung. »Es ist Oktober«, murmelte er und trat in die Mitte des Zimmers. Erst jetzt fiel ihm der am Fußende des Bettes festgebundene Hahn ein. Es war ein Kampfhahn.
Nachdem er die Tasse in die Küche getragen hatte, zog er im Wohnzimmer die mit einem geschnitzten Holzrahmen eingefaßte Pendeluhr auf. Im Gegensatz zum Schlafzimmer, das viel zu eng war für die Atmung einer Asthmatikerin, war das Wohnzimmer geräumig mit seinen vier Korbschaukelstühlen um ein Tischchen, darauf eine Tischdecke und eine Gipskatze. An der der Uhr gegenüberliegenden Wand das Bild einer tüllumflorten Dame zwischen Amoretten in einem rosenbefrachteten Boot.
Es war zehn vor halb acht, als er die Uhr aufgezogen hatte. Dann trug er den Hahn in die Küche, band ihn an einen Fuß des Herdes, goß frisches Wasser in den Napf und schüttete eine Handvoll Mais daneben. Eine Horde Jungen drang durch den brüchigen Zaun. Sie setzten sich rings um den Hahn und betrachteten ihn schweigend.
»Seht das Tier nicht so an«, sagte der Oberst. »Hähne nutzen sich ab, wenn man viel hinsieht.«
Die Jungen rührten sich nicht von der Stelle. Einer von ihnen spielte auf seiner Mundharmonika die ersten Akkorde eines Schlagers. »Spiel heute nicht«, sagte der Oberst. »Im Dorf liegt ein Toter.« Der Junge steckte sein Instrument in die Hosentasche, und der Oberst ging ins Schlafzimmer, um sich für die Beerdigung umzuziehen.
Die weiße Wäsche war wegen des Asthmas seiner Frau nicht gebügelt. Folglich mußte der Oberst sich zu dem alten schwarzen Tuchanzug entschließen, den er seit seiner Hochzeit nur noch bei besonderen Gelegenheiten trug. Es kostete Mühe, ihn in der Tiefe der Truhe zu finden, in Zeitungen gewickelt und gegen Motten durch Naphthalinkugeln geschützt. Auf ihrem Bett ausgestreckt dachte die Frau noch immer an den Toten.
»Er wird Agustín bereits getroffen haben«, sagte sie. »Vielleicht erzählt er ihm gar nicht, wie schlecht es uns seit seinem Tod geht.«
»Mittlerweile werden sie sich über Hähne unterhalten«, sagte der Oberst.
In der Truhe fand er einen altmodischen riesigen Regenschirm. Die Frau hatte ihn bei einer politischen Tombola gewonnen, deren Erlös der Partei des Obersten zugute kommen sollte. Am selben Abend hatten sie einer Freilichtaufführung beigewohnt, die trotz des Regens nicht abgebrochen worden war. Der Oberst, seine Frau und ihr damals achtjähriger Sohn Agustín waren bis zum Schluß unter ihrem Schirm sitzen geblieben. Jetzt war Agustín tot, und die glänzende Schirmseide war von den Motten zerfressen.
»Sieh, was aus unserem Zirkusclown-Schirm geworden ist«, sagte der Oberst, einen seiner Lieblingssätze benutzend, und spannte über seinem Kopf ein geheimnisvolles Gerüst aus Metallstäben auf. »Jetzt kann man damit nur noch die Sterne zählen.«
Er lächelte. Aber die Frau nahm sich nicht die Mühe, nach dem Schirm zu blicken. »So ist es mit allem«, murmelte sie. »Wir faulen bei lebendigem Leib.« Und sie schloß die Augen, um noch inniger an den Toten zu denken.
Als er sich nach dem Tastsinn rasiert hatte – denn seit langem fehlte ihm ein Spiegel –, zog der Oberst sich schweigend an. Sein Beinkleid, an den Waden fast so eng anliegend wie die langen Unterhosen und an den Knöcheln mit Gummibändern befestigt, wurde in der Taille von zwei Laschen desselben Stoffs festgehalten, die in Nierenhöhe durch vergoldete Schnallen liefen. Einen Gürtel trug er nicht. Das Hemd, von der Farbe alter Pappe und hart wie Pappe, verschloß oben ein Kupferknopf, der zugleich den Einsatzkragen hielt. Doch der Einsatzkragen war so fadenscheinig, daß der Oberst auf die Krawatte verzichtete.
Er tat alles so, als ginge es um Grundsätzliches. Die Knochen seiner Hände bedeckte eine durchsichtige, gespannte Haut, die wie die Haut am Hals von einer Hautkrankheit gefleckt war. Bevor er seine Lackstiefel anzog, kratzte er den verkrusteten Schmutz aus den Nähten. In diesem Augenblick sah seine Frau ihn gekleidet wie am Tag ihrer Hochzeit. Erst jetzt bemerkte sie, wie alt ihr Mann geworden war.
»Du siehst aus, als sei heute ein Ereignis«, sagte sie.
»Diese Beerdigung ist ein Ereignis«, sagte der Oberst. »Es ist der erste Tote seit Jahren, der eines natürlichen Todes gestorben ist.«
Nach neun hörte der Regen auf. Der Oberst wandte sich zum Gehen, als seine Frau ihn am Rockärmel festhielt.
»Kämm dich«, sagte sie.
Er versuchte mit einem Hornkamm die stahlgrauen Borsten zu bändigen. Doch vergebens.
»Ich sehe bestimmt aus wie ein Papagei«, sagte er.
Die Frau musterte ihn. Sie fand nein. Der Oberst sah nicht wie ein Papagei aus. Er war ein dürres, festverschraubtes und -verlötetes Knochengestell. Dank seiner lebhaften Augen nur wirkte er nicht wie in Formol konserviert.
»So siehst du gut aus«, räumte sie ein und fügte hinzu, während ihr Mann das Zimmer verließ:
»Frag den Doktor, ob wir ihm etwas getan haben.«
Sie wohnten am Rande des Dorfs in einem Haus mit Palmdach und abblätternden Kalkmauern. Die Feuchtigkeit hielt an, aber es regnete nicht mehr. Der Oberst ging durch eine Gasse mit dichtstehenden Häusern zum Platz hinunter. Als er in die Hauptstraße einbog, befiel ihn ein Zittern. So weit sein Blick reichte, war das Dorf mit Blumen bestreut. Vor ihren Haustüren saßen schwarzgekleidete Frauen und warteten auf den Leichenzug.
Auf dem Platz begann es von neuem zu nieseln. Der Besitzer des Billardsalons sah den Oberst von der Tür seines Etablissements aus und rief mit weitgeöffneten Armen:
»Warten Sie, Oberst, ich leihe Ihnen einen Regenschirm.«
Der Oberst antwortete, ohne den Kopf zu wenden: »Danke, es geht auch so.«
Der Leichenzug hatte sich noch nicht in Bewegung gesetzt. Die Männer mit weißen Anzügen und schwarzen Krawatten unterhielten sich an der Tür unter ihren Regenschirmen. Einer von ihnen sah den Oberst über die Pfützen des Platzes springen.
»Kommen Sie zu uns, Gevatter«, rief er.
Und machte Platz unter dem Schirm.
»Danke, Gevatter«, sagte der Oberst.
Aber er nahm die Einladung nicht an. Er trat unmittelbar ins Haus, um der Mutter des Toten sein Beileid auszusprechen. Das erste, was er wahrnahm, war mannigfaltiger Blumenduft. Dann setzte die Hitze ein. Der Oberst versuchte, sich durch die den Alkoven belagernde Menschenmenge zu drängen. Doch jemand legte ihm die Hand auf den Rücken und schob ihn durch eine Galerie verblüffter Gesichter in das Zimmer hinein zu der Stelle, wo die tiefen, weitgeöffneten Nasenlöcher des Toten waren.
Dort stand die Mutter und scheuchte mit einem geflochtenen Palmfächer die Fliegen vom Sarg. Andere schwarzgekleidete Frauen betrachteten den Leichnam mit dem Gesichtsausdruck, mit dem man in die Strömung eines Flusses blickt. Plötzlich ließ sich eine Stimme im Hintergrund vernehmen. Der Oberst schob eine Frau beiseite, hatte das Profil der Mutter des Toten vor sich und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Er biß die Zähne aufeinander.