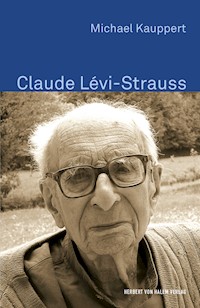
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Klassiker der Wissenssoziologie
- Sprache: Deutsch
Claude Lévi-Strauss (*28.11.1908 Brüssel, † 30.10.2009 Paris) war französischer Ethnologe und Begründer der strukturalen Anthropologie. Seine Arbeiten zu Verwandtschaftsstrukturen, Klassifikationssystemen und Mythen schriftloser Völker haben die Soziologie maßgeblich beeinflusst. Als Ethnologe war er zunächst ein Spätberufener und stand institutionell eher am Rande des französischen Hochschulsystems, bis ihn seine Arbeiten zur strukturalen Anthropologie weltberühmt machten und alle akademischen Weihen einbrachten. Durch seine Neubewertung des Inzesttabus als elementares Vehikel sozialer Allianzbildung wurde Lévi-Strauss zum Begründer des sozialwissenschaftlichen Strukturalismus. Seine Analysen einheimischer Klassifikationssysteme entlarvten den vermeintlichen Abstammungsglauben primitiver Völker vom Tier- und Pflanzenreich als fixe Idee europäischer Forscher. Durch seine Rehabilitierung des mythischen Denkens trug er wesentlich zur Selbstrelativierung neuzeitlich-wissenschaftlicher Vorstellungen bei. Mit dieser Einführung erschließt Michael Kauppert Studierenden die biografischen und institutionellen Quellen der strukturalen Anthropologie und zeigt deren innere Gesamtarchitektur auf. Er skizziert außerdem einen Weg, wie sich die strukturale Analyse von Lévi-Strauss heute noch mit einer Soziologie lebensweltlichen Wissens verbinden lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klassiker der WissenssoziologieHerausgegeben von Bernt Schnettler
Die Bände dieser Reihe wollen in das Werk von Wissenschaftlern einführen, die für die Wissenssoziologie – in einem breit verstandenen Sinne – von besonderer Relevanz sind. Dabei handelt es sich vornehmlich um Autoren, zu denen bislang keine oder kaum einführende Literatur vorliegt oder in denen die wissenssoziologische Bedeutung ihres Werkes keine angemessene Würdigung erfahren hat. Sie stellen keinesfalls einen Ersatz für die Lektüre der Originaltexte dar. Sie dienen aber dazu, die Rezeption und das Verständnis des Œuvres dieser Autoren zu erleichtern, indem sie dieses durch die notwendigen biografie- und werkgeschichtlichen Rahmungen kontextualisieren. Die Bücher der Reihe richten sich vornehmlich an eine Leserschaft, die sich zum ersten Mal mit dem Studium dieser Werke befassen will.
»Thomas Luckmann« von Bernt Schnettler
»Marcel Mauss« von Stephan Moebius
»Alfred Schütz« von Martin Endreß
»Anselm Strauss« von Jörg Strübing
»Robert E. Park« von Gabriela Christmann
»Erving Goffman« von Jürgen Raab
»Michel Foucault« von Reiner Keller
»Karl Mannheim« von Amalia Barboza
»Harold Garfinkel« von Dirk vom Lehn
»Émile Durkheim« von Daniel Šuber
»Claude Lévi-Strauss« von Michael Kauppert
»Arnold Gehlen« von Heike Delitz
»Maurice Halbwachs« von Dietmar J. Wetzel
»Peter L. Berger« von Michaela Pfadenhauer
Weitere Informationen zur Reihe unter www.uvk.de/kw
Meiner Katze
Inhalt
Einleitung
I Zu den Quellen einer strukturalen Anthropologie
»Eine meiner beherrschendsten Interessen«
»Mir schien es dringlich, Klarheit zu schaffen«
»Ich habe wahrhaft gearbeitet«
»Extrem schwierige Bücher«
II Zur Systematik der strukturalen Anthropologie
Natur und Kultur
Primitive und Zivilisierte
Struktur und Sinn
Leitmotive
III Zur Soziologie symbolischer Ordnungen
Literatur
Zeittafel
Personenindex
Sachindex
Einleitung
Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt.
Rumänisches Sprichwort
Als sich Claude Lévi-Strauss im Oktober 1984 aufgrund einer Vortragsreihe in Kalifornien aufhält, geht er eines Abends zusammen mit seiner Frau Monique in ein Restaurant. Da sie keine Plätze reserviert haben, müssen sie zunächst auf einen freien Tisch warten. Ein Kellner erkundigt sich nach ihren Namen, um ihnen einen Platz zuweisen zu können, sobald einer frei werden sollte. Als der Kellner den Namen hört, fragt er: »The pants or the books?« Diese Namensgleichheit mit dem berühmten Jeanshersteller verfolgt Lévi-Strauss zeit seines Lebens »wie ein Phantom« (1989: 49). Nicht jeder scheint allerdings auf dem Kenntnisstand des amerikanischen Kellners zu sein, weiß also nicht, dass es neben der amerikanischen Jeansmarke auch noch einen französischen Ethnologen gleichen Namens gibt: »Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass ich nicht, im allgemeinen aus Afrika, eine Jeans-Bestellung erhalte« (Lévi-Strauss 1989: 50). Selbst an seinem Pariser Wohnort assoziieren viele Menschen den Namen Lévi-Strauss eher mit einer Modemarke als mit einem herausragenden Ethnologen: »Wenn meine Frau in Paris in irgendeinem Geschäft eine Bestellung aufgibt und man bei einem so bekannten Namen stutzt, dann immer wegen der Beinkleider, niemals wegen der Bücher« (Lévi-Strauss 1989: 50).
Vielleicht lässt sich die Spannung zwischen Wissenschaft und Lebenswelt insofern auflösen, dass sowohl der Erfinder des Beinkleids für amerikanische Goldwäscher als auch der ingeniöse Erforscher amerikanischer Mythen auf je eigene Weise zu Kulturheroen geworden sind. Der Erste ist es für die materielle Alltagskultur, der Zweite für die immaterielle Kultur von Wissenschaft und Literatur. »Es gibt […] wohl kaum einen Zweifel, dass das anthropologische 20. Jahrhundert als das Jahrhundert von Lévi-Strauss in Erinnerung bleiben wird – so sehr hat sein Denken, selbst wenn man es ablehnt, die Vorstellung, die man sich von dieser Wissenschaft, ihrem Gebiet und ihren Methoden machen kann, geprägt« (Descola 2008a: 227). Erst kürzlich ist eine Ausgabe seiner Werke in der in Frankreich renommierten Bibliothèque de la Pléiade erschienen. Es ist dies eine Reihe, in der ansonsten nur die (vorwiegend) französischen Klassiker der Literatur vertreten sind. Der Klassikerstatus ist Lévi-Strauss also gleich in mehrfacher Weise nicht mehr zu nehmen: Er ist ein Klassiker für ein Namensmissverständnis, einer für französische Literatur und ganz sicher auch einer der Ethnologie. Die Frage, die hier allerdings interessiert, ist eine andere: Ist Lévi-Strauss auch ein Klassiker der Wissenssoziologie?
Auf diese Frage gibt es zwei verschiedene Antworten. Sie hängen davon ab, ob man die Zugehörigkeit von Lévi-Strauss zu diesem Feld davon abhängig macht, in ihm den Vertreter einer Grundüberzeugung zu sehen, die für die Wissenssoziologie seit ihren Anfängen verbindlich geworden ist: Dass nämlich Wissen, gleich welcher Art, einen sozialen Ursprung hat. Wenn dies die Voraussetzung dafür ist, um als ein Klassiker der Wissenssoziologie zu gelten, lautet die Antwort: Nein, Lévi-Strauss ist kein Wissenssoziologe und kann demzufolge auch keiner ihrer Klassiker sein. Ganz im Gegenteil. Er hat zu der von Durkheim und Mauss vertretenen und bis heute maßgeblichen Auffassung der Wissenssoziologie eine Anti-These vertreten: »Sociology cannot explain the genesis of symbolic thought, but has just to take it for granted in man« (Lévi-Strauss 1945: 518). Wenn man, wie hier geschehen, dennoch Lévi-Strauss in den Reigen der Klassiker der Wissenssoziologie aufnimmt, dann geht das nur, wenn man bereit ist, das Fundierungsverhältnis von Wissenssoziologie und Klassikerstatus herumzudrehen. Nicht also weil ein Autor unzweideutig Wissenssoziologe wäre, ist demnach das Kriterium für seinen Klassikerstatus, sondern umgekehrt: weil er ein klassischer Denker ist, wird er für die Wissenssoziologie relevant. Insofern kommt es im Weiteren darauf an, Lévi-Strauss als einen Klassiker ernst zu nehmen. In der Soziologie gelten Theoretiker als Klassiker, wenn sie für die Gegenwart durch die Fragen, die sie aufgeworfen haben, immer noch aktuell sind: »Klassisch ist eine Theorie, wenn sie einen Aussagezusammenhang herstellt, der in dieser Form später nicht mehr möglich ist, aber als Desiderat oder als Problem fortlebt« (Luhmann 1977: 19). Doch welches Problem hat nun Lévi-Strauss aufgeworfen, das ihn für die Wissenssoziologie der Gegenwart noch relevant macht? Es ist dies eine Anthropologie des Wissens, die, obzwar sie ihre Erkenntnisse an kulturellen Erscheinungen im 20. Jahrhundert gewonnen hat, nichtsdestotrotz für sich in Anspruch nimmt, daran ein, vielleicht sogar das Charakteristikum des menschlichen Geistes studiert zu haben: dessen symbolische Tätigkeit. Lévi-Strauss zufolge vollzieht sie sich diesseits des bewussten Denkens, aber auch jenseits der Gesellschaft. Er hält damit Philosophie und Soziologie gleichermaßen auf Abstand: Indem er einerseits die symbolische Tätigkeit als eine unbewusste Tätigkeit des menschlichen Geistes konzipiert, entzieht er deren Untersuchung der für die Spielarten des menschlichen Zeichengebrauchs traditionell zuständigen Bewusstseins- und Sprachphilosophie. Indem er aber andererseits die Forderung Durkheims bestreitet, derzufolge man »den Symbolismus als vollständig und allein den soziologischen Disziplinen zugehörig [betrachte]« (Lévi-Strauss 1973b: 683), setzt sich Lévi-Strauss auch in Distanz zur traditionellen Wissenssoziologie. Gegen beide Zugriffe auf den Symbolismus setzt Lévi-Strauss eine anthropologische These: Die symbolische Tätigkeit des menschlichen Geistes gehört für ihn zur conditio humana. Allerdings ist der Mensch für Lévi-Strauss nicht deswegen ein animal symbolicum (Cassirer), weil er von Natur aus ein Symbole erfindendes und gebrauchendes Wesen wäre. Die symbolische Tätigkeit des Menschen geht nicht darin auf, besondere, nur ihm eigene symbolische Welten und Typen symbolischer Gestaltungsweisen (Sprache, Mythos, Wissenschaft, aber auch Religion, Kunst etc.) zu erfinden, die von Haus aus dazu geeignet sind, sich durch Sinngebungsprozesse von der natürlichen Welt zu unterscheiden. Im Gegenteil, »Natur« ist, bei Lévi-Strauss sowohl das unverzichtbare Material für die symbolische Tätigkeit, als auch der Inbegriff für deren Verankerung in der organisch-stofflichen Welt. Die symbolische Tätigkeit bringt den Menschen also nicht, wie dieser Begriff aufgrund einer langen Tradition nahe legt, weg von der Natur, sondern umgekehrt: zu ihr hin. Und dieser, durchaus rousseauistische Weg führt bei Lévi-Strauss nicht über den Sinn, sondern die Struktur.
Einer Soziologie des Wissens wird Lévi-Strauss dadurch zum Klassiker ihres schlechten Gewissens gegenüber anthropologischen Thesen, die sie in den vergangenen Dekaden weitgehend ignoriert hat. Indem sie vor allem kulturalistisch argumentierte und Sprache, Macht sowie Diskurse in den Mittelpunkt gestellt hat, ist sie im Reigen der Wissenschaften vom Menschen in den letzten Jahren ins Hintertreffen geraten. Es ist daher an der Zeit, sich darauf zu besinnen, dass eine Soziologie des Wissens nicht darin aufgeht zu fragen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Mitteln man etwas über den Menschen vorgeblich weiß. Zu einer anthropologisch informierten Wissenssoziologie gehört auch zu wissen, wie dieser selbst weiß: als ein homo symbolicus.
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil ist historischer Art. Unter der Überschrift »Quellen einer strukturalen Anthropologie« werden biografische, werkgeschichtliche und institutionelle Bedingungen und Gründe für die Entwicklung eines ethnologischen Programms genannt, das Lévi-Strauss zu dem Vater des sozial- und humanwissenschaftlichen Strukturalismus haben werden lassen. Der zweite Teil verfährt systematisch. Hier wird zunächst versucht, die theoretische und praktische Anthropologie anhand der für sie konstitutiven Unterscheidungen zu rekonstruieren. Unter dem Stichwort »Struktur und Sinn« schließt sich daran eine Diskussion methodologischer Aspekte an, ehe verdeutlicht werden soll, inwiefern die Kunst, namentlich die Musik (Leitmotive) für die strukturale Analyse von Lévi-Strauss bedeutsam sind. Der dritte Teil greift schließlich die eingangs gestellte Frage nach einer Soziologie symbolischer Ordnungen wieder auf. Im zweiten Teil des Buches greife ich zum Teil auf Überlegungen zurück, die an anderer Stelle (Kauppert 2008a, 2008b) bereits publiziert worden sind. Erst hier ist jedoch der Kontext gegeben, der ihre Partikularität aufzeigen kann.
I Zu den Quellen einer strukturalen Anthropologie
Jeder von uns ist eine Art Straßenkreuzung, auf der sich Verschiedenes ereignet.
Mythos und Bedeutung, 1980, S. 15
Im ersten Teil des Buches geht es um die Erschließung der Quellen einer strukturalen Anthropologie. Sie bestehen insbesondere aus der Biografie von Lévi-Strauss, aber auch aus zeitgeschichtlichen Hintergründen und institutionellen Kontexten. In diese Entstehungsgeschichte fließt zudem eine Werkgeschichte mit ein, in der die Frage behandelt wird, inwiefern es sich dabei um eine Anthropologie handelt, und was an ihr »struktural« ist.
»Eine meiner beherrschendsten Interessen«
Claude Lévi-Strauss wurde am 28. November 1908 in Brüssel geboren. Vater und Mutter sind Vetter bzw. Cousine zweiten Grades. Vierzig Jahre später, in seinen Elementaren Strukturen der Verwandtschaft (vgl. Teil II, 1. Kapitel), wird Lévi-Strauss die These formulieren, dass die Heirat zwischen Vetter und Cousine ersten Grades in schriftlosen Gesellschaften die Keimzelle der Interaktion zwischen sozialen Gruppen darstellt. Von Cousins ersten Grades unterscheiden sich jene, die durch zweiten Grad miteinander verwandt sind, durch eine Generation: Während Erstere gemeinsame Großeltern haben, müssen Vetter bzw. Cousinen zweiten Grades schon drei Generationen zurückgehen, d.h. zu ihren Urgroßeltern, um auf gemeinsame Ahnen zu stoßen. Im Falle von Lévi-Strauss liegen die familiären Wurzeln im Elsass. Sie sind jüdischen Ursprungs und reichen bis ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts zurück (vgl. Bertholet 2003: 13). Auf der väterlichen Seite sticht hier insbesondere Isaac Strauss hervor. Der Urgroßvater von Claude Lévi-Strauss, den dieser selbst nie kennengelernt hat, verlässt Straßburg im Jahr 1826, um in Paris als Musiker eine bemerkenswerte Karriere zu machen. Er arbeitet dort mit bekannten Komponisten wie Hector Berlioz (1803–1869) und Jacques Offenbach (1819–1880) zusammen. Drei Generationen später schildert Claude Lévi-Strauss die Auswirkungen dieser Kontakte so: »Offenbachs Musik kannte man in meiner Familie auswendig; sie hat meine ganze Kindheit durchtönt« (Lévi-Strauss 1989: 12). Während der Regentschaft von Napoleon III. (1808–1873), der sich 1852 zum zweiten Kaiser der Franzosen ausruft, war Isaac Strauss Direktor des Kurorchesters in Vichy und Dirigent der kaiserlichen Opernbälle. Diese durch den Urgroßvater vermittelte Nähe zum Hof bleibt lange Zeit das Glanzlicht in der Familiengeschichte: »Die Familie meines Vaters lebte im Gedenken an das Zweite Kaiserreich« (a.a.O.: 13). Die nostalgische Rückwendung ins 19. Jahrhundert hat einerseits handfeste Gründe. Nach dem Tod von Isaac Strauss ist die materielle Sicherheit der Familie aufgebraucht: Gustav Lévi, der die Tochter von Isaac Strauss – Léa – heiratete, stirbt wirtschaftlich ruiniert. Andererseits wird Lévi-Strauss später von sich sagen, das 19. Jahrhundert sei »ein Jahrhundert, in dem ich mir, wie mein Gefühl mir sagt, wohl nicht sonderlich heimatlos vorkäme, wenn eine Fee mich mit einem Schlag ihres Zauberstabes dorthin versetzte, ohne dass ich mein Bewusstsein als Mensch des 20. Jahrhunderts verlöre« (a.a.O.: 262f.). Diese affirmative Grundstimmung der Vergangenheit gegenüber ist es auch, die Lévi-Strauss im Alter von zehn Jahren zu einem leidenschaftlichen Leser von Cervantes’ Don Quichotte werden lässt. Die Figur zeigt ihm nicht nur »ein quälendes Verlangen, hinter der Gegenwart der Vergangenheit wieder zu begegnen« (a.a.O.: 140), er identifiziert sich auch vollkommen mit ihr: »Wenn sich eines Tages zufällig ein Sonderling um ein besseres Verständnis meiner Person bemühen sollte, biete ich ihm diesen Schlüssel hier« (ebd.). Auch wenn man sich diesem Interpretationsangebot gegenüber vorsichtig verhalten sollte, so scheint in der späteren Berufswahl von Lévi-Strauss doch etwas von diesem rückwärts gewandten Sehnsuchtsmotiv aus seinen Kindheitstagen hindurch: »Nicht nur für mich bildete der Beruf des Ethnologen wahrscheinlich eine Zuflucht vor einer Zivilisation, vor einem Jahrhundert, in dem man sich unbehaglich fühlt« (a.a.O.: 103).
Aus der Ehe von Gustav Lévi und Léa Strauss gehen eine Tochter und vier Söhne hervor. Einer davon ist Raymond Lévi-Strauss, der Vater von Claude. Erst jener trägt also den Doppelnamen, der später bei seinem Sohn noch für so viele Verwechslungen sorgen sollte. Nach dem Tod von Gustav Lévi lässt es die wirtschaftliche Situation der Familie nicht ohne Weiteres zu, den künstlerischen Weg weiterzugehen, den Isaac Strauss eingeschlagen hatte. Raymond Lévi-Strauss studiert daher zunächst an einer wirtschaftswissenschaftlichen Hochschule und beginnt danach, an der Börse zu arbeiten. Doch das sollte nicht lange so bleiben. »Sobald er konnte, hat er sich der Malerei verschrieben, für die er sich seit der Kindheit leidenschaftlich begeisterte« (a.a.O.: 13).
Was nun die Familie von Emma Lévy, der Mutter von Claude Lévi-Strauss, angeht, so war auch diese vom Ende des zweiten Kaiserreiches betroffen. Infolge des Krieges, den Frankreich gegen Preußen und dessen Verbündete verlor, musste das Elsass an das neu gegründete deutsche Reich abgetreten werden. Eine Situation, die für die alteingesessene Familie unerträglich war: »Um französisch zu bleiben« (Lévi-Strauss in Bertholet 2003: 9), zieht man im Jahr 1871 aus dem Elsass weg. Der Vater von Emma ist ein frommer Rabbiner, ihre Mutter steht der Religion aber eher fern. »Was seine Frau betraf, so bezweifeln selbst ihre Töchter, dass sie gläubig war« (Lévi-Strauss 1989: 19). Drei der fünf Töchter, die aus dieser Ehe hervorgingen, heiraten einen Maler. Eine dieser Töchter ist Emma. Und einer dieser Maler heißt Raymond Lévi-Strauss. Später ist sich Claude Lévi-Strauss nicht mehr sicher, was die beiden zusammengeführt hatte: »Haben meine Eltern sich aufgrund der familiären Bindungen oder wegen der Beziehungen zwischen Malern kennengelernt? Ich weiß es nicht mehr« (a.a.O.: 14). Im Laufe des Jahres 1908 bekommt Raymond Lévi-Strauss von Freunden Auftragsarbeiten in Belgien vermittelt, zu denen er seine Frau mitnimmt. Und so wird der aus einer sehr patriotischen Familie (Bertholet 2003: 15) stammende Claude Lévi-Strauss ausgerechnet außerhalb Frankreichs geboren. Allerdings kehrt die Familie bereits zwei Monate nach seiner Geburt wieder nach Paris zurück.
Die Kindheit von Lévi-Strauss ist durch zwei gegenläufige Tendenzen geprägt. Einerseits verfügt die Familie über ein hohes kulturelles Kapital: Sie lebt in einem Kreis von Künstlern. Andererseits hat sie mit materiellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Denn obwohl Raymond Lévi-Strauss von 1905–1921 (Bertholet 2003: 9) regelmäßig in Pariser Galerien ausstellt, kann er in seinem zweiten Beruf als Maler nicht viel Geld verdienen. Insbesondere der Aufstieg der Kubisten im Publikumsgeschmack nach dem Ersten Weltkrieg erschwert dem Vater, der »den Traditionen des 18. und 19. Jahrhunderts treu ergeben war« (Lévi-Strauss 1989: 249), das materielle Auskommen. »Ich erinnere mich der Ängste, die zu bestimmten Zeiten wach wurden, wenn es keine Aufträge mehr gab. Mein Vater, der ein großer Bastler war, erfand also alle möglichen Arten von Nebenerwerbstätigkeiten« (a.a.O.: 14). Lévi-Strauss ist an allen diesen Tätigkeiten nicht nur aktiv beteiligt, sie können auch als eine Quelle für seine Wertschätzung der bricolage angesehen werden, mit der er im Wilden Denken (vgl. Teil II, 2. Kapitel) jene Eigenart der intellektuellen Tätigkeit beschrieben hat, durch die die Moderne mit der mythischen Welt in Kontakt bleibt. »Eine Zeitlang konzentrierte man sich im Hause auf Stoffdrucke. Man schnitt Linoleum-Tafeln, bestrich die erhabenen Stellen mit einem Leim und presste die so behandelten Formen dann auf Samtstoffe, damit verschiedenfarbige Metallstäubchen, die man darüber streute, daran haften bleiben können« (ebd.). »Dann gab es eine andere Zeit, in der mein Vater kleine Tischchen mit Lackimitation im chinesischen Stil verfertigte. Er hat auch Lampen mit billigen, auf Glasscheiben geklebten japanischen Drucken hergestellt. Alles war recht, wenn es nur die Monatsenden überstehen half« (ebd.). Unter dem Druck der Verhältnisse schwindet auch seine jugendliche Begeisterung für avantgardistische Kunst (vgl. Lévi-Strauss 1989: 249ff.); der spätere Lévi-Strauss wird sich stets reserviert gegenüber der zeitgenössischen Kunst zeigen, sei es nun die Malerei (Lévi-Strauss 1985a: 361ff;), die Musik (Lévi-Strauss 1971: 41ff.) oder die Literatur (Lévi-Strauss 1989: 240ff.).
Als er etwa zwei Jahre alt ist, ist er fest davon überzeugt, dass er bereits lesen kann. Danach gefragt, woher er das wisse, antwortet er, dass sich ihm beim Betrachten der Ladenschilder wie boulanger (Bäcker) oder boucher (Metzger) der Eindruck aufdrängt, etwas verstanden zu haben, »weil das, was der Schrift nach, vom Graphischen her, augenscheinlich ähnlich war, nichts anderes als ›bou‹ heißen konnte, die gemeinsame Anfangssilbe von boucher und boulanger« (Lévi-Strauss 1980a: 20). Lesen zu lernen schien für das Kind gleichbedeutend mit der Aufgabe zu sein, das Lautbild /bou/ mit einem Schriftbild »bou« zu verknüpfen, ohne dass es dazu eines Vorstellungsinhaltes bedurft hätte. Dass »bou« für sich genommen nichts bedeutete, ist für Lévi-Strauss zweitrangig gewesen. Diese Zurückstellung des Sinns zu Gunsten der Entdeckung von Invarianten (vgl. Teil II, 3. Kapitel) »war vermutlich mein ganzes Leben hindurch eines meiner beherrschendsten Interessen« (ebd.).
Den ersten Weltkrieg verbringt Lévi-Strauss mit seiner Mutter und seinen Tanten beim Rabbiner-Großvater in Versailles, wo er auch eingeschult wird. Nach Ende des Krieges kehrt die Familie wieder in die französische Hauptstadt zurück. Lévi-Strauss besucht hier bis zum Abitur das Gymnasium Janson-de-Sailly. Mit dreizehn feiert er seine Bar’mitsva, den Passageritus, durch den er in die jüdische Religionsgemeinschaft aufgenommen wird. Das geschieht freilich einzig aus dem Grund, »meinem Großvater doch ja keinen Kummer zu bereiten« (Lévi-Strauss 1989: 16). Die Eltern von Lévi-Strauss achten zwar noch die äußeren Formen, doch hatten sie die innere Bindung zum jüdischen Glauben aufgegeben. Noch als 80-Jähriger wird Lévi-Strauss von sich sagen, dass er für religiöse Losungen taub sei. Gleichwohl wäre auch er »mehr und mehr von dem Gefühl durchdrungen, dass der Kosmos und der Platz des Menschen im Universum unser Fassungsvermögen übersteigen und stets übersteigen werden. Es kommt vor, dass ich mich mit Gläubigen besser verstehe als mit eingefleischten Rationalisten. Immerhin besitzen jene ein Gespür für das Mysterium« (ebd.). Nach Ansicht von Lévi-Strauss unterscheiden sich allerdings Gläubige und Wissenschaftler durch die Bewertung des Geheimnisses: »Sie sehen darin etwas Positives, ich etwas rein Negatives. Aber immerhin erzeugt ihre Einstellung eine Atmosphäre, in der wir uns begegnen können« (Lévi-Strauss 2004: 10).
Nach Abschluss des Gymnasiums beginnt Lévi-Strauss zunächst mit dem Vorbereitungsjahr auf eine der Écoles normales supérieures, den Elitehochschulen Frankreichs. Wegen Schwierigkeiten in Mathematik und Griechisch bricht er die Vorbereitungszeit jedoch ab und wählt stattdessen ein Jurastudium an der Sorbonne. Weil ihn jedoch die Jurisprudenz zunehmend langweilt, beginnt er zusätzlich mit einem Philosophiestudium. Doch auch hier fühlt er sich fremd: »Im Grunde bin ich wie ein Zombie durch das Gelände gestreunt, mit dem Gefühl, dass ich draußen blieb« (Lévi-Strauss 1989: 21). Mehr als das Studium begeistert Lévi-Strauss die Politik. Unter dem Einfluss belgischer Freunde der Familie hatte er als 16-Jähriger die Werke von Karl Marx für sich entdeckt und 1926 im Verlag der belgischen Arbeiterpartei seinen ersten Text über Gracchus Babeuf (1760–1797) publiziert, einen Linksaktivisten der französischen Revolution. Obwohl er kein normalien ist, wird er während seines Studiums an der Pariser Universität zum Sekretär der sozialistischen Studiengruppe der Écoles, wenig später zum Generalsekretär der Vereinigung sozialistischer Studenten; in den Jahren von 1928–1930 ist er Sekretär des sozialistischen Abgeordneten Georges Monnet (1898–1980), der später Landwirtschaftsminister wird. Sein stage d’aggregation, ein dreiwöchiges Referendariat, verbringt Lévi-Strauss an seinem alten Gymnasium. Mit dabei sind zwei Kommilitonen, die später ebenfalls berühmt werden sollten: Simone de Beauvoir (1908–1986) und Maurice Merleau-Ponty (1908–1961). In ihren Memoiren schreibt de Beauvoir über Lévi-Strauss: »Er schüchterte mich durch sein Phlegma ein, doch er verwendete es mit Geschick, und ich fand ihn sehr komisch, wenn er mit farbloser Stimme und völlig unbewegtem Gesicht unserem Auditorium die Torheit der Leidenschaft auseinandersetzte« (in Lévi-Strauss 1989: 23f.). Seine philosophische Zulassungsarbeit zur Staatsexamensprüfung schreibt Lévi-Strauss über Marx mit dem Hintergedanken, »der Philosoph der Sozialistischen Partei zu werden« (a.a.O.: 28). Zunächst jedoch nötigt ihm der Abschluss seines Studiums alle Konzentration ab. Den praktischen Teil der Staatsexamensprüfung plant er, mit medizinischen Hilfsmitteln zu überstehen: »Ein Arzt, der ein Freund der Familie war, hatte mir eine Ampulle – Morphium, Kokain? – geschenkt, die, wie er behauptete, mir Geistesstärke verschaffe, wenn ich sie vor der leçon tränke« (a.a.O.: 21). Doch es kommt anders als gedacht. Denn während der siebenstündigen Vorbereitungszeit auf den Prüfungsvortrag, zu der man alle Prüflinge in die Bibliothek einsperrt, liegt er wie ein Seekranker ausgestreckt auf zwei Stühlen, vollkommen unfähig, sich auf das Thema vorzubereiten, das ihm zugelost wurde. Er improvisiert schließlich einen Vortrag zum Thema »gibt es eine angewandte Psychologie?« – und wird als brillant beurteilt. »Letztlich hatte die Droge wahrscheinlich doch ihren Dienst getan« (a.a.O.: 22f.).
Im Anschluss an das bestandene Staatsexamen im Jahr 1931 absolviert Lévi-Strauss seinen Militärdienst. Am 1. Oktober 1932 tritt er seine Stelle als Lehrer für Philosophie in Mont-de-Marsan an. Seine Fahrt in den Südwesten Frankreichs ist so etwas wie eine Hochzeitsreise: Kurz zuvor hatte er Dina Dreyfuß geheiratet. Auch in Mont-de-Marsan mischt er sich zunächst in die Lokalpolitik ein und kandidiert für die sozialistische Partei bei den Bezirkswahlen. Doch der Wahlkampf endet für ihn abrupt: Er setzt das Wahlkampfauto in den Graben: »Das war der erste Tag des Wahlkampfs und auch der letzte« (a.a.O.: 27).





























